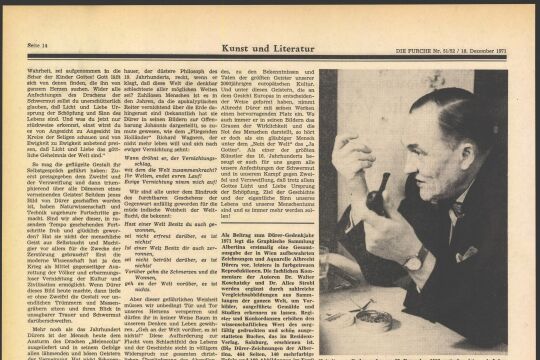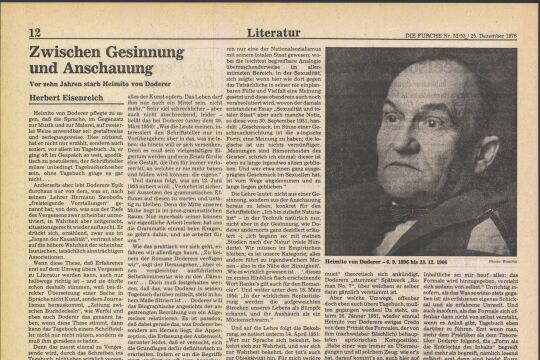Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Menschwerdung des Schriftstellers Heimito von Doderer
Unter dem 18. November 1950 notiert Heimito von Doderer in seinem (inzwischen publizierten) Tagebuch: „Vorher in der — von Hans Weigel veranlaßten — Lesung aus Arbeiten junger Talente... Eindruck, in summa: ,1m Scheffelhaus' (von Walter Toman) — eine begabte Groteske. Ferner Eisenreich und vielleicht auch Federmann...“ Ich kannte Doderer damals noch nicht einmal dem Namen nach, und man kann sich meine Verwunderung denken, als ich ein halbes Jahr später, unmittelbar vor meiner ersten Reise nach Deutschland, durch Weigel ein von Doderer an seinen Münchner Verleger gerichtetes Empfehlungsschreiben mitbekam. Ich las dann einige Passagen der soeben erschienenen „Strudelhofstiege“, schrieb begeistert einen Brief, und ward im Herbst 1951 erstmals in die Buchfeldgasse eingeladen.
Unter dem 18. November 1950 notiert Heimito von Doderer in seinem (inzwischen publizierten) Tagebuch: „Vorher in der — von Hans Weigel veranlaßten — Lesung aus Arbeiten junger Talente... Eindruck, in summa: ,1m Scheffelhaus' (von Walter Toman) — eine begabte Groteske. Ferner Eisenreich und vielleicht auch Federmann...“ Ich kannte Doderer damals noch nicht einmal dem Namen nach, und man kann sich meine Verwunderung denken, als ich ein halbes Jahr später, unmittelbar vor meiner ersten Reise nach Deutschland, durch Weigel ein von Doderer an seinen Münchner Verleger gerichtetes Empfehlungsschreiben mitbekam. Ich las dann einige Passagen der soeben erschienenen „Strudelhofstiege“, schrieb begeistert einen Brief, und ward im Herbst 1951 erstmals in die Buchfeldgasse eingeladen.
Ich glaube, schon damals, oder doch bei einem Besuch sehr bald darauf, zitierte Doderer mir einen Satz aus Güterslohs Roman „Eine sagenhafte Figur“:
„Es darf ein Mensch, der des Wortes mächtig ist, keine Lage schweigend verlassen: dies fiele zu leicht, dies gälte nicht vor dem Gotte. Und gar zu dem, den er liebt, doch nicht für fähig hält, ihn zu fassen, darf er ja nicht reden wie zu einem Kinde oder unansprechbaren Schüler. Denn nicht darauf kommt es an — obwohl es uns darauf ankommt; aber: Was wissen wir von dem, was wir eigentlich wissen sollten? —, gerade von diesem da und in eben diesem Augenblicke verstanden zu werden, sondern einzig darauf, zu sagen, was nur jetzt oder nie mehr, und nur von uns und von keinem andern gesagt werden kann. Die ausgesprochenen Worte, in denen das heilig Gegenwärtige erst den echten Erweis seines Daseins gefunden hat, wirken ungehindert so lange weiter, bis sie ihr hörend Ohr erreichen: Es muß nicht das mit dem Rauschen der kosenden Zunge erfüllte des geliebten Hauptes sein, und es ist es auch in der Regel nicht.“
Dieses Grundgesetz des Schriftstellers legte Doderer mir immer wieder ans Herz in einem geradezu beschwörenden Ton.
Ein Jahr später trafen wir uns dann in Berlin und mehrmals in Hamburg, und da sprach Doderer auch von sehr persönlichen Dingen: so von seiner Jugend, wo — ich zitiere aus dem Gedächtnis, aber fast wörtlich — „ganze Areale abgeholzt und brachgelegt worden waren und erst in späteren Jahren mühsam neu bepflanzt werden konnten“. Er sagte auch: „Ich weiß, Sie werden das alles einmal viel besser machen als ich.“ Und auf dem Hamburger Hauptbahnhof, als er abreiste, umarmte er mich und zeichnete mir das Kreuz auf die Stirn.
Dieses hilfreiche Interesse an mir und an vielen anderen jungen Schriftstellern entsprang zweifellos dem vielleicht gar nicht bewußten Wunsch, uns diejenigen Leiden, die ihn beinahe zerbrochen hatten, zu ersparen und damit das gestörte Gleichgewicht wiederherzustellen. Hierher gehört auch ein späteres Gespräch im Cafe Fröhlich, an einem Nachmittag wohl des Jahres 1956. Mein seliger Freund Kurt Absolon war dabei, und dieser, damals einunddreißig Jahre alt, sagte in dem rüden Ton, hinter dem er seine Sensibilität verbarg: Er pfeife auf den Erfolg, er hätte ja schon mehrmals ausstellen können, aber er habe noch sehr viel Zeit vor sich — zwei Jahre später war er tot —, und er lasse sich nicht in äußere Positionen drängen oder tragen, die er zuinnerst noch nicht verantworten könne; und überhaupt sei Erfolg für den wahren Künstler unwichtig, ja eher schädlich. Darauf antwortete der damals sechzigjährige Doderer in einem mir an ihm unbekannten schmerzlichen Ernst uns Dreißigjährigen etwa folgendes: „Seids froh, daß ihr jetzt schon Erfolg habt. Ich hab' bis zu meinem fünfundfünfzigsten Lebensjahr darauf warten müssen, und ihr wißt nicht, was das bedeutet: was man dadurch an Selbstvertrauen, an Mut, an Kraft verliert.“
Hier muß ich noch die Erinnerung an ein anderes, scheinbar bedeutungsloses Erlebnis einschalten: Ich bummelte — 1955 dürfte das gewesen sein — mit meiner Frau in der Josefstädter Straße, und plötzlich sahen wir auf dem Trottoir der anderen Seite Heimito von Doderer gehen: gebeugt, und schleppenden Schrittes: fast ein Greis. Wir traten auf ihn zu, und als er unser ansichtig wurde, lief ein Ruck durch seinen ganzen Körper, Alter und Müdigkeit waren verscheucht, er lud uns zu sich auf einen Mokka und agierte zwei Stunden lang als ein Gastgeber von größter geistiger und physischer Vitalität. Damals wurde mir bewußt, in welchem Maß sein Werk ein Produkt der Disziplin ist; ich begann, etwas davon zu ahnen, gegen welche Widerstände da um des Werkes willen angekämpft wurde. Auch spürte ich nunmehr deutlicher den Krampf, als der dieser Kampf sich literarisch mitunter manifestierte, etwa in manchen Passagen der „Dämonen“.
Doderer war nämlich ein existentieller Schriftsteller par excellence; das will heißen, daß Leben und Werk in einer sich gegenseitig begründenden Wechselwirkung standen, wie sonst nur bei Stifter, den Doderer affektiv ablehnte — wie man ja immer affektiv ablehnt, was einem allzu nahe kommt. Ohne deswegen direkt autobiographisch zu werden, nahm Doderer seine Lebensdaten zum Rohstoff seiner Dichtung, und diese wiederum benützte er als ein Mittel seiner Menschwerdung. Die Befreiung von Kampf und Krampf nun vollzog sich, meinem Dafürhalten nach, in dem Roman „Die Merowinger“, den ich als ein „Selbstgericht“ empfunden habe. Da wurden die Dinge auf die Spitze getrieben, zum Umkippen gebracht und so der Lächerlichkeit preisgegeben. Damit aber war die Bahn frei für ein absichtsloses Erzählen und für dessen Voraussetzung: für ein — wie Doderer früher schon formuliert hatte — Sehen der Welt mit einem halb schon nach oben gebrochenen Auge. Die Bahn war frei für den ,,Roman No 7“, zuerst für „Die Wasserfälle von Slunj“, die 1962 abgeschlossen und 1963 gedruckt wurden.
Um diese Zeit dürfte Doderers Todeskrankheit sich angemeldet haben, und zu eben der Zeit begann er, als zweiten Teil des „Romans No 7“, den „Grenzwald“, den er selber als „Roman Muet“, als stummen Roman, bezeichnete: als einen Roman ohne jede kommentierende oder interpretierende Einmischung des Autors. Und was nach den „Wasserfällen“ unmöglich schien, eine weitere Steigerung hin zur absoluten Prosa: das gelang dann dennoch mit diesem Roman, der nur als Fragment und trotzdem in höchster Vollendung auf uns gekommen ist. Er atmet, bei aller Turbulenz der geschilderten Ereignisse, einen Frieden aus, der schon nicht mehr von dieser Welt ist. Und diesen Frieden hat Heimito von Doderer mit diesem Buch für sich selber gewonnen. Ich bemerkte das schon zu seinen Lebzeiten, voll ins Bewußtsein tritt es mir aber erst jetzt: In den ersten zwölf von den fünfzehn Jahren, in denen ich die Ehre, das Vergnügen und den Nutzen hatte, als Schüler und später auch als Freund dem Meister nahe zu sein, in jenen zwölf Jahren also hatte Doderer unaufhörlich doziert; bei aller formellen Respektierung seines Partners hat er meistens die Führung des Gesprächs an sich gerissen und es in einen (freilich immer hörenswerten) Monolog verwandelt. In den allerletzten Jahren aber beobachtete ich eine merkwürdige Veränderung: Doderer bevorzugte kleine, intime Gesellschaften, wir saßen zu zweit, zu dritt, zu viert in einem seiner Stammbeisel nahe der Strudlhofstiege oder in dem abends fast menschenleeren Garten des Restaurants Schöner, und wenn auch noch immer Tabak und Wein nicht fehlen durften, so brachen wir doch schon lange vor Mitternacht auf. An solchen Abenden nun, obwohl wir jungen Schriftsteller — neben mir etwa György Sebestyen, Peter Marginter, Wolfgang Fleischer — in seiner Gegenwart wirklich nie die Absicht hatten, das große Wort zu führen, an solchen Abenden also räumte Doderer uns zusehends mehr Raum ein, indem er sich selber zu einem großen lauschenden Ohr machte, so nichtig vielleicht auch sein mochte, was wir Buben ihm zu sagen hatten. So absichtslos wie sein letzter Roman, so war er selber geworden: nicht mehr durch Worte, sondern nur noch durch sein gelebtes Beispiel wollte er uns belehren. Und manchmal schien mir sogar, er wolle überhaupt nicht mehr belehren, sondern nur selber noch lernen.
Nur aus solchem Lauschen eines, der sich selber nicht mehr wichtig nimmt, konnte die wundervolle „Grenzwald“-Prosa entstehen: da Leben und Werk identisch geworden waren in dem kritiklosen Einverständnis mit dem Schicksal. Deshalb zeugt dieses Buch, über dem Heimito von Doderer gestorben ist, vom Leben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!