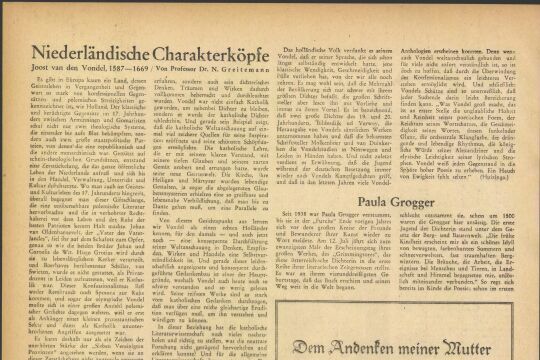Von Franz Stelzhamer wieder einmal zu sprechen ist keineswegs ein unzeitgemäßes Beginnen, wenngleich keine zahlenrunde Wiederkehr seines Geburts- oder Sterbejahres hiezu Anlaß gibt. Geht es doch heute allenthalben darum, den geistigen, den unzerstörbaren Schatz zu sichten, der uns inmitten der Trümmer äußerlichen Besitzes verblieben ist, uns seiner bewußt zu werden und ihm gebührende Würdigung zu sichern.
Eines Abends schlägt dem schon Zwei-unddreißigjährigen im Herrenstübl des Schärdinger Einkehrbräuhauses unversehens seine Schicksalsstunde. Kläglich genug ist er in der schönen Innstadt angekommen, wo er seinen alten Kameraden Thanner aus der Salzburger Studienzeit wohnen weiß. Mit einer wandernden Schauspielertruppe war er durch das Land zigeunert und hatte damit den ehrsamen Bauernekern daheim in Piesenham vielleicht die schwerste Kränkung bereitet, die überhaupt denkbar war. Ihn in priesterlichem Gewände am Altar stehen zu sehen, diese Hoffnung hatten sie freilich längst schon begraben müssen, aber daß er nun gar bis zum fahrenden Komödianten hinabgesunken war, das bedeutete nach damaligen Begriffen Schande und Spott für die ganze Familie. Da hatte ihm der zürnende Vater das Elternhaus verboten, und wenn der Postbote im „Siebengütl“ einen Brief des verlorenen Sohnes abgeben wollte, so konnte er ihn nur gleich wieder uneröffnet mitnehmen. Das Schlimmste aber kam, als die Truppe in Passau jämmerlich zusammenbrach. Während die anderen Mitglieder in alle Winde zerstoben, ließ ihn selber der Wirt nicht ziehen, ehe seine Schulden beglichen wären. In seiner Bedrängnis schickte er der Mutter heimliche Botschaft, und die raffte eilends alle ihre Sparpfennige zusammen und wanderte die zwölf Gehstunden von Piesenham nach Passau, um den Sohn auszulösen. Als sie hernach den Argverzagten noch bis Schärding geleitete, da schritt er in seiner lächerlichen Komödiantentracht mit dem lichtblauen Frack, den gelben Nankinghosen und dem weißen Zylinderhut beschämt genug neben dem biederen Bauernweiblein in der schlichten, altehrwürdig innviertlerischen Kleidung auf der Straße einher. In Schärding vertraut er dem Jugendfreunde ein Geheimnis an: Daß er Gedichte geschrieben habe, Lieder in der innviertlerischen Mundart, schon ein ganzes Heft voll. Und da sie nun an diesem schicksalhaften Abend mit etlichen anderen Gästen im Herrenstübl des Brauhauses beisammensitzen, ermuntert ihn Thanner, doch aus seinem Heft etliches vorzulesen Stelz-hamer liest und liest, und siehe da. er findet mit seinen Liedern ungeahnten Anklang, weit größeren, als er kürzlich bei der Truppe mit seinem Franz Moor und all den albernen Possenfiguren fand, die er dort zu spielen hatte. Diese Gedichte müßten doch gedruckt werden, rufen die Zuhörer. Sie wollen sogleich auf solch ein Heft voller innviertlerischer Heimatlieder vorgemerkt sein, und jeder zeichnet einen Gulden.
Jetzt sieht Stelzhamer, der Philosophie, Rechtswissenschaften und Theologie studiert, der die Wiener Malerakademie besucht, sich hernach jahrelang als Erzieher fortgebracht und schließlich das armselige Leben eines Wanderkomödianten geführt hat, seinen Weg endlich klar vor sich. Er hat die Wirkung seiner Gedichte erprobt, aber auch die seines Vortrages. Und dabei beschließt er nun zu bleiben. Er will ein Verkünder seiner geliebten Heimat und seines Volkes werden. Fortab zieht er als wandernder Rhapsode landauf landab, er wird an Fürstenhöfen nicht minder gerne angehört, wie von seinen Bauern in der Gaststube oder unter der dörflichen Linde. Über die Art seines Vortrages besitzen wir die Aussage eines fachkundigen und sicher nicht voreingenommenen Zeugen. Karl Wallner, der bekannte Schauspieler und Direktor des Berliner Wallner-Theaters, schreibt: „Man muß Stelzhamer seine Dichtungen vortragen gehört haben, um ihre mächtige Wirkung 'zu begreifen. Seine nichts weniger als schönen Züge veredelten und verklärten sich im lebendigsten Ausdruck, die Stimme klang bei weichen Stellen, als ob sie sich durch einen Tränenschleier Bahn brechen wollte zu den Herzen der Zuhörer, die der Dichter unwiderstehlich eroberte. Dabei keine Spur von theatralischen Behelfen, von Effekthascherei, von irgendeiner verstimmenden Absicht.-In Wahrheit, jeder von uns Komödianten könnte viel lernen von dem Bauerndichter aus Österreich!“ Diese seine „Liederfahrten“ führen ihn mehrfach auch über die oberösterreichischen Grenzen und natürlich auch immer wieder nach Wien, wo sich einmal, nach einer Vorlesung im „Römischen Kaiser“ auf der Freyung in der Person des k. k. Hofbuchhändlers Peter Rohrmann endlich auch der langersehnte Verleger meldet. Stelzhammer bereitet die Drucklegung dieses ersten Bandes seiner Gedichte daheim im Elternhause vor, wo er nun wieder in verzeihender Liebe aufgenommen ist. Während er am Tische sitzt und arbeitet, ermuntert ihn der schon auf den Tod darniederliegende Vater aus den Vorhängen seines Bettes hervor: „Franz, machs nur grad gut!“ Der Vater erlebt es nicht mehr, zu sehen, wie gut es sein einstiges Sorgenkind machte. Aber die Mutter, die hält, ehe ein Jahr später auch sie in die Ewigkeit eingeht, den fertigen Band noch mit verschämtem Stolz in den Händen. Hat ihn der Sohn doch ihr gewidmet und setzt ihr doch seine dankbare Kindesliebe mit einem der schönsten Gedichte, „Mein Müaderl“, darinnen er das Herz der Mütter mit einem ewigen Brunnen vergleicht, ein unvergängliches Denkmal. Das Buch macht ihn mit einem Schlage zum bekannten, ja gefeierten Dichter. Er wird in den Kreis der literarischen Welt einbezogen, er darf im Wiener „Silbernen Kaffeehaus“ mit Größen wie Grill-parzer, Lenau, J. G. Seidl, Anastasius Grün Umgang pflegen. Den allerschönsten Erfolg aber bestätigt ihm kein Geringerer als Feuchte leben, wenn er schreibt: „Stelz-hamers Gesänge haben die Anerkennung gefunden, die sie verdienen. Sie werden in dem Lande, in dem sie leben und weben, gesprochen und gesungen, sie sind in das Herz des Volkes, aus dem sie sprossen, zurückgekehrt, eine Anerkennung, die mehr wert ist als alle Kritik.“ Gleichwohl bleibt das Leben, das er sich gewählt hat, bis ins Alter hinein ein Leben der Dürftigkeit und Unrast, und mag er sich auch in kraftvoll freudiger Daseinsbejahung rühmen, allezeit dazustehen „wiar a Kersch-bam in ewiger Blüah“, so befällt ihn doch bisweilen die Sehnsucht nach Geborgenheit und Seßhaftigkeit. Erst wenige Jahre vor seinem Tode wird ihm mit einem zweiten, kindergesegneten Eheglück auch ein friedvoller, sorgenbefreiter Nachsommer beschieden. Der Kaiser hat ihn mit der großen goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet, die Regierung und der oberösterreichische Landtag bedenken ihn mit ausreichenden Ruhegenüssen. An seinem Grabe auf dem Henndorfer Friedhof legt ein Redner ein großes Versprechen ab: „Solange Gottes freier Odem durch die Fluren weht, solange der Hausruckwald rauscht, der deine Wiege beschattete, so1 lange die stolzen Scheitel der deutschen Alpen auf die Stätte niederschauen, welche deine irdische Hülle deckt, solange werden wir und unsere Kindeskinder deiner gedenken.“ Aber schon sechs Jahre später muß Rosegger in seinem „Heimgarten“ an ihn erinnern als an „Einen, den sie vergessen wollen“, und anklagend feststellen, daß sich „kein Mensch mehr um Stelzhamers Schriften kümmere“.
Das hat sich nachher freilich gebessert, namentlich dank den treuen Bemühungen des Linzer Stelzhamerbundes. Und eines oder das andere seiner Gedichte fehlte kaum je in einem österreichischen Lesebuche Aber in einem Buchladen einen Sammelband seiner Werke aufzustöbern, dazu gehört schon seit geraumer Zeit einiges Glück. Den begeisterten Hinweisen einzelner Kenner, insbesondere Hermann Bahrs, gelang es nicht, diesen Stelzhamer „in Mode“ zu bringen, wie dies erfreulicherweise in heute immer noch steigendem Maße bei Adalbert Stifter glückte, den wir beinahe als Stelzhamers engeren Landsmann ansprechen dürfen, denn seine Kindheit umrauschten die böhmischen Wälder kaum zwei Wegstunden jenseits der orjerösterreichischen Grenze. Als Erzähler tritt der Innviertier, der uns auch eine Reihe von Novellen und Schilderungen schenkte, freilich weit hinter den Böhmerwäldler zurück, gleichwie ihm auch seine hochdeutsche Lyrik kaum ein Anrecht auf einen bedeutsamen und dauernden Rang sichern könnte. In seinem dialektischen Gedicht aber, wenn er in der Bauernsprache seines Volkes redet, wenn er gewissermaßen „einhertritt auf der eig'nen Spur“, da wird er groß und frei, da wird er ein Neuer und Einmaliger. Nur in dieser Sprache vermag er sich ganz zu offenbaren, sie bringt ihm die zartesten und blühendsten Worte zu, die treffendsten Wendungen und den ganzen Bilderreichtum, der sich seit Jahrhunderten im Bauernvolke seiner Heimat angehäuft hat. Dieser Mundart folgt er mit unbedingter Treue und unerbittlicher Echtheit, er „mildert“ und verwässert sie nicht, wie das manche andere Dialektdichter zur größeren Bequemlichkeit ihrer Leser gerne tun. Und so hat es schon seine Richtigkeit, daß diese Dichtungen manchem, dessen Wiege nicht von einer innviertlerischen, ja etwa nicht einmal von einer oberösterreichischen Mutter geschaukelt wurde, zunächst ein dornig abweisliches Heckenrosengestrüpp bedeuten, in das er nur mühsam mit Hilfe zahlreicher worterklärender Fußoten einzudringen vermag, wenn er darin Rosen brechen will. Aber solche Mühe verringert sich von Mal zu Mal, und bald sieht sich der beharrliche Leser reich belohnt. Es ist durchaus nicht zu begreifen, warum sich bei uns zulande manche Leute lieber bereit finden, sich durch das für uns noch viel beschwerlichere Plattdeutsch durchzubeißen, um sich den Weg zu Fritz Reuters Romanen oder zur Lyrik Klaus Groths zu bahnen, als daß sie sich entschlössen, mit unseren österreichischen Mundarten vertraut zu werden, in denen allenthalben ungeahnte Schätze auf sie warten. Uns dünkt, daß die Schüler unserer höheren Lehranstalten in diese Mundarten einigermaßen eingeführt werden könnten, mit ähnlichem Rechte, mit dem ihnen die Kenntnis des Mittelhochdeutschen vermittelt wird, und wer dagegen einwenden wollte, diese Kenntnis sei doch weit mehr vonnöten, weil ja im Mittelhochdeutschen unsere heutige Schriftsprache verwurzelt erscheine, dem sei geraten, doch einmal in die mühlviertlerische Mundart hineinzuhorchen, in der uns Hanrieders „Bauernkrieg“ mit Wucht entgegentritt, oder in jene des niederösterreichischen Landes unter dem Manhartsberg, in der uns Missons
„Naz“ lieblich anspricht, oder in jene inn-viertlerische, in der uns Stelzhamers „Ahnl“ so sehr entzückt; er wird da bald verspüren, wie tief aus dem Muttergrunde unserer Sprache sie heraufrauschen und wie vieles in ihnen noch getreulich erhalten ist, was sich aus unserem verarmenden Schriftdeutsch bereits hinweggestohlen hat oder eben hinwegzustehlen beginnt.
Als das Bedeutendste, das uns Stelzhamer neben der bunten Fülle seiner kleineren Gedichte schenkte, in denen er unermüdlich die Schönheit seiner Heimat, Freude und Sorge seines Volkes, das Glück der Jugend und des Elternhauses besang,müssen wir wohl seine „Ahnl“ erkennen, ein mundartliches Epos in Versen, die meisterlich in die hexametrische Form gegossen sind, etwas mehr als eineinhalbtausend an der Zahl. Es zeigt also denselben Umfang, wie die ersten drei Gesänge der „Ilias“ zusammengenommen. Beginnen wir zu lesen, so finden wir uns bald an das homerische Gedicht erinnert, nicht etvra bloß durch das gleiche Versmaß, sondern nicht minder auch durch den gleichen Aufbau der Handlung. Denn wie jenes mit dem Zorn des Achill einsetzt, um dann rückgreifend die Ereignisse zu erzählen, welche diesen entflammten, so schildert uns die „Ahnl“ zunächst den Morgen des Tages, an dem die liebliche Rosina mit dem ihr fast fremden Manne vermählt werden soll, welchen die Großmutter, die Ahnl, dem verwaisten Enkelkind selbstherrlich bestimmt hat, und erst allmählich eriahren wir die Vorgeschichte: Rosina hat ihre heimliche Neigung einem besitzlosen Burschen zugewendet, der ihrer nicht würdig ist, einem Prahlhans und Großsprecher. Kaum hatte die Ahnl die beiden bei einem nächtlichen Beisammensem überrascht, so macht sie sich auf den Weg nach einem fernen Dorfe und schafft alsbald den Mann zur Stelle, den sie für den richtigen hält, den richtigen für Rosina und für den großer Hof, der ihr zufällt, einen tüchtigen, rechtschaffenen Bauernsohn. Sie kümmert sich nicht um die heimlichen Tränen des Enkelkindes, zielsicher betreibt sie die Vorbereitungen zur Heirat, die gleichzeitig mit ihrem eigenen goldenen Hochzeitsfest stattfinden soll. Rosina fügt sxb gehorsam dem harten Willen der Ahnl. Und nun ist es großartig, mit welcher schlichten Würde der Bräutigam sich einführt, wie er allmählich in den Vordergrund tritt, wie sein Bild immer mehr zu seinem Vorteil an Farbe gewinnt und zugleich das jenes anderen Burschen immer mehr verblaßt, wie er dessen wiederholte Versuche, die Heirat noch im letzten Augenblicke zu vereiteln und mit gedungenen Helfershelfern die Braut zu entführen, kraftvoll niederschlägt. Schlechthin großartig auch, wie solcher echter Männlichkeit die Liebe Rosinas rasch entgegenreift, wie sie erkennt, daß die Ahnl für sie die richtige Wahl traf, wie sie sich in der Obhut dieses Mannes geborgen fühlt. So entläßt uns das Bauernepos, nachdem es uns auf die feierliche Höhe der alten, frommen Hochzeitsbräuche des oberösterreichischen Landvolkes geführt hat, mit der Gewißheit, daß diese Heirat das echte Glück zweier Menschen begründet.
Mag es immerhin kühn erscheinen, dieses mundartliche Gedicht in Vergleich zu setzen mit den gewaltigen Epen Homers, den man so gerne als den größten Dichter aller Zeiten anspricht. Allein die Kraft der Sprache, die Anschaulichkeit, mit der es Wortstreit und Handgemenge der Männer, Zucht und Zungentücke der Frauen, Mühe und Segen ländlicher Arbeit, Sitte und Brauch des Volkes, Freude des Liedes und des Tanzes, Üppigkeit des Mahles, Behagen des Umtrunkes, Kleidung und Hausrat z schildern weiß, der weiterschlossene Kreis seiner Lebensweisheit, sein gütiges Verstehen aller Regungen des Herzens, dies a'les dürfte solchem Vergleiche. immerhin eine gewisse Berechtigung sichern. Für unser kleines Oberösterreich bedeutet die „Ahnl“ auch ein kulturhistorisches Dokument, ähnlich wie „Ilias“ und „Odyssee“ für das alte Griechenland. Stellen wir uns zudem noch den Dichter vor, wie er als Rhapsode durch das Land wandert, nidit anders als es der sagenhafte Blinde tat und alle die Späteren, die seine Epen durch Hellas trugen, so sind wir auch hiedurch an Homer gemahnt.
Vor etwa vier Jahrzehnten schrieb Hermann Bahr, der mit dem Schauspiel „Der Franzi“, wohl dem liebreichsten und wertvollsten aller dramatischen Lebensbilder, die unsere Bühne besitzt, dem Landsmann ein würdiges Denkmal setzte, man habe oft gesagt, in den Werken Balzacs sei das ganze Frankreich zu finden, und darum seien sie auch in ganz Frankreich bekannt. Mit dem gleichen Recht könne man sagen, in Stelz-hamers „Ahnl“ stehe das ganze Oberösterreich, aber wer kenne sie? Wir fürchten, wir könnten die gleiche Frage auch heute noch stellen, ohne daß sich mehr Hände bejahend erhüben als damals.