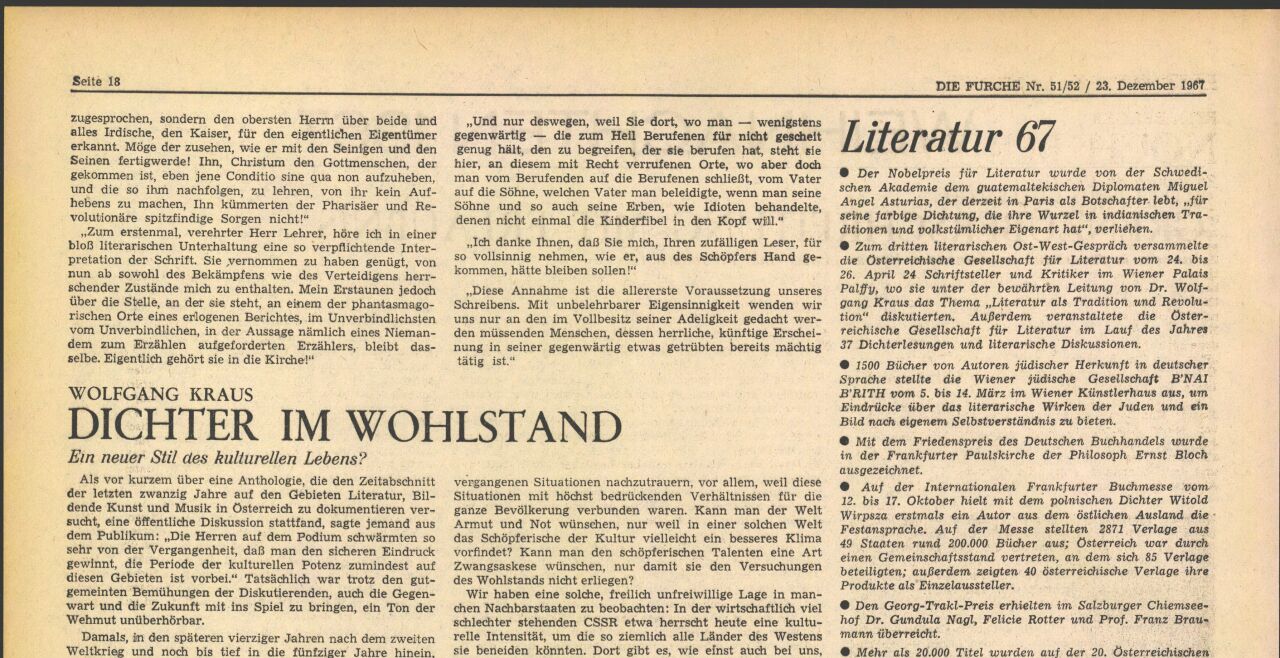
zugesprochen, sondern den obersten Herrn über beide und alles Irdische, den Kaiser, für den eigentlichen Eigentümer erkannt. Möge der zusehen, wie er mit den Seinigen und den Seinen fertigwerde! Ihn, Christum den Gottmenschen, der gekommen ist, eben jene Conditio sine qua non aufzuheben, und die so ihm nachfolgen, zu lehren, von ihr kein Aufhebens zu machen, Ihn kümmei-ten der Pharisäer und Revolutionäre spitzfindige Sorgen nicht!“
„Zum erstenmal, verehrter Herr Lehrer, höre ich in einer bloß literarischen Unterhaltung eine so verpflichtende Interpretation der Schrift. Sie .vernommen zu haben genügt, von nun ab sowohl des Bekämpfens wie des Verteidigens herrschender Zustände mich zu enthalten. Mein Erstaunen jedoch über die Stelle, an der sie steht, an einem der phantasmago-rischen Orte eines erlogenen Berichtes, im Unverbindlichsten vom Unverbindlichen, in der Aussage nämlich eines Niemandem zum Erzählen aufgeforderten Erzählers, bleibt dasselbe. Eigentlich gehört sie in die Kirche!“
„Und nur deswegen, weil Sie dort, wo man — wenigstens gegenwärtig — die zum Heil Berufenen für nicht gescheit
genug hält, den zu begreifen, der sie berufen hat, steht sie hier, an diesem mit Recht verrufenen Orte, wo aber doch man vom Berufenden auf die Berufenen schließt, vom Vater auf die Söhne, welchen Vater man beleidigte, wenn man seine Söhne und so auch seine Erben, wie Idioten behandelte, denen nicht einmal die Kinderfibel in den Kopf will.“
„Ich danke Ihnen, daß Sie mich, Ihren zufälligen Leser, für so vollsinnig nehmen, wie er, aus des Schöpfers Hand gekommen, hätte bleiben sollen!“
„Diese Annahme ist die allererste Voraussetzung unseres Schreibens. Mit unbelehrbarer Eigensinnigkeit wenden wir uns nur an den im Vollbesitz seiner Adeligkeit gedacht werden müssenden Menschen, dessen herrliche, künftige Erscheinung in seiner gegenwärtig etwas getrübten bereits mächtig tätig ist.“
Als vor kurzem über eine Anthologie, die den Zeitabschnitt der letzten zwanzig Jahre auf den Gebieten Literatur, Bildende Kunst und Musik in Österreich zu dokumentieren versucht, eine öffentliche Diskussion stattfand, sagte jemand aus dem Publikum: „Die Herren auf dem Podium schwärmten so sehr von der Vergangenheit, daß man den sicheren Eindruck gewinnt, die Periode der kulturellen Potenz zumindest auf diesen Gebieten ist vorbei.“ Tatsächlich war trotz den gutgemeinten Bemühungen der Diskutierenden, auch die Gegenwart und die Zukunft mit ins Spiel zu bringen, ein Ton der Wehmut unüberhörbar.
Damals, in den späteren vierziger Jahren nach dem zweiten Weltkrieg und noch bis tief in die fünfziger Jahre hinein, als man nur schlecht zu essen, kaum zu heizen, oft nicht einmal ein ordentliches Dach über dem Kopf hatte, war das kulturelle Leben noch von einer Intensität, die heute längst nicht mehr zu verspüren ist. Die Schriftsteller, Maler, Künstler aller Art oder solche, die es werden wollten, saßen in Kaffeehäusern, Redaktionen, irgendwelchen schäbigen Buden beisammen, diskutierten über Probleme, hegten große Pläne, hatten eine aufregende Vision von der Zukunft. Es gab eine ganze Reihe größerer und kleinerer Zeitschriften — es sei nur an den „Plan“, den „Turm“, das „Silberboot“ und die „Neuen Wege“ erinnert — der „Art-Club“ versammelte vielversprechende Talente um sich; und da es in diesen Jahren kaum etwas zu verdienen und auch nur sehr wenig zu kaufen gab, mußte man sich wegen materieller Ablenkungen keine zu großen Sorgen machen. Außerdem hatte man den Krieg eben erst hinter sich, man war gerade noch einmal davongekommen, die existentielle Situation war bis in die Tiefe aufgerissen, noch spürte man die Gegenwart des Todes, des Hungers, der Verlorenheit des einzelnen zwischen Himmel und Erde. Noch war die Struktur der neuen oder alten Gesellschaft nicht etabliert, die sozialen Elemente waren gefährlich mobil, und die Vier in einem Jeep erinnerten deutlich daran, daß auch in politischer Hinsicht die Lage noch keineswegs geklärt war.
So viel damals vom „unbehausten Menschen“' gesprochen wurde, heute sieht es aus, als wäre damals der einzelne in seiner geistigen Umwelt, im Kontakt mit den Mitstrebenden, mit den Kollegen, mit zahllosen Gesprächspartnern, die jederzeit zu stundenlangen Debatten bereit waren, weit mehr „behaust“ gewesen als in unseren Tagen, in denen so manche Schriftsteller und Maler über komfortable Wohnungen, über eigene Häuser und elegante Autos verfügen. Damals stand man noch in einer Zeit vor den materiellen Versuchen — heute können wir schon Revue passieren lassen, was seither geschah; und so glänzend die jungen Autoren und Künstler sich in den Jahren der Not bewährten, so schwer fiel es einer erschreckend großen Anzahl, den Angeboten einer verlockend bequemen Bürgerlichkeit wenigstens maßvollen Widerstand entgegenzusetzen. Fast gleichzeitig mit der wirt-
schaftlichen Konjunktur, mit der angenehmen Behausung, mit dem Aufstieg in der Gesellschaft begann auch die Isolierung. Zwar kommt die Eröffnung einer Ausstellung, der Start eines neuen Buches heute ins Fernsehen, aber der Mann, der sie schuf, ist tiefer vereinsamt als anfangs der fünfziger Jahre, als vielleicht nur hundert oder auch nur zwanzig Leute von solch einem Ereignis erfuhren.
So hat auch das literarische Leben seit etwa zehn Jahren eine ganz andere Frequenz erhalten, als dies in den zwölf Jahren vorher der Fall war — eine Entwicklung, die übrigens nicht nur für Österreich zutrifft. Man braucht nur an das Paris und Frankreich der Nachkriegszeit zu denken, als Sartre, Gabriel Marcel und Mauriac noch die Gemüter erregten, als leidenschaftliche Polemiken zwischen verschiedenen Gruppen zu einer besonderen Dramatik des literarischen, kulturellen und auch politischen Lebens führten. In der deutschen Bundesrepublik spielten die Theater Wolfgang Bordiert, die ersten Romane von Heinrich Boll gingen von Hand zu Hand. Auch in England und Amerika schien eine neue kulturelle Epoche zu beginnen, und sie begann tatsächlich — und erlosch im Wohlstand des etablierten neuen Bürgertums. Natürlich gab und gibt es weiterhin gute Schriftsteller, interessante Maler, immer wieder erscheinen wesentliche Bücher, nur fehlt es an jener verdichteten Stimmung des literarischen und kulturellen Lebens, die tiefwirkende Zündungen ermöglicht Natürlich ist es sinnlos,
vergangenen Situationen nachzutrauern, vor allem, weil diese Situationen mit höchst bedrückenden Verhältnissen für die ganze Bevölkerung verbunden waren. Kann man der Welt Armut und Not wünschen, nur weil in einer solchen Welt das Schöpferische der Kultur vielleicht ein besseres Klima vorfindet? Kann man den schöpferischen Talenten eine Art Zwangsaskese wünschen, nur damit sie den Versuchungen des Wohlstands nicht erliegen?
Wir haben eine solche, freilich unfreiwillige Lage in manchen Nachbarstaaten zu beobachten: In der wirtschaftlich viel schlechter stehenden CSSR etwa herrscht heute eine kulturelle Intensität, um die so ziemlich alle Länder des Westens sie beneiden könnten. Dort gibt es, wie einst auch bei uns, noch diesen Zusammenhalt der Schriftsteller, Künstler, der Intellektuellen, dort ist tatsächlich der Kaffeehaustisch, die Hinterstube noch wichtiger und wahrscheinlich auf die Dauer sogar einflußreicher als sämtliche offiziellen Massenmedien zusammengenommen. Allerdings, der Preis schmerzt: er besteht aus spärlichem Warenangebot, politischen Unannehmlichkeiten und sonstigen, höchst störenden Begleiterscheinungen des Alltags. Wer aber einen Begriff vom literarischen Leben, wie es nach dem zweiten Weltkrieg im Westen aussah, gewinnen will, kann sich — gewiß mit erheblichen Varianten — heute noch in Prag davon eine ungefähre Vorstellung machen.
Von uns aus gesehen wirkt das freilich anachronistisch, denn irgendwann einmal wird auch den Volksdemokratien ein gewisser Wohlstand ins Haus stehen, und dann werden wir feststellen, daß wir schon einige Erfahrungen hinter uns haben, die man dort eben erst zu machen beginnt. Denn der Wohlstand der technifizierten Welt ist eines der Fakten, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben — er ist nicht ohne Schattenseiten. Auch die neue Tatsache der Weltkommunikation schuf ein anderes Klima für die Kultur: denn wo immer man sich heute befindet, man befindet sich gleichzeitig beinahe überall.
Das Fernsehen, der Rundfunk, die Düsenflugzeuge, die zahlreichen internationalen aktuellen Zeitschriften konfrontieren den einzelnen und gerade den schöpferischen Menschen, der ja durch eine besondere Sensibilität gekennzeichnet ist, praktisch in jedem Augenblick mit der Realität der ganzen Welt, auch wenn der einzelne Schriftsteller vielleicht keinen Fernsehapparat besitzt, und wenn er es verschmäht, „Spiegel“ oder „Time“ zu lesen. Diese Realität dringt durch die Fugen seiner Tür ein, auch wenn er sie verschließt. Zweifellos bedeutet das eine schwere Irritation, ein plötzliches Ausgesetztsein, dem gerade empfindliche Persönlichkeiten heute noch nicht gewachsen sind. Noch hat man es nicht gelernt, dieser Überfülle von Impulsen produktiv gegenüberzustehen. Der Schock der Kommunikation brachte viele zum Verstummen oder drängte sie in irgendwelche Fluchtwinkel, wo sie mit Routinearbeit erst einmal Zeit zu gewinnen suchen.
Der Weg geht freilich weiter dn diese neue Weltrealität hinein, ob sie dem Schriftsteller und Künstler behagt oder nicht, und in diesem neuen Unbehagen in der Gesellschaft, die sich auf größere als nationale ud sprachliche Dimensionen einstellt, könnte wieder eine gewisse kulturelle Chance liegen. Die Zeiten der Kaffeehausrunden sind endgültig vorbei, zumindest kann man sich von solchen Runden keine Erneuerung mehr erwarten. Die Literatur und die Kultur überhaupt kann sich nur in einer weiteren Dimension konstituieren. Das literarische Leben wird ohne Fernsehen und Düsenflugzeug nicht mehr auskommen, und es gilt eben, diese Elemente so aufzunehmen, daß in unserer augenblicklichen Periode der Isolation des einzelnen eine neue Art von literarischem und kulturellem Leben möglich wird: zwischen Wien und London, zwischen Wien und Paris, Wien und Prag, Wien und Moskau, Wien und New York. Das ist ein schweres, aber unvermeidbares Beginnen. Ein nur scheinbar komfortables, in Wirklichkeit aber sehr unbequemes Zeitalter des notwendigen Reisens, des Sichinformierens, einer anstrengenden Kommunikation, die zu beherrschen gelernt sein will, bricht an, eine neue ud freiwillige „Unbehaustheit“ könnte an der Schwelle einer neuen kulturellen Entfaltung stehen.
Freuen wir uns ruhig über die Romane der jüngsten Zeit, über Thomas Bernhards „Verstörung“ (verrät nicht schon der Titel die Grundstimmung unserer Jahre?), über Gerhard Fritsch' „Fasching“, über Peter von Tramins „Die Tür im Fenster“ oder Peter Marginters „Der tote Onkel“, über die Erzählung von Peter Handke, um jetzt nur von Autoren der jüngeren und mittleren Generation zu sprechen. Sie alle und viele andere arbeiten eben jetzt an neuen Büchern, Herbert Zand (Wien), Fritz Habeck (Wien), Elias Canetti (London), Johannes Urzidil (New York), Manes Sperber (Paris), Ingeborg Bachmann (Rom), Peter Handke (Düsseldorf), Franz Turnier (West-Berlin). Dies nur einige wenige Namen, und sie zeigen schon, daß sich die österreichische Literatur längst nicht mehr nur innerhalb der Grenzen Österreichs abspielt. Werden wir imstande sein, in diesem von ganz neuer Mobilität gekennzeichneten Zeitalter zumindest eine Art Heimathafen zu bilden? Wird Österreich sich intensiv genug darum bemühen, diesen Heimathafen im geistigen Sinn stets offen und einladend zu halten? Das wird vor allem von jenen abhängen, die hier an Ort und Stelle für das kulturelle Leben verantwortlich sind. Gelingt dies nämlich nicht, dann werden wir zu einem bloßen Nachwuchsland von Talenten, die früh in alle Welt ausschwärmen und dort zwar nicht für die Kultur, aber für Österreich verlorengehen.


































































































