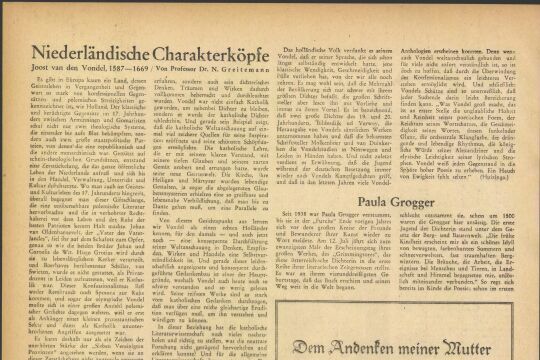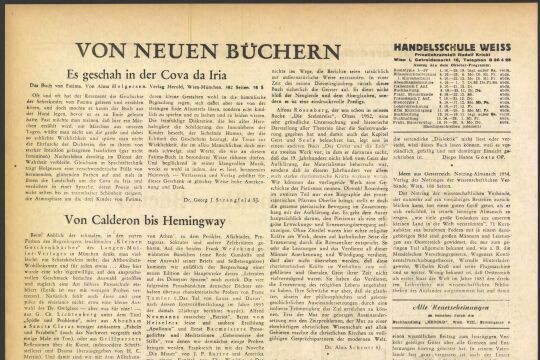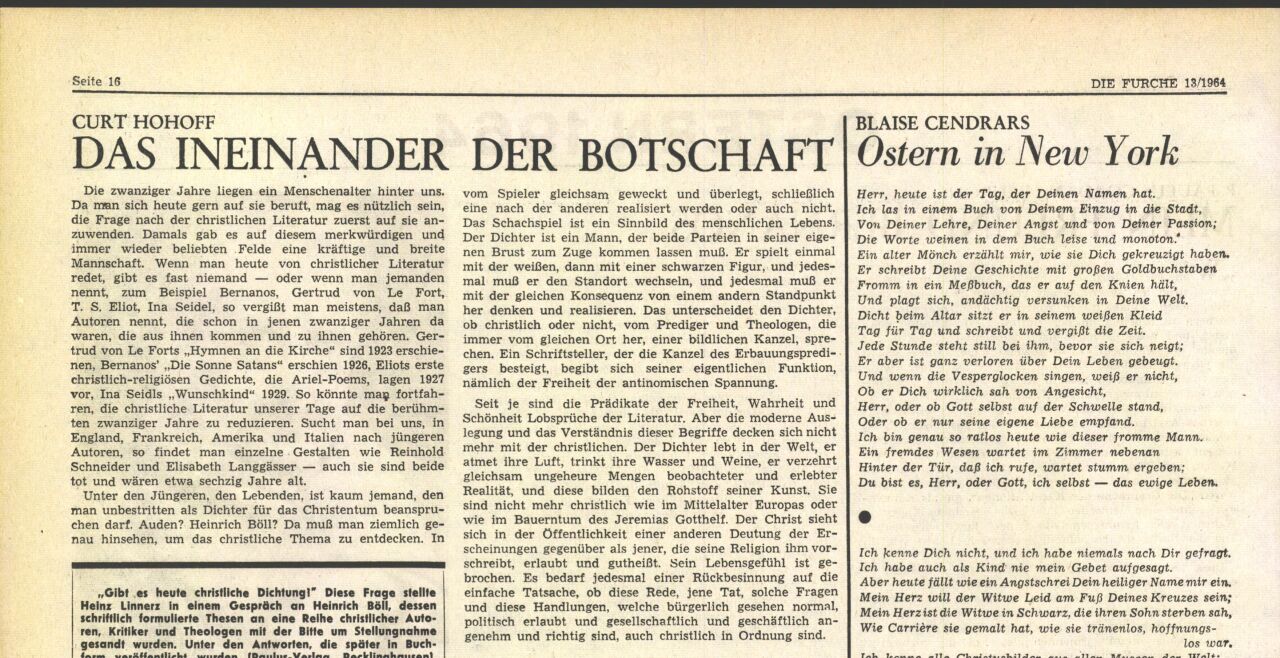
Die zwanziger Jahre liegen ein Menschenalter hinter uns. Da man sich heute gern auf sie beruft, mag es nützlich sein, die Frage nach der christlichen Literatur zuerst auf sie anzuwenden. Damals gab es auf diesem merkwürdigen und immer wieder beliebten Felde eine kräftige und breite Mannschaft. Wenn man heute von christlicher Literatur redet, gibt es fast niemand — oder wenn man jemanden nennt, zum Beispiel Bernanos, Gertrud von Le Fort, T. S. Eliot, Ina Seidel, so vergißt man meistens, daß man Autoren nennt, die schon in jenen zwanziger Jahren da waren, die aus ihnen kommen und zu ihnen gehören. Gertrud von Le Forts „Hymnen an die Kirche“ sind 1923 erschienen, Bernanos' „Die Sonne Satans“ erschien 1926, Eliots erste christlich-religiösen Gedichte, die Ariel-Poems, lagen 1927 vor, Ina Seidls „Wunschkind“ 1929. So könnte man fortfahren, die christliche Literatur unserer Tage auf die berühmten zwanziger Jahre zu reduzieren. Sucht man bei uns, in England, Frankreich, Amerika und Italien nach jüngeren Autoren, so findet man einzelne Gestalten wie Reinhold Schneider und Elisabeth Langgässer — auch sie sind beide tot und wären etwa sechzig Jahre alt.
Unter den Jüngeren, den Lebenden, ist kaum jemand, den man unbestritten als Dichter für das Christentum beanspruchen darf. Auden? Heinrich Boll? Da muß man ziemlich genau hinsehen, um das christliche Thema zu entdecken. In
den zwanziger Jahren könnte man eine starke Equipe aufführen, ich nenne Namen, die manchem Leser noch gegenwärtig sind: Enrica von Handel-Mazetti, Ruth Schaumann, Heinrich Federer, Peter Dörfler, Reinhard Sorge, Jakob Kneipp, Heinrich Wolfgang Seidel, Hugo und Emmy Ball, Richard Billinger, Karl Borromäus Heinrich, Anton und Friedrich Schnack, Max Meli, die niederdeutsch-plattdeutsch schreibenden Karl Wagenfeld und Augustin Wibbelt, Rudolf Alexander Schröder, Konrad Weiss, Joseph Wittig. Manche von ihnen leben noch, schreiben noch, erfreuen unsere Leser durch neue Werke und spiegeln dadurch Bestehen, ja Blühen einer christlichen Literatur auch im Jahre 1963 vor — obwohl es eine solche nicht mehr gibt und in dieser Form nicht mehr geben wird. Die Tatsache stimmt manche Leute traurig; sie flüchten in kühne Behauptungen wie die, das Publikum interessiere sich nicht, die Verleger widmeten ihre Initiative anderen Gebieten, obwohl beides nicht stimmt-Ich glaube, selten hat das Publikum so sehr nach christlicher Literatur gefragt wie heute, und die Verleger raufen sich um jeden Autor, bei dem die geringste Hoffnung, der Verdacht besteht, er könne einmal der Dante oder Manzoni des zwanzigsten Jahrhunderts werden. Sie täuschen sich immer wieder, denn abgesehen davon, daß Dante und Manzoni Genies waren, die vom Himmel fallen, wäre in unserem Jahrhundert ein Dante kaum möglich, weil die Welt nicht mehr christlich ist Sie könnte ihn geistig und geistlich nicht ernähren.
Gemessen an der ungleich breiteren und effektvolleren Streuung der religiös gleichgültigen Literatur der zwanziger Jahre wirkten freilieh auch jene sogenannten Autoren als kleine Schar. Wo ihr Christentum intensiv wurde, nahm es heftig sektiererische Züge an, wie bei Joseph Wittig, dem späteren Sorge und bei Hugo Ball. Schon damals konnte die Integration des Christlichen mit der Welt nicht recht geleistet werden. Es ist bezeichnend, daß viele jener Autoren aus sozialen Randzonen kamen. Federer, Dörfler, Kneipp waren Bauerndichter, sie lebten aus damals ungebrochenen christlichen Überlieferungen, die seit dreißig Jahren geschwunden sind.
• Nun hat das Thema von der christlichen Literatur seine besonderen Schwierigkeiten. Sie stecken schon in der Koppelung der Begriffe christlich und Literatur. Man kann Christ sein, und man kann Autor sein, so wie man Christ und Schneidermeister sein kann. Man kann auch Autor sein und Schneidermeister sein. Aber ein christlicher Schneidermeister — das ist doch ein Begriff, der einen stutzig macht und so ist es. denkt man darüber nach, mit dem christlichen Schriftsteller Er ist schwer zu definieren. Zwar wissen wir von Fall zu Fall genau, wer ein christlicher Autor ist, zum Beispiel Claudel — aber was macht das Christliche in Verbindung mit der Autorschaft aus? Früher schien es einfach zu sein. Wer einen Roman über Geistliche schrieb, wie Felix Timmermanns, konnte mit dem Prädikat der Christlichkerl rechnen. Ebenso ging es Autoren, die fromm oder erbaulich schrieben. Nun ist es so, daß Frömmigkeit und Erbaulichkeit hohe christliche Werte sind und jedes Subjekt adeln, das sie hat; aber für einen Autor sind gerade diese hohen christlichen Tugenden als Autor — von Nachteim Frömmigkeit und Erbauung stehen im Christentum ganz oben auf der Skala der Werte, ihr Wert ist beträchtlich größer als der der Literatur, denn sie führen den Menschen zur Heiligkeit, ins Paradies, in die Gesellschaft Christi. Die Literatur kann das alles nicht' — und doch ist eine erbauliche und fromme Literatur in den meisten Fällen eine schlechte, eine Literatur minderen Ranges.
Ein anglikanischer Bischof hat das hier erörterte Problem mit dem Schachspiel zu erläutern versucht. Man spielt bekanntlich auf schwarz-weiß gemusterten Brettern. Erst zieht Schwarz, dann Weiß, sie wechsein. Es wäre sinnlos, wenn man bloß mit schwarzen oder bloß mit weißen Figuren spielen wollte. Zwischen Weiß und Schwarz herrscht Rivalität und Spannung, darum hat das Schachspiel einen symbolischen Charakter für die Politik und das menschliche Leben. Aber die Regeln des Spiels erlauben, hat man den Gegensatz von Schwarz und Weiß angenommen, eine Fülle von Möglichkeiten, die in jedem Zug verborgen sind und
vom Spieler gleichsam geweckt und überlegt, schließlich eine nach der anderen realisiert werden oder auch nicht. Das Schachspiel ist ein Sinnbild des menschlichen Lebens. Der Dichter ist ein Mann, der beide Parteien in seiner eigenen Brust zum Zuge kommen lassen muß. Er spielt einmal mit der weißen, dann mit einer schwarzen Figur, und jedesmal muß er den Standort wechseln, und jedesmal muß er mit der gleichen Konsequenz von einem andern Standpunkt her denken und realisieren. Das unterscheidet den Dichter, ob christlich oder nicht, vom Prediger und Theologen, die immer vom gleichen Ort her, einer bildlichen Kanzel, sprechen. Ein Schriftsteller, der die Kanzel des Erbauungspredigers besteigt, begibt sich seiner eigentlichen Funktion, nämlich der Freiheit der antinomischen Spannung.
Seit je sind die Prädikate der Freiheit, Wahrheit und Schönheit Lobsprüche der Literatur. Aber die moderne Auslegung und das Verständnis dieser Begriffe decken sich nicht mehr mit der christlichen. Der Dichter lebt in der Welt, er atmet ihre Luft, trinkt ihre Wasser und Weine, er verzehrt gleichsam ungeheure Mengen beobachteter und erlebter Realität, und diese bilden den Rohstoff seiner Kunst. Sie sind nicht mehr christlich wie im Mittelalter Europas oder wie im Bauerntum des Jeremias Gotthelf. Der Christ sieht sich in der Öffentlichkeit einer anderen Deutung der Erscheinungen gegenüber als jener, die seine Religion ihm vorschreibt, erlaubt und gutheißt. Sein Lebensgefühl ist gebrochen. Es bedarf jedesmal einer Rückbesinnung auf die einfache Tatsache, ob diese Rede, jene Tat, solche Fragen und diese Handlungen, welche bürgerlich gesehen normal, politisch erlaubt und gesellschaftlich und geschäftlich angenehm und richtig sind, auch christlich in Ordnung sind.
Das Leben hat für den modernen Christen zwei Brennpunkte. Der eine ist die Umwelt mit ihren Werten, der andere die Religion. Der Konflikt zwischen weltlicher und religiöser Forderung ist so groß, wie er wahrscheinlich nur in den Zeiten des Urchristentums war: der Christ ist der isolierte einzelne in einer weitgehend entchristlichten Welt. Hier, scheint es, eröffne sich dem Autor eine Chance. Könnte er nicht zwischen den schwarzen und weißen Feldern hin und her seine Figuren ziehen und dabei eine bedeutende Technik entwickeln? Das Sonderbare ist, daß es nicht geht! Die Spannung ist weit, die Figuren müssen den Spielregeln folgen. Der Sprung gelingt nicht oder er wird durch unkünstlerische Mittel vollbracht, durch die Predigt, den Aufsatz, die Belehrung. Die Romane Elisabeth Langgässers sind dafür großartig negative Beispiele, und was Reinhold Schneider in seinen letzten Büchern, „Verhüllter Tag“, „Der Balkon“ und „Winter in Wien“ beschrieb, ist die Verzweiflung des christlichen Schriftstellers an der modernen Welt, die nicht mehr in seine Kategorie zu passen scheint.
Unser Leben wird von einer Fülle geistiger und materieller Güter überschwemmt so sehr, daß die Mehrheit der Zeitgenossen auch im privaten und häuslichen Bereich längst die Übersicht verloren habt. Es sind Güter, die ihren Sinn in sich selber tragen, vor allem die materiellen, aber auch das Vitale, das Triebhafte, der momentane Reiz gehören dazu. Die Religion gehört auch dazu — aber sie steht für den Zeitgenossen nicht mehr über und hinter den Phänomenen, sondern neben ihnen. Sie hat eine gewisse Beliebigkeit; der unerhörte Anspruch wird abgewehrt...
Der Schriftsteller kann sich seine Welt nicht aus den Fingern saugen. Er ist auf Substrate angewiesen, und so wie man von einem Eskimo nicht verlangen darf, daß er die Schönheit einer tropischen Insel beschreibt, darf man vom modernen Autor nicht verlangen, daß er eine Welt christlich artikuliert, die das Christliche nicht mehr hat oder kennt. Solange das Christliche im Klima der lauen, indifferenten Toleranz nur als eines unter vielen möglichen Themen gilt, besteht keine Aussicht, daß das Christentum eine verbindliche Literatur hervorbringt, eine Literatur, die nicht für den innerchristlichen Gebrauch bestimmt ist — die gab und gibt es auf bescheidener Basis immer —, sondern nach außen strahlt kraft eines Glanzes aus der Fülle höherer Wahrheit und Schönheit. Ich sagte schon, vielleicht vertragen sich Literatur und Christlichkeit grundsätzlich schlecht. Vielleicht sind die großen Autoren des Christentums, von Notker bis Hopkins, immer Ausnahmen gewesen, Dichter des Trotzdem und der Paradoxie. Das war Kierkegaards Meinung. Der große Däne war freilich angesteckt von romantischem Pessimismus und schwärmte für extreme Fälle. Der Pluralismus bietet dem Dichter eine neue Gelegenheit: das Christliche als Wert unter Werten; und wie es beim Schachspiel in äußerster Situation einen Zug gibt, wo man den Bauer mit der Königin tauschen kann, so kann es hier ergehen, denn der Horizont ist vollkommen offen. •
Zu Anfang unseres Jahrhunderts hat Karl Muth gefordert, die christliche Literatur — er meinte damals vor allem die sogenannte katholische Belletristik — müsse aus dem Getto heraus, in das sie sich habe hineinmanövrieren lassen. Ähnliche Bestreben gab es in anderen Ländern, und die Folge war der unerhörte Aufschwung in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg, übrigens in Verbindung mit einem allgemeinen Aufschwung, den wir literarisch gewöhnlich als Expressionismus bezeichnen. Religiös gesprochen, handelte es sich um die Wiedergeburt der Metaphysik. Das metaphysische Thema ist die Chance des christlichen Schriftstellers. Damit meine ich nicht den sogenannten theologischen Roman, welcher ja mehr stofflich-thematisch bestimmt wird, sondern die Darstellung von Menschen und Konstellationen, die nicht nur den Gütern der Erde offen sind, sondern auch denen der höheren Welt. So wie das Christentum selbst die Religion der Inkarnation, der Menschwerdung des Göttlichen ist, muß die christliche Literatur die materielle Grenze der Existenz überschreiten und den Zusammenhang, das Ineinander der Botschaft der Erde mit d<r des Himmels zeigen. Sie darf weder die Erde verketzern noch — wie die Predigt und das Gebet — die Priorität des Himmels anrufen. Ihr Gebiet ist ein Schachbrett mit weißen und schwarzen Feldern, und der Dichter muß nicht nur die Spielregeln kennen, sondern den Sieg seines Königs als den Sieg der absoluten Gerechtigkeit darzustellen wissen.