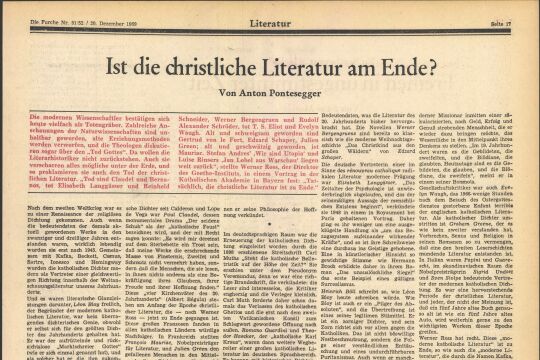Die heile Welt, das hat Vernunft allseits begriffen, ist ein ausgeträumter Traum. Doch nicht alles Gegenwärtige erscheint ruiniert. Nur zieht sich, wer nach Orientierung sucht, leicht die Geringschätzung jener zu, die sich für die einzigen Vertreter des Neuerungsgeistes in der modernen Welt halten. Wer sich aber im Vergleichen mit dem Gestern und Vorgestern übt, neigt weniger zu Überschätzungen. Es gibt literarische Bestrebungen und Entwicklungen in aller Welt, die auf Veränderungen des menschlichen Lebens und auf bestimmte Erscheinungen innerhalb der christlich-abendländischen Kultur reagieren. Es gibt „Neuen Realismus“, „Sozialen Realismus“, „nouveau roman“, „Lautpoesie“, „Absurdes Theater“, alles Begriffe, Schlagworte für Bewegungen, die bestehen. Es heißt sich offen halten für das, was von der Welt, in der wir leben, literarisch gesagt werden kann. Und gesagt wird.
Aus der Verbindung älterer und moderner Elemente ging die klassische oder traditionelle Literatur hervor. Ihr steht die neue, experimentelle Literatur gegenüber. Auf Begriffe abgezogen lauten die beiden Gruppierungen: Klassik, Tradition, Evolution oder Experiment, Avantgarde, Revolution. Drei Vormittage lang suchten in einer Großveranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Literatur im Palais Palffy unter der Leitung von Dr. Wolfgang Kraus 22 Teilnehmer aus elf Staaten Antworten auf die Fragen: Klassik (Tradition) und (oder) Avantgarde (Revolution)? Avantgarde — neuer Snobismus oder produktive Besinnung? Und: Wie soll es weitergehen? Es mühten sich Romanciers, Dichter, Kritiker, Germanisten aus West und Ost, ihre einander widersprechenden Gedanken zu einem Gespräch zu formen. Neun Stunden, vollgepfropft mit längeren und kürzeren Referaten, denen man mit trainierter Konzentration zuhörte, um die Richtigkeit und Nützlichkeit des Gelesenen zu beurteilen und dann mit mehr oder minder zwingender Eloquenz vorzubringen, was alles den kritischen Sinn beleidigt hat.
Schon die ersten Referate zeigten, wie man Klassik und Avantgarde gegeneinander setzen kann und welch schwierige Situationen daraus entstehen. Der ungarische Lyriker und Erzähler Istvan örkeny wies auf die paradoxe Entwicklung der künstlerischen Avantgarde in Ungarn hin. Vor dem zweiten Weltkrieg als „linfcsradikale“ Bewegung unterdrückt, war sie unter dem neuen Regime lange Zeit als „bürgerlichdekadent“ verbannt, bis das „Tauwetter“ die Vorurteile zum Schwinden brachte. Nun müsse man sich wieder anstrengen zu beweisen, daß die modernen Strömungen „etwas Neues, Richtiges und Wichtiges“ seien. Unlösbar bleibe dabei, wie man die avantgardistische Kunst einem größeren Publikum näherbringen könnte. Originell gelang örkeny in Art von Sprichwörtern die Charakterisierung der Gegensätzlichkeit von Klassik und Avantgarde sowie deren Einfluß auf die menschliche Haltung. „Klassische Literatur ist ein Aussagesatz. Sie schafft Harmonie, Ordnung, Ruhe. Avantgarde ist ein Fragesatz. Sie erregt Unruhe bis zur Schockwirkung. Klassik informiert. Avantgarde leugnet Information oder beschränkt sie auf ein Mindestmaß. Der Leser der Klassik war passiv. Unsere Leser sind aktiv oder sollten es sein. Sie verbrauchen hohe psychische Energie, weil die Avantgarde zur Selbständigkeit zwingt, einen Umbau des Denkens verursacht.“ Das Dilemma: „Die Menschheit hat die Schwelle der emotionellen Abstumpfung erreicht. Zur selben Zeit, in der die Kunst ihre neuen Aufgaben und Möglichkeiten findet, verliert der Leser die Fähigkeit, das Neue aufzunehmen.“
Mit ironischer Sachlichkeit analysierte der englische Essayist und Kritiker PTiilip Toynbee den Begriff Avantgarde. Ursprünglich ein militärischer Terminus, verkörpere die Avantgarde eine schreibende oder malende Vorhut, die, wenn die Haupttruppe nachgerückt ist, aufhöre, Avantgarde zu sein. Diese „notwendigerweise mißverstandene und mißbrauchte Minderheit“ leide „unter einem großen, schrillen Selbstbewußtsein“, einer „Überbeschäftigung mit methodologischen Experimenten'“, wobei sie in ihrer üblichen, wenig bescheidenen Haltung anderen gegenüber voll „ärgerlicher Verachtung“, gegenüber eigenen Mitgliedern aber voll „unendlicher Nachsicht“ sei. Es habe zweimal in den letzten 150 Jahren der europäischen Literatur und Kunst eine echte, eine klassische Avantgarde, wahre „Großtaten des Selbstbewußtseins“, gegeben: die Romantik und die große Avantgarde (beginnend mit dem Expressionismus) von 1910 bis 1930. Alle diese Künstler, Schriftsteller und Komponisten der damaligen „Moderne“ waren sich der Notwendigkeit bewußt, neue Ausdrucksformen zu finden. Die letzte ernstzunehmende Avantgarde begann mit der Aufführung von Becketts „Warten auf Godot“. Zu ihr gehören unter anderem auch der „nouveau roman“ um Robbe-Grillet. Von Grund auf anzuzweifeln sei die „Theorie einer permanenten Avantgarde“. Müssen wir denn, fragte Toynbee, rastlos auf der Suche nach Neuem sein, nur weil es in der Vergangenheit Perioden gegeben hat, in denen Neues brennend gesucht worden war? Nützen wir lieber die auf uns gekommenen Ausdrucksmittel voll aus, da es gilt, wirkliche Taten zu setzen „im endlosen Kampf der Ordnung gegen das Chaos, des Ausdruckswillens gegen das Unaussprechliche.“
Claude Simon, bedeutender Romancier aus der Bewegung des „nouveau roman“, begann seine in klassischem Französisch vorgebrachte weitgespannte Betrachtung mit der lapidaren Feststellung: „Sowenig es eine wissenschaftliche Avantgarde oder gar eine wissenschaftliche Revolution gibt, sowenig gibt es eine avarutgardische Kunst oder Literatur.“ Wer da behaupte, die „Entdeckungen der Vorhut“, der Avantgarde, würden von den Nachkommenden ausgewertet, vergesse, ,daß die Kunst (Roman, Dichtung, Musik, bildende Kunst) gar nichts anderes als Entdeckung, Erfindung, Schöpfung, Produktion sein kann. — Jedes Werk, das Geistiges in sich einschließt, stellt den Versuch der Beschwörung dar, des Besitzergreifens und der Verwandlung von Natur und Welt durch Neuschöpfung in der Sprache.“ Aber ein neuer Gedanke lasse sich nicht in tote Formen gießen. „Der sowjetische Dichter Majakowski sagte, daß es ohne revolutionäre Formen keine revolutionäre Kunst gebe, womit er freilich nur das alte Gleichnis der Heiligen Schrift abwandelte: ,Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst sprengt der neue Wein die Schläuche und alles ist verdorben, sowohl der Wein wie auch die Schläuche.'“ Man verwechsle allzu oft Tradition mit Traditionen, Gebräuche, die nur Wiederholungen von Formen sind. Tradition dagegen ist dynamisch, sie ist, wie der Philosoph Kostas Axelos schrieb, „zugleich Vorgriff und Rückgriff, Eroberung und Bewahrung“. Die Rückkehr zu den Quellen 'der Tradition kann nie eine bloße Wiederholung sein, sondern produktive Wiederaufnahme, „weil die Vergangenheit nur selten — wenn überhaupt — ein überholter Seinszustand ist“. „Unsere Existenz ist eine Funktion unserer Vergangenheit, der Tradition, die uns geformt hat (für die westliche Welt ist dies die Gesamtheit der sie befruchtenden jüdisch-christlichen, griechischrömischen und kartesianisch-marxistischen Traditionen: Gott, die Physis, der Mensch afi Subjekt), aus der alle unsere Handlungen hervorgehen, sogar — und vielleicht gerade dann — wenn sie ihre Herkunft verleugnen.“ „Vor rund 60 Jahren, da Marx, Nietzsche, Freud, Einstein die Welt mit ihren revolutionären Gedanken erschütterten, haben Dosto-jewskij, Joyce, Proust, Kafka, Cezanne und Van Gogh die Literatur und die Malerei revolutioniert, aber keiner von ihnen kann mit seinem Werk verstanden werden ohne das,was ihnen vorangegangen und mit ihnen gleichzeitig war. ebenso wie das, was nach ihnen kam, ohne sie nicht verstanden werden kann!“
Ebenso vielen Mißverständnissen unterliege der Begriff: Revolution. Begreife man darunter „eine einfache Wandlung in den politisch-wirtschaftlichen Strukturen“, dann habe die Literatur damit offenbar nichts zu tun. Denn „bei unseren immer wieder erneuerten Versuchen, die Welt zu erfassen, wirken alle geistigen Kräfte zusammen und entsprechen sich in einer Weise, daß sie nicht voneinander getrennt werden können: sei es nun Literatur, bildende Kunst, Musik, Philosophie, Wissenschaft oder Politik. Alles ist zugleich befruchtet und zeugend“. Simon zeigte an einprägsamen Beispielen die Verbindung zwischen zeitgeschichtlichem Hintergrund und der Kunst auf, analysierte die Beziehung der Sprache zur Wirklichkeit, fixierte (den revolutionären Charakter eines Stendhal oder Balzac — auch für uns heutige noch — hervorhebend) Wesen und Stellung des Romans inmitten der wachsenden wissenschaftlichen Erkenntnisse. Immer Wieder zitierte er ausführlich Marx, wobei ihm seine eigenwillige, „allzu individuelle“ Auslegung in der Diskussion vorgeworfen wurde. Simons Referat fand stärkste Beachtung.
Richtig Anstoß erregte Herbert Eisenreich mit seiner im Stil eben nicht glücklichen Absage an die Avantgarde (Avantgarde — Epigonentum; „Hier begnügt man sich mit sentimentalem Schmus, dort mit intellektuellem Pflanz“, und Ärgeres). Walter Höllerer, Lyriker, Essayist und renommierter Literaturkenner, bekräftigte jedoch seinem Freund Eisenreich, daß dieser von einer richtigen These ausgehe, wenn er behauptet, es könne einem Schriftsteller völlig gleichgültig sein, ob er Klassiker oder Avantgardist ist. Man könne nur beider Elemente sinnvoll in sich vereinigen. Eisenreichs Stärke sei seine Sensibilität, er bemühe sich, einen Raum zu schaffen, in dem er schreiben könne. Beachtlich formulierte Eisenreich als sein Ziel: „Durch das Kunstwerk ein etwas deutlicheres und deutbareres Bild der Welt bekommen. — Die artistische Leistung ist erst dann komplett, wenn sie im Werk getilgt, unsichtbar gemacht ist. Dann erst hat man für alle geschrieben, auch für die Nichtfachleute. Über die Artistik hinaus gelangen zu einer zweiten Natürlichkeit, zu einer zweiten Unschuld, wie Kleists Marionetten.“
Nun war die Zeit für die russischen „Realisten“ gekommen. Dimitrij Satonsky, Germanist an der Universität Kiew, konziliant und umständlich ein gewähltes Deutsch sprechend, erhob den Vorwurf, die moderne westliche Literatur habe die große Tradition des Westens verlassen und bevorzuge eine pessimistische Haltung. Wenn Avantgarde die neue Kunst sei, könne er damit nichts anfangen. Für ihn sei der Realismus die Methode, um in der Kunst den Weg zum neuen Menschen zu bahnen, Probleme und Schwierigkeiten zu meistern. An das Chaotische dürfe und solle man sich nur wagen mit dem Gedanken, es au bewältigen. Allzu häufig finde man aber in der modernen westlichen Literatur ein Sichhingeiben an das Chaos. Bei Beckett, aber auch bei Camus finde sich ein Hang zum Asozialen. Der Schriftsteller dürfe keinesfalls vereinfachen, nur um besser verstanden zu werden. Aber es sei grundfalsch, sich ausschließlich an eine Minderheit, eine Elite zu wenden. Ein wenig indigniert wies Satonisky die Meinung Wystan Hugh Audens zurück, der gesaigt hatte, das Wort des Schriftstellers im Osten habe deshalb eine weit größere Wirkung, weil er sich (im Unterschied zum Schriftsteller im Westen) an „unfreie Menschen“ wende1.
Geschmeidiger und dialektischer formulierte Efüm Etkind, Essayist, Kritiker, Literaturhistoriker und Übersetzer aus Leningrad, ein liebenswürdiger Anreger der Tagung, seinen Standpunkt. Man könne von Ost und West weder von zwei Welten noch von zwei Kulturen sprechen, bloß die Terminologie sei verschieden. Im Osten verwende man den Begriff Avantgardismus nur in Anführungszeichen, mit einem Seitenblick auf westliche Kunst. Es sei ein schlechter Begriff. Gorki schrieb einmal an Pasternak: „Ich liebe sehr Ihre Dichtung, ich habe nur den Eindruck, daß bei Ihnen das Chaotische nicht immer durch das Harmonische geordnet wird.“ Pasternaks äußere klassische Form stand dem chaotischen Inhalt entgegen. Erst in seinen letzten Gedichten kam er zur klassischen Einfachheit und Harmonie. Harmonisierung des Chaotischen sei ein Merkmal klassischer Dichtung. Heute scheine das Chaotische der Welt ganz hervorgetreten zu sein und überschwemme die Kunst, was man dann oft als Avantgardismus bezeichne. Das Chaotische ist das Unverstandene. Nicht einen Kult des Unverstandenen gelte es anzustreben, sondern einen Weg zum Verstehen. Das aber sei die Aufgabe des Dichters, der neue Bedeutungen finden müsse.
Dem Russen Etkind gelang auch die eindrucksvollste Metapher für die Macht und Ohnmacht der Schreibenden. „Eine verbotene Stimme ist wie ein zerbrochenes Barometer. Aber der Sturm kommt trotzdem.“
Friedrich Heer hatte in seinem Schlußwort über das „freundliche Streitgespräch“ seine Betroffenheit über drei „Bekenntnisse“', wie er es nannte, ausgedrückt, die den abgesteckten Themenkreis kaum berührten. Der Schwede Olaf Lagerkrantz, Lyriker, Kritiker, Essayist und Chefredakteur der größten schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“, hatte in seiner ruhigen, stillen Art bekannt, daß das Christentum nicht mehr fähig sei, etwas auszusagen. Er gebrauchte dafür das Bild einer „leeren Muschel ohne Fleisch“. Selbst der Stephansdom sei heute nur noch „ein leeres Gehäuse“. In seltsamem Gegensatz zu der atheistisch-existen-tiellen Konfession des Schweden, bemerkte Heer, stand das christlich-existentielle Bekenntnis des Ungarn Jänos Pilin-sky. Ein Marxist ging die Frage an, welche Möglichkeiten die christliche Aussage heute noch habe. Von anderer Art war die schon in ihrer Zweisprachigkeit imponierende Deutung, die Andre Espiau de la Maestre der „Tradition und Revolution in der katholischen französischen Literatur: L. Bloy, P. Claudel, Oh. Peguy, G. Bernanos“ gab. Aus Peter Härtlings Konfession über sein Werk („Ich kenne keine Poetik der Revolution, nur eine des Widerstandes. — Wir wissen, wie man die Welt zerstört. Wir wissen nicht, wie diese Zerstörung ins Wort finden kann.“) sprach schmerzliche Trauer einer Generation nach 1945. „Bezeichnend“, bekannte Heer, „daß den dichtesten Aussagen im Wort zunächst einmal Schweigen entgegentrat. Vielleicht wird später einmal eine Resonanz durch das Wort wachgerufen.“
Die scharfsinnigen Kritiken galten anderen Zielen. Wolter Hutterer lehnte die Gegenüberstellung von Chaos und Harmonie ab. Das sei 'der Standpunkt des Iiteraturhistorikers, nicht des Autors. Was chaotisch scheint, könnte zuweilen der Vorbote einer neuen Ordnung der Sprache sein. Alle Begriffs-paare hätten sich als unzulänglich erwiesen, um Literatur zu charakterisieren, denn der Vorgang des Schreibens sei komplizierter. Der Schriftsteller müsse alles neu sehen, indem er den Stoff zwischen Vision und Wirklichkeit immer wieder Verwandlungen ausliefert. Literatur habe es nicht mit Dingen, sondern mit Bedeutungen zu tun. Durch das Spiel von Bedeutungen aber werde die Welt verändert.
Marcel Reich-Ranicki, dem auch das Schlußwort zufiel, hielt sich an seine These, daß es letztlich immer Aufgabe der Kunst sei: zu provozieren. Die große klassische Literatur habe nichts in Harmonie aufgelöst. Weder Shakespeare noch Goethe im „Faust“ noch Dostojewskij hätten das getan. Die Dichter können die Welt nicht verändern, aber sie können die Menschen dazu bringen, die Welt zu ertragen. Indem sie Einfluß auf die Psyche, das Bewußtsein der Menschen nehmen, verändern sie ein klein wenig das Bewußtsein und damit auch die Welt. „Die Schriftsteller können die Menschen nicht gut, aber doch ein wenig besser machen“, sagte Jean Paul. Die Schriftsteller können die Menschen nicht klug, aber doch ein wenig klüger machen.
Im Ergebnis blieben Differenzen Differenzen, Probleme Probleme. Die Meinungen über Tod, Hoffnung, Chaos, Ordnung waren nicht leicht auf einen Nenner zu bringen. Es gab so viele Antworten als Teilnehmer waren. Mißverständnisse schienen unlösbar, weil sie aus der „Zweideutigkeit“ der Sprache hervorgingen, die auch die Argumente zweideutig machte. Man schlug daher ein neues Gespräch über das Thema Sprache vor. Wir haben den Zauber der vox humana empfunden, sagte der Ungar. Wir sind Freunde geworden und bleiben es, sagte der Russe. Unwidersprochene Einigung erzielte nur die Metapher Etkinds vom Schriftsteller als dem Barometer, das den Sturm ankündigt. Die Warnung dieser Tagung an diejenigen, die Barometer zerschlagen wollen, war unüberhörfbar. Rumänen, Tschechen und der Grieche, die ihr Kommen angekündigt hatten, waren ausgeblieben. Und noch eine Erkenntnis stand am Ende wie eine Warnungstafel, die Reich-Ranicki aufgerichtet hatte: Daß ein Schriftsteller verloren ist, der zu schreiben versucht, als sei dieser Planet unibewohnt.