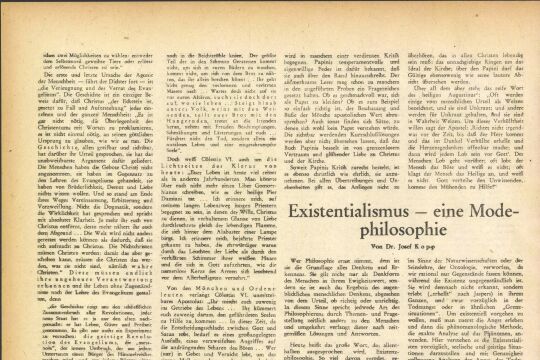Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ernste und heitere Plaudereien
LIPPENSTIFT UND HEILIGENSCHEIN. Vernünftige Briefe an Frauen und Mädchen von Maria-Regina Pisa. Styria-Verlag, Grai, 1966. 201 Seiten.
Die Autorin wählt die persönliche und zugleich legere Form des Briefes, um mit ihren Zeitgenossinnen über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen, ihnen Ratschläge zu geben, wie sie besser mit dem Leben in unserer Zeit fertig werden können.
Es gibt die Episteln über Praktische Fragen: Hausarbeit, Mode, Kosmetik. In diesen Bereichen kennt Frau Pisa sich aus, ist erfinderisch, glänzt mit originellen, anregenden Gedanken.
Problematischer sind die Briefe, in denen sie über menschliche Beziehungen, Erziehungs- und Berufsfragen sinniert. Hier schleichen sich — neben gescheiten, nützlichen Überlegungen und Erkenntnissen — gelegentlich Verallgemeinerungen und Vereinfachungen ein, die Leserinnen, die sich mit den angeschnittenen Fragen herumschlagen, eher deprimieren als ermutigen oder zum mindesten verwirren könnten.
„Es ist olles so erschütternd einfach. Gehen Sie die lange Liste der jugendlichen Kriminellen durch und zeigen Sie mir einen, der aus der Nestwärme einer liebenden, organisch funktionierenden Familie kommt. Er wäre geeignet für ein Panoptikum...“
Pardon, so einfach ist es nun doch nicht! Ich kenne einige junge Menschen, deren Elternhaus in Ordnung ist, und die doch auf Abwege geraten sind, wenn ich sie auch nicht gleich unter die Kriminellen einstufen würde.
Oder der Brief „Gleichberechtigt und trotzdem glücklich“. Darin steht der Satz, daß sich durch die Emanzipation der Frau „nichts geändert“ habe.
„Entscheidende Bedeutung haben Frauen nach wie vor an jenen Stellen, die sie als Frau ausfüllen: in den Händen der Chefsekretärin laufen die Fäden des Betriebes zusammen ... Bei ihr ist viel mehr Macht konzentriert als bei der wissenschaftlich hochqualifizierten Mitarbeiterin im Labor...“
Geändert hat sich aber immerhin, daß eine Frau heute den Posten einer Chefsekretärin einnehmen kann, weil ihr die Frauenbewegung ermöglicht hat, sich zu bilden und einen Beruf zu ergreifen. Die richtigen Beobachtungen und Folgerungen, die in demselben Brief stehen, werden durch solche temperamentvollen, aber nicht stichhaltigen Bemerkungen doch etwa beeinträchtigt.
Am besten sind die Briefe, in denen sich Frau Pisa mit dem religiösen Leben der modernen Frau auseinandersetzt. Hier spricht sie aus einer inneren Sicherheit und Geborgenheit, ohne je in die Ausdrucksweise des moralisierenden Traktats zu verfallen. Im Eingangsbrief steht der Satz: „Ich habe Gott und meine Religion zu Ihm.“ Das ist der Grund, auf dem die Autorin ihr Weltbild aufbaut. Diese Erfahrung bestimmt ihren Alltag, ihre Einstellung zum Mitmenschen und gegenüber den Fragen und Aufgaben, die ihr das Leben stellt. Dabei ist sie ganz und gar eine moderne Frau, aufgeschlossen für die Probleme unserer Zeit, und, was gewiß das Wichtigste ist, sie lebt im Einklang mit Gott und ihrer Umwelt.
Individualität abstrahieren, so daß also die Analogie, in Konsequenz dazu: die Geschichtlichkeit, ja die Individualität des Denkens nie ausgeklammert werden kann. Hier ließe sich der existentielle Ansatz heutiger Philosophien noch fruchtbarer entwickeln. Gerade bei den „Gottesbeweisen“ ist das in der Frage der individuellen Freiheit (der Certitudo libera, die dort gar nicht erwähnt wird und die wohl überhaupt am Anfang des Philosophierens eine größere Rolle spielt als gewöhnlich dargestellt wird) von großer Bedeutung. Auch die gerühmte Logik hat ihre „voluntaristischen Wurzeln“ (T.iebruck), was heute klar auf der Hand liegt. Schließlich scheint auch der Titel „christliche“ Philosophie problematisch (nicht zuletzt im Angesicht des Konzils und seiner Ausführungen über das Christliche). Nach eigenem Eingeständnis ist der Autor der griechisch-scholastischen Terminologie verpflichtet, also einer bestimmten Richtung katholischer Schulphilosophie. Wie steht es mit den anderen Christen und ihrer Philosophie? Und auch innerhalb dieser bestimmten Richtung gibt es verschiedene Schulen, von den verschiedenen Ergebnissen gar nicht zu reden (so haben zu Beispiel manche Kirchenväter die „von Natur aus“ unsterbliche Seele als heidnischen Irrtum abgelehnt).
Die beiden Richtungen eines existentialistischen Denkens und einer scholastischen Schulphilosophie stellt nun Hans Meyer in seinem Buch über Martin Heidegger und Thomas von Aquin gegenüber. In genauen Untersuchungen und sauberer Trennung führt er die verschiedenen Standpunkte in drei Kapiteln aus: Zur Seinsfrage, das Gottesproblem, der Mensch. Wohl sucht er nach möglichen Querverbindungen, findet auch teilweise Gemeinsamkeiten, aber Heidegger bleibt nach Meyer weit hinter Thomas zurück, was bei einer bloßen Gegenüberstellung zweier in sich charakteristischer Weltbilder kein Wunder ist. Thoms ist eben mittelalterlicher Denker, dem die Hierarchie der Ordnung des Kosmos mit Gott an der Spitze gegeben war. Heidegger jedoch ein
Philosoph des modernen, ins Bodenlose gehängten Daseins, der von seiner Fundamentalontologie her die Exitenz erst aufzubauen versucht. So ergeben sich zwei grundsätzlich verschiedene Ansatzpunkte, die man wohl kaum einander einfach gegenüberstellen kann. Auch kann man Heidegger und anderen Heutigen keinen Vorwurf machen, daß sie gleichsam beim Nichts beginnen. Ein solcher Vorwurf ließe sich, da es sieh ja um Philosophie handeln soll, leicht umkehren. Sicher ist es interessant, zu erfahren, „wie weit“ jeweils jeder kommt. Doch dieses „wie weit“ hat ganz verschiedene Akzente. Bei Thomas, wie weit er seine Weltanschauung reflex philosophisch rechtfertigt, bei Heidegger, wie weit er von unten her aufbaut, ob und inwieweit das möglich ist. Gerade in der Problematik um das Nichts spürt man, wie eine bloße Gegenüberstellung hilflos wirkt, wo man bei einem immanenten Nachdenken anders verfahren würde. Wenn Gabriel Marcel, wie wir hörten und wie er es in dem eben erschienenen Buch „Die Menschenwürde und ihr existentieller Grund“ nachdrücklich wiederholt, sein dramatisches Schaffen „vital beteiligt“ sein läßt an seinem Philosophieren („mein dramatisches Werk ergänzt in unauflösbarer Weise meine philosophischen Schriften“) und warum es nur so sein kann, so gibt es auch wesentliche Hinweise für Heideggers Beschäftigung mit der Dichtung, die sicherlich nicht einen Denkersatz darstellt, sondern nur in der Konsequenz seines Denk-versuches liegt. Trotz alledem wirkt eine solche Gegenüberstellung in ihrer klaren Durchführung, wie es Meyer vermag, ungemein erhellend und hat ihren unbestreitbaren Nutzen, gerade in der heute üblichen Begriffsverwirrung unter Philosophen auf Grund ihrer eigenen Terminologien.
Marcel selbst gesteht in dem genannten Werk, daß er sich nie in irgendeiner Weise zur thomistischen Form des Denkens bekehren ließ. In den hier wiedergegebenen neun Vorlesungen an der Harvard-Universität von 1961 zeichnet er Entstehen und Entwicklung seines Denkens, über das er sich rückblickend Rechenschaft ablegt. Nirgends wird der
ü 3 8 :i i 8 n ri ÜK32:
Unterschied der Denkansätze klarer. Was Marcel mit Intersubjektivität bezeichnet, was mit Blondel das denkende Denken im Gegensatz zum bloß gedachten Denken genannt wird, macht das deutlich. Denken bedeutet hier eine Berufung des Menschen und nicht, komplexe Unterscheidungen über seine Natur erarbeiten, die sich dann „in eine unendliche Regression auf sich und die Welt verlieren“, bedeutet metaphysische Unruhe des Suchens und Staunens auf Grund „authentischer“
Erfahrungen, keineswegs erborgter als zweifelhaften Ersatz; so verwandeln sich die Begriffe, von Problemen zu Geheimnissen, vom Sein zum Haben, von Passivität zu Empfänglichkeit, von Gegenwärtigkeit zu Anwesenheit, von Wahrheit zu Treue. Nur so ist ihm intellektuelle Redlichkeit möglich, da sein Denken nicht zu intellektuellen, unverbindlichen Spielen führt, sondern zu Sammlung und Meditation. Er unterschreibt, was ein Kritiker über ihn sagte: er sei nicht ein Zuschauer, der eine Welt von Strukturen sucht, die sich klar und deutlich sehen lassen, sondern eher jemand, der auf Stimmen und Anrufe horcht, welche die Symphonie des Seins bilden. Und das unternimmt Marcel im bewußten Gegenzug zur heutigen Zeit, die die Integrität des Menschen, seine Würde als Person, bedroht. Ihr ideologischer Rationalismus von links und rechts, der „orthodoxen Gleichschritt“ fordert, zerstört ihre eigenen Anliegen. Ihr Streben nach sozialer Gerechtigkeit zum Beispiel ist zweifelhafte Demagogie und Nivellierung zugunsten der Mittelmäßigkeit, denn die soziale Ideologie ist Flucht vor der nur aus der ganzen Personmitte vollziehbaren Liebe, ihr Gleichheitsideal daher nichts als eine Brüderlichkeit „als ob“, weil sie die Freiheit, aus der allein Liebe und Brüderlichkeit möglich sind, zerstört. Ein physischer Ekel erfaßt ihn, wenn er die riesigen, unpersönlichen „sozialen“ Wohnbauten sieht, in denen die „Individuen“ nicht mehr iftt hämanett 'Sinn „woHnen' sondern „untergebracht sind“. Bis in solche tagespolitischen Konsequenzen wirkt sich also dieses denkende Denken, welches das Sein zum Ort der Treue macht, aus. Marcel redet absolut nicht unklaren Sentimentalitäten das Wort, sondern zeigt, daß man von Situation und Individualität, von Intersubjektivität einfach nicht abstrahieren kann, ohne das Denken zu verfälschen. Wie gründlich und verantwortungsbewußt er vorgeht, zeigen diese neun Vorlesungen, in denen er den Beginn seines Denkens, die Enstehung seiner Werke, in den jeweiligen Situationen, seine Konversion (die kein Bruch, sondern ein Zu-Ende-Führen einer Haltung war) rückschauend überblickt und seinen Lesern und Hörern offen darlegt. Es gilt, das Denken nicht in subtilen Mechanismen ein bloß gedachtes sein zu lassen, sondern die Wahrheit denkend über die Sammlung ständig zu inkar-nieren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!