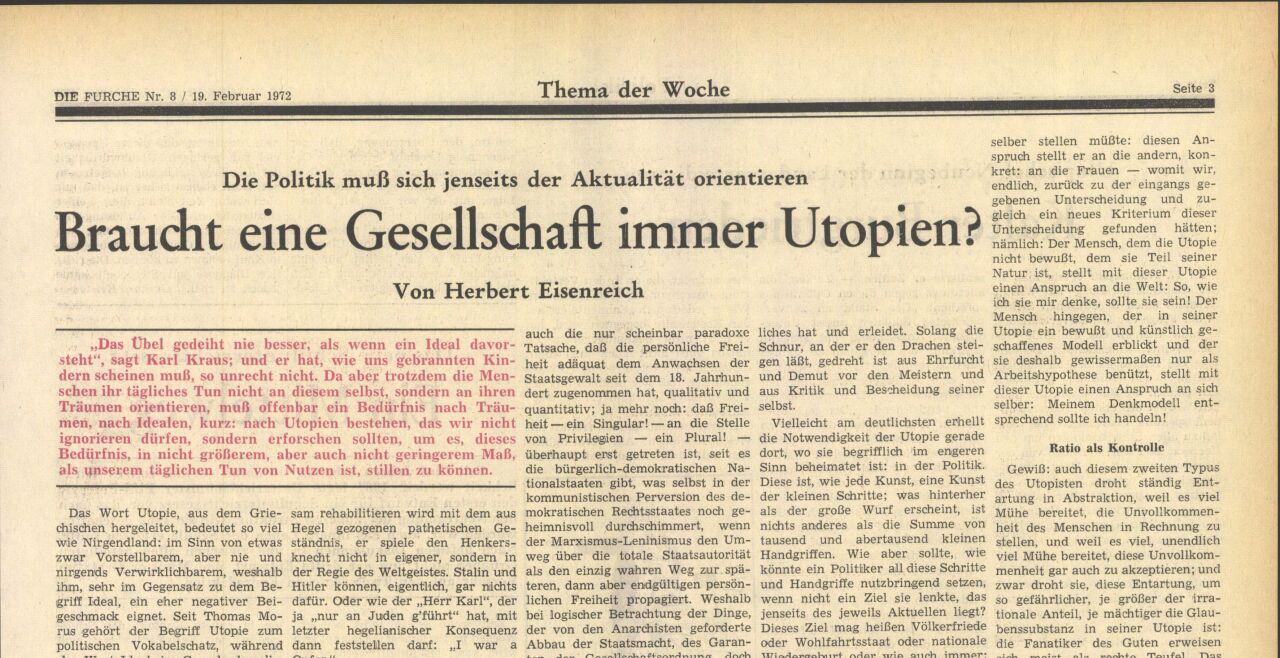
Braucht eine Gesellschaft immer Utopien?
„Das Übel gedeiht nie besser, als wenn ein Ideal davorsteht“, sagt Karl Kraus; und er hat, wie uns gebrannten Kindern scheinen muß, so unrecht nicht. Da aber trotzdem die Menschen ihr tägliches Tun nicht an diesem selbst, sondern an ihren Träumen orientieren, muß offenbar ein Bedürfnis nach Träumen, nach Idealen, kurz: nach Utopien bestehen, das wir nicht ignorieren dürfen, sondern erforschen sollten, um es, dieses Bedürfnis, in nicht größerem, aber auch nicht geringerem Maß, als unserem täglichen Tun von Nutzen ist, stillen zu können.
„Das Übel gedeiht nie besser, als wenn ein Ideal davorsteht“, sagt Karl Kraus; und er hat, wie uns gebrannten Kindern scheinen muß, so unrecht nicht. Da aber trotzdem die Menschen ihr tägliches Tun nicht an diesem selbst, sondern an ihren Träumen orientieren, muß offenbar ein Bedürfnis nach Träumen, nach Idealen, kurz: nach Utopien bestehen, das wir nicht ignorieren dürfen, sondern erforschen sollten, um es, dieses Bedürfnis, in nicht größerem, aber auch nicht geringerem Maß, als unserem täglichen Tun von Nutzen ist, stillen zu können.
Das Wort Utopie, aus dem Griechischen hergeleitet, bedeutet so viel wie Nirgendland: im Sinn von etwas zwar Vorstellbarem, aber nie und nirgends Verwirklichbarem, weshalb ihm, sehr im Gegensatz zu dem Begriff Ideal, ein eher negativer Beigeschmack eignet. Seit Thomas Morus gehört der Begriff Utopie zum politischen Vokabelschatz, während das Wort Ideal, im Grunde dasselbe meinend, einerseits als philosophischer Terminus und anderseits im populären Jargon gehandhabt wird. Wir gebrauchen hier „Utopie“ sowohl wertfrei als auch ohne die Ein-. schränkung auf das Politische.
Man unterscheidet zwei Arten von Utopie beziehungsweise zwei Arten von menschlichem Bewußtsein bezüglich des Utopischen. Es kann der Mensch nämlich einen gedachten Idealzustand entweder als notwendig kommend behaupten und deshalb herbeiführen wollen oder als praktisch unerreichbares, aber trotzdem unerläßliches Rieht- und Wertmaß all seines Denkens und Handelns vor Augen haben. In jene erste Kategorie der unbewußten, oder, wie ich lieber sagen möchte: der natürlichen Utopie, im Gegensatz zur künstlichen und eo ipso bewußten Utopie, in jene Kategorie also gehören alle der Ratio entbehrenden Glaubenssysteme, vom Tausendjährigen Reich des Chiliasmus bis zum Tausendjährigen Reich des Nationalsozialismus. Der Utopist dieser Sorte konstatiert (oder konstruiert) bestimmte Ursachen, die seiner Meinung nach ganz bestimmte Folgen zeitigen müssen: ein „Paradise now“ zum Beispiel oder den ewigen Frieden oder, bedeutendstes, weil gräßlichstes Beispiel, die klassenlose Gesellschaft. Man muß nur, damit diese Utopie zur Wirklichkeit werde, ein bisserl nachhelfen, notfalls auch mit dem Schlagring.
Utopie als „Weltgeist“
Dieses modernen utopistischen Unfuges Urahn ist zweifellos Hegel, der den wohl nur einem deutschen Denker zutraubaren Aberwitz hatte, sich als vom Weltgeist persönlich informierter Wegweiser in die historische Zukunft zu approbieren. Schon die absolut wissenschaftswidrige Methode seiner Geschichtsphilosophie, nämlich: das, was durch den Gang der Untersuchung zu beweisen gewesen wäre, als unangezweifelte und unanzweifelbare Voraussetzung — wie er wörtlich sagt — „mitzubringen“ (weshalb Jacob Burckhardt ihn trefflich des „kecken Antizipierens“ bezichtigt hat): schon diese Methode müßte, bei tatsächlich waltender Vernunft in der Weltgeschichte, ihn als Denker schlicht lächerlich gemacht haben. Indessen: daß das Ergebnis der Weltgeschichte dereinst der vernünftige, notwendige Gang des Weltgeistes gewesen sein müsse, wie Burckhardt zusammenfassend sagt, oder daß, um Hegel selbst zu zitieren, ein „von der ewigen Weisheit Bezwecktes“ in der Geschichte vorhanden, dem Menschen erkennbar und quasi auftragsgemäß von ihm, dem Menschen, verwirklichbar sei: das wurde tatsächlich geglaubt und nicht nur geglaubt, sondern sozusagen auch praktiziert: im Kommunismus vor allem, oder im Nationalsozialismus, und man darf sicher sein, daß auch künftighin jeder, der einen Machtanspruch rechtswidrig und menschenfeindlich durchsetzen will, seine Gewaltanwendung gleichsam rehabilitieren wird mit dem aus Hegel gezogenen pathetischen Geständnis, er spiele den Henkersknecht nicht in eigener, sondern in der Regie des Weltgeistes. Stalin und Hitler können, eigentlich, gar nichts dafür. Oder wie der „Herr Karl“, der ja „nur an Juden g'führt“ hat, mit letzter hegelianischer Konsequenz dann feststellen darf: „I war a Opfer.“
Man braucht kein Tiefenpsychologe zu sein, um zu erahnen, wie unbewußte Utopien sich bilden. Es ist die unergründlich tief und deshalb unausrottbar in einem Menschen sitzende Todesangst, die ihn lebensängstlich macht und ihn veranlaßt, ja geradezu zwingt dazu, imaginär vorwegzunehmen, was hie et nunc zu leisten er sich nicht zutraut; die Angst vor seinem konkreten persönlichen Schicksal, das er deshalb in eine abstrakte allgemeine Zukunft vorausprojiziert. Daß dabei das Kriterium des Menschseins, nämlich die Geschicklichkeit, verlorengeht, versteht sich von selbst. Und dieser Verlust wieder zeitigt den sattsam bekannten Mangel an historischem Tatsachensinn — womit die utopistische Katze sich in den nicht minder utopistischen Schwanz beißt. Dem anarchistischen Utopisten zum Beispiel schwebt die Vision einer der Ordnungsmacht entbehrenden Gesellschaft mündiger Menschen vor.
Das klingt nicht übel, doch nur so lange, als man nicht fragt, welcher potentielle Realitätsgehalt dieser Vision innewohnt, da ihre historische und eo ipso kontrollierbare reale Basis, ihre faktische Voraussetzung, der Prüfung nicht standhält; denn wie der Geist nur eine Funktion der als Gehirn und Nerven bezeichneten Organe ist (und streng begrifflich deshalb auch weder gesund noch krank sein kann), so ist die Utopie gewissermaßen nur eine Fuktion des als Mensch bezeichneten Organismus, aus dessen Krankhaftigkeit die Funktionsstörung herrührt, so daß umgekehrt eine Funktionsstörung wenn nicht den Schluß, so doch mindestens den Vedacht auf eine Organkrankheit nahelegt. Und wir wisser nun, seit wir vom Menschen überhaupt wissen, daß dieser Mensch weder biologisch noch intellektuell noch moralisch perfekt und auch niemals je perfektionierbar war.
Der anarchistische Utopist ignoriert ganz einfach, daß gerade die von ihm erhofften Tugenden des Menschen wie Mündigkeit und Selbstverantwortlichkeit nich! gleichsam eingefleischte, sondern immer nur Tugenden ad hoc seir können: Chancen der Vervollkommnung, die man keineswegs zwangsläufig wahrnimmt, sondern weit ehe: und öfter verpaßt. Aber in seinerr Verzicht auf Empirie übersieht ei auch die nur scheinbar paradoxe Tatsache, daß die persönliche Freiheit adäquat dem Anwachsen der Staatsgewalt seit dem 18. Jahrhundert zugenommen hat, qualitativ und quantitativ; ja mehr noch: daß Freiheit— ein Singular! — an die Stelle von Privilegien — ein Plural! — überhaupt erst getreten ist, seit es die bürgerlich-demokratischen Nationalstaaten gibt, was selbst in der kommunistischen Perversion des demokratischen Rechtsstaates noch geheimnisvoll durchschimmert, wenn der Marxismus-Leninismus den Umweg über die totale Staatsautorität als den einzig wahren Weg zur späteren, dann aber endgültigen persönlichen Freiheit propagiert. Weshalb bei logischer Betrachtung der Dinge, der von den Anarchisten geforderte Abbau der Staatsmacht, des Garanten der Gesellschaftsordnung, doch wohl eher eine Verminderung statt der selbstverständlich erwünschten Vermehrung Dersönlicher Freiheit zur Folge hätte. Kurzum: gerade die anarchistische Utopie belehrt uns darüber, wie notwendig es ist, die Schnur, an der man den Drachen steigen läßt, fest in der Hand zu behalten.
Oder aber: sollten wir lieber nicht gleich versuchen, ganz ohne jedwede Utopie zu leben?
Utopie in der Politik
Die Frage ist müßig; wir könnten es nämlich nicht. Oder müßten es bitter bezahlen mit dem Verlust jener menschlichen Dimension, die eben dadurch, daß sie über unser Leben hinauszielt, uns in eben diesem Leben hält. Denken wir uns — ein hier naheliegendes Beispiel — den Schriftsteller, der sich vor sein leeres Blatt Papier setzt, einsam mit sich und zugleich umringt von allen, die vor ihm geschrieben haben. Woher nimmt er den Mut, ja die Frechheit, den Schöpfungen eines Homer und Horaz, eines Dante und Shakespeare, eines Cervantes und Goethe, eines Tolstoi und Hemingway Konkurrenz zu machen? Eingedenk dessen, was die Welt literarisch vor ihm geleistet hat, und eingedenk seiner eigenen Mängel und Schwächen, kurz: angesichts dieser ganz eklatanten Diskrepanz also müßte er seine Feder schon sinken lassen, ehe der erste Tropfen von Tinte aus ihr geflossen. Will er dennoch schreiben — und schreiben will er, denn „man kann sich“, sagt Raimund, „doch nicht in einem fort umbringen“ —, dann freilich bleibt ihm nichts übrig, als in einer Vision von dem Werk, das er schaffen soll, alles vor ihm Geschaffene zu verdunkeln.
Es bedarf wohl keines Beweises, daß diese Hybris allein noch keinen zur Künstlerschaft, gar manchen jedoch schon in (meist aggressive) Verblödung geführt hat. Zwar noch einmal sei es gesagt: daß der Schriftsteller, wenn er schreibt, nur in jener skizzierten utopistischen Egozentrik schreiben kann, weil sonst die ungeheuere Übermacht des schon Geschriebenen ihm die Rede verschlüge. Jedoch: seine Hybris ist ihm ein bloßes Mittel zum Zweck, solang er sich ihrer bewußt bleibt: solang er sie als etwas Künstliches kennt und benützt, nicht als etwas Natürliches hat und erleidet. Solang die Schnur, an der er den Drachen steigen läßt, gedreht ist aus Ehrfurcht und Demut vor den Meistern und aus Kritik und Bescheidung seiner selbst.
Vielleicht am deutlichsten erhellt die Notwendigkeit der Utopie gerade dort, wo sie begrifflich im engeren Sinn beheimatet ist: in der Politik. Diese ist, wie jede Kunst, eine Kunst der kleinen Schritte; was hinterher als der große Wurf erscheint, ist nichts anderes als die Summe von tausend und abertausend kleinen Handgriffen. Wie aber sollte, wie könnte ein Politiker all diese Schritte und Handgriffe nutzbringend setzen, wenn nicht ein Ziel sie lenkte, das jenseits des jeweils Aktuellen liegt? Dieses Ziel mag heißen Völkerfriede oder Wohlfahrtsstaat oder nationale Wiedergeburt oder wie auch immer: dieses eigentlich, wenn auch nur indirekt gemeinte Ziel erst rechtfertigt hier diesen Vertrag und da diese Exportförderung und dort diesen Schulbau oder was auch immer. Wie der Magnet die Eisenfeilspäne, so ordnet die Utopie die Aktionen des Politikers, dessen pragmatische Existenz ohne solchen Sinnbezug immer sehr bald — die Beispiele sind unter uns — zur Karikatur des Tatmenschen, zum Gschaftelhuber, degeneriert.
Aber selbst in der Intimität zweier Menschen garantiert erst die Utopie, wenn schon nicht das tägliche Bestehen selbst, so doch die Chance des täglichen Bestehens mit- und füreinander: die Ehe wäre nichts weiter als eine kirchlich lizenzierte und staatlich legalisierte Prostitution, wenn in den beiden, die da einander gefunden zu haben wähnen, nicht jenes unsterbliche, weil niemals herstellbare Bild der zwei getrennten und fortan einander suchenden Hälften gleichsam skizziert wäre; so daß selbst das, was wir so leichthin als Ehekrach bezeichnen, vor diesem Hintergrund interpretiert werden darf als ein (freilich verzweifeltes) Ringen keineswegs eigentlich gegen einander, sondern im Grund gegen die mit dem Bild nicht korrespondierenden Fakten. Unter diesem Aspekt wäre übrigens Don Juan bei all seiner beneidenswerten Potenz, durchaus nicht der sprichwörtlich große Liebende, sondern, im Gegenteil, die personifizierte Liebelosigkeit: der Mensch, der, wie jeder, zwar lieben will, aber nicht lieben kann, weil jene platonische Utopie der Liebe: das Suchen nach der abgetrennten Hälfte, ihm schon nicht, mehr als Utopie bewußt, sondern zur Natur geworden ist. Den Anspruch, den er, bei realistischer Einschätzung der menschlichen Gegebenheiten und menschlichen Möglichkeiten, an sich selber stellen müßte: diesen Anspruch stellt er an die andern, konkret: an die Frauen — womit wir, endlich, zurück zu der eingangs gegebenen Unterscheidung und zugleich ein neues Kriterium dieser Unterscheidung gefunden hätten; nämlich: Der Mensch, dem die Utopie nicht bewußt, dem sie Teil seiner Natur ist, stellt mit dieser Utopie einen Anspruch an die Welt: So, wie ich sie mir denke, sollte sie sein! Der Mensch hingegen, der in seiner Utopie ein bewußt und künstlich geschaffenes Modell erblickt und der sie deshalb gewissermaßen nur als Arbeitshypothese benützt, stellt mit dieser Utopie einen Anspruch an sich selber: Meinem Denkmodell entsprechend sollte ich handeln!
Ratio als Kontrolle
Gewiß: auch diesem zweiten Typus des Utopisten droht ständig Entartung in Abstraktion, weil es viel Mühe bereitet, die Unvollkommen-heit des Menschen in Rechnung zu stellen, und weil es viel, unendlich viel Mühe bereitet, diese Unvollkom-menheit gar auch zu akzeptieren; und zwar droht sie, diese Entartung, um so gefährlicher, je größer der irrationale Anteil, je mächtiger die Glaubenssubstanz in seiner Utopie ist: die Fanatiker des Guten erweisen sich meist als rechte Teufel. Das Christentum jedenfalls hat das Problem der Utopie nicht befriedigend lösen können: gerade auf dem von ihm beackerten Boden gedeihen seit eh und je die seltsamsten und auch grauslichsten Abstraktionen, während die großen asiatischen Religionen nie ganz die Anwendbarkeit ihrer Glaubenssätze preisgegeben, nie ganz ihre Utopien verabsolutiert haben: „Geh hin und wasch deine Reisschüssel“, antwortet ein Zen-Meister seinem Schüler auf die Frage nach dem rechten Weg. Womit das Problem der Utopie als reduziert erscheint auf seinen innersten Kern: auf das Verhältnis zwischen Wort und Tat.
Nichts wäre freilich banaler, als zu versuchen, Wort und Tat zur Identifikation zu bringen; aber nichts wäre wichtiger, als darüber zu wachen, daß sie in jeweils optimaler Korrespondenz miteinander stehen: das Wort muß anwendbar bleiben, ohne zum Alibi der Tat sich herzugeben; und die Tat muß verantwortbar bleiben, ohne das Wort zu desavouieren. Unser Werkzeug solcher Kontrolle ist die Ratio: nicht unbedingt im totalitären Sinn des Rationalismus verstanden, sondern als die Kunst der Bewußtheit gegenüber der Natur des Unbewußten; nämlich — um sinngemäß mit Goethe zu schließen — die Ratio als Verpflichtung, zwar zu glauben und staunend zu verehren, aber erst dann zu glauben und zu verehren, wenn alles Erforschbare erforscht und alles Beweisbare bewiesen ist. Dies einmal vorausgesetzt und für allemal festgehalten habend, werden wir recht zu gebrauchen erlernen, was scheinbar jenseits von allem Gebrauch oder nur zum Mißbrauch, vorhanden ist: wir erstellen und sehn und benützen dann unsere Utopien als trigonometrische Punkte in dem sonst unüberblickbaren Dschungel unserer Taten.




































































































