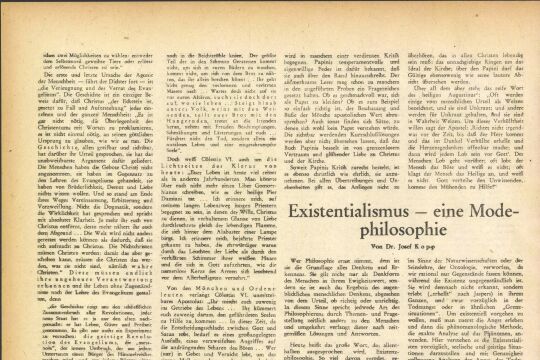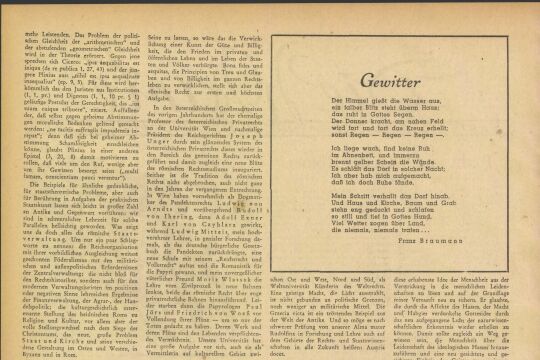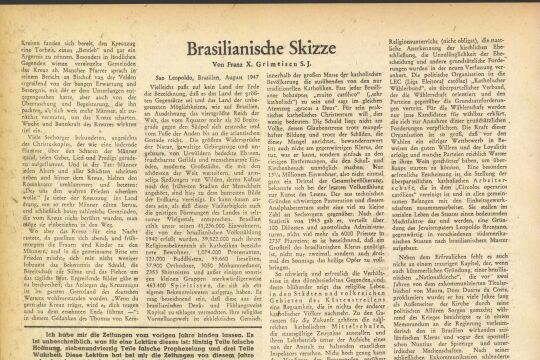Genf, Ende September 1947
Wir sind in Genf, der Stadt Calvins und dem geistigen Zentrum der romanischen Schweiz. Malerisch an das Ende des Sees und dessen Ausfluß in die Rhone geschmiegt, ist es eine der Städte, die trotz ihrer starken historischen Prägung voll in der Gegenwart steht; ihre Lebenskraft kommt doch aus einer starken und lebendigen Tradition her. Wir sjnd auf dem Place Neuve. An der Rampe, die zur Altstadt hinaufführt, liest man die Inschrift zu Ehren jenes Bürgers, dessen Kaltblütigkeit die Stadt einst vor der Eroberung durch die Savoyarden bewahrte — die Erinnerung an die „Escalade“ von 1602 wird heute noch in einem großen, historischen Fest am 12. Dezember jedes Jahres begangen — gegenüber steht das Reiterdenkmal des Generals Dufour, der vor 100 Jahren die Einheit der Eidgenossenschaft rettete. Unfern davon erhebt sich, halb hinter den Bäumen des angrenzenden Parks versteckt, das moderne Gebäude der Universität und etwas weiter der schmucke, weiße Säulenbau des Athenäums, beide in diesen Tagen Stätten, an denen das große Wechselgespräch der Wissenschaften, die „Ren-contres Internationales“, sich erneuerte. Die es führen sind Gelehrte aus Paris, Rom, London, Madrid und Zürich; die Kreise der französischschweizerischen Intelligenz, Kunst und Politik und das internationale Studententum Genfs bilden das öffentliche Forum. Sitz der europäischen Zentrale der UNESCO und mehrerer anderer internationaler Organisationen, aber doch seines einstigen Stolzes, des Völkerbunds, beraubt, hat Genf sich seit Kriegsende bemüht, seine internationale Geltung auf geistigem Gebiete aufzufrischen und führt nun zum zweitenmal seine „internationalen Begegnungen“ durch. Auf der anderen Seite des Place Neuve befindet sich das Grande Thcatre. Es will nicht zurückstehen und bringt als kulturelle Hauptveranstaltung — neben einigen musikalischen Veranstaltungen — Shakespeares „Antonius und Cleopatra“ in einer neuen französischen Ubersetzung heraus.
Es ist keine platonische Akademie, die abgehalten wird. Gemahnt es von fern an die großen Disputationen der mittelalterlichen Universitäten, die dem abendländischen Denken jene Wege bahnten, in die eine spätere Zeit die volle Wucht ihrer Geschehnisse ergießen sollte? Aber wir denken ja kaum mehr sub spscie aeternitatis. Am Horizont unserer Auseinandersetzungen stehen die drohenden Wolken unserer Zeit. Das Thema heißt „Technischer u nd moralischer Fortschritt“.
Zahllos sind die Siege und Errungenschaften der modernen Technik; aber sie haben uns weder auf politischem noch sozialem oder moralischem Gebiete vorangebracht. Im Gegenteil: Die Technik ist zu einer selbständigen Macht herangewachsen, die das innere Gleichgewicht des abendländischen Menschen zerstört hat. Das bloße Vorhandensein dieser Macht birgt aggressive, imperialistische Tendenzen. Die technische Zivilisation bedroht die menschliche Kultur.
Mit diesen Worten kennzeichnet der französische Historiker Andre Siegfried, Mitglied der Academie francaise, in seinem Eingangsvortrag die Zauberlehrlingsituation des modernen Menschen. Die freie Wissenschaft ist zur zweckbestimmten Forschung geworden, der Arbeiter zur Ziffer, die industrielle Produktion übermächtig. Die natürliche Beziehung zwischen dem Menschen als Schöpfer und der Technik als seinem Mittel ist aufgehoben, fügt der italienische Philosoph Guido de Rug-g e r i o hinzu, das Mittel ist zum Selbstzweck geworden. Das schöpferische Denken des Menschen ist nicht mehr individuell bestimmt. Aber man kann eine historische Entwicklung nicht negieren. 'Es gibt keine einfache Wiederherstellung gestürzter Werte zeitlicher Ordnung. Nur eine moralische Ordnung höherer Art enthält in sich die für alle und immer gültigen Satzungen und ihre Anerkennung ist heute erneut notwendig, wenn wir jener bedrohlichen Entwicklung in den Arm fallen wollen. Die Geschichte ist ohne feste Struktur, erklärt der spanische Essayist
E u g e n i o d'O r s. In seinem Buch „Im Reich der Mütter“ will er den echten menschlichen Typus der modernen Technik gegenüberstellen, deren Übermaß nicht mehr im Verhältnis zum wirklichen Bedarf steht und die deshalb den Menschen seiner Persönlichkeit entkleidet. Im Sinne Ortega y Gassets sieht er die Wahl „zwischen dem Geiste und der Zahl, der Masse“. Auch er plädiert für die Wiederherstellung der natürlichen Wertordnung und der echten Autorität.
Aber der Fortschrittsglaube ist nicht tot. Seine Sprecher sind der Pariser Biologe M a rcel Prenant und der englische Naturwissenschaftler J. B. C. H a 1 d a n e, politisch beide Vertreter der äußersten Linken. Die moralische Haltung des Menschen ist nicht standfest, erklärt Haidane, und die ans Wunderbare grenzende Verbesserung der äußeren Lebensbedingungen durch die Technik könnte einen ungeheuren moralischen und kulturellen Fortschritt mit sich bringen. Gott war der erste Techniker, fährt er fort, und als Meister der Technik ahmt der Mensch ihn nach — und braucht ihn nicht länger, soll später noch gesagt werden. Habe zum Beispiel nicht erst der technische Fortschritt die endgültige Abschaffung der Sklaverei veranlaßt? Haidane ist zwar weniger optimistisch als Prenant, der bereits die chemische Erzeugung von Menschen voraussieht, wenn er sie auch persönlich verabscheut, man denkt unwillkürlich an Aldous Huxleys Satire der Technokratie in „Brave New World“, aber Haidane ist überzeugt, daß es nur von uns abhängt, wann wir durch eigene Kraft und Planung aus dem Engpaß unserer jetzigen Lage herauskommen werden. Er glaubt also an die Meisterschaft des Zauberlehrlings. Er sieht die Lösung der Gegenwartskrise in einer kollektivistischen Organisation der Menschheit, unterstützt allerdings von einem unermüdlichen moralischen Bemühen und schließt, indem er das verwegene Wort hinwirft: „N il mortalibus arduum est“ — „Nichts ist den Sterblichen schwer“.
Die Position des englischen Gelehrten bringt so recht zu Bewußtsein, welche ungeheure moralische Strenge der Marxismus im Grunde erfordert. Auch möchte man ihm den Satz gegenüberstellen, den Ruggerio einmal aussprach: Es ist der Sinn der Gerechtigkeit, der Marx bei den Unterdrückten stark gemacht hat, und nicht seine ökonomischen Theorien. — Überhaupt ist jetzt in den Diskussionen viel vom Marxismus die Rede. Haben die Fronten sich gegenüber früher einander genähert, scheinen sie doch starr.
Gelingt dem französischen Philosophen Emanuel Mounier vielleicht, den Circulus vitiosus der Debatten rund um den historischen Materialismus etwas aufzusprengen?
Mounier greift auf die Philosophie der ersten Schriften Marx' zurück. Er erinnert daran, daß der Begriff der „Materie“
— das „Absolute“ des Junghegelianers Marx
— dort neben dem Ökonomisch-Sozialen einen Daseinsanspruch des Menschen im Protest gegen die Gesellschaft miteinbegreift und somit die menschliche Freiheit bejaht, während die Betonung des Materialismus, die ursprünglich gegen die spiritualistischen Philosophien seiner Zeit gerichtet war, erst später eine doktrinäre und dogmatische Verankerung erfuhr. Wird der marxistische Dialektiker, der sich heute um die Preisgabe des Dogmas ängstigt, bestleiten können, daß jener „erste“ Marxismus humanistischer war als der spätere, zur Gültigkeit erhobene?
Auch die christliche Zukunftshoffnung ist kollektiv, betont M b u n i e r, nur begreift sie die individuelle Freiheit mit ein, die der liberale Humanismus nicht zu erhalten, der Marxismus nicht zu geben vermag. Das Wissen um den Menschen hat den Vorrang vor der Soziologie, fügt Nicolas Berdiaeff hinzu, und das Primat der Philosophie kann nicht durch das politische Interesse ersetzt werden. Auch Berdiaeff, der in Paris lebende russische Philosoph, hat sein Leben lang um die Synthese von Marxismus und Christentum gerungen. Aber er ist ein Denker, der auf die letzten Dinge zurückgeht: Für ihn hat die Technik einen im Weltenplan gegebenen Sinn. Er sieht in der Epoche des Etatismus — des Staates jenseits von Gut und Böse, gelenkt von den Mächten der Technik und des Kapitals, eines entmenschlichten Produktionsprozesses und ideologischer Ersatz-rel igionen — die Stufe einer geschichtlichen Dialektik, die älter ist als Hegel. Am Ende einer Bewegung des schöpferischen Denkens, das mit Pascal und Kopernikus begann, stehe heute die Selbstzersetzung der menschlichen Freiheit, nachdem und weil diese alles versucht hat und sich selber zu genügen glaubte. Inmitten der Finsternis der entfesselten Gegenkräfte aber glaubt Berdiaeff an die Auferstehung und die Wiederfindung der verlorenen Freiheit: Nicht aus einem neuen Idealismus, sondern aus dem Glauben und — dies mit Mounier — aus der Umwandlung des christlichen Bewußtseins.
Es war nicht uninteressant, in diesem Zusammenhang in Swami Siddhes-wararanda einen Vertreter des indischen Denkens zu hören. Vielleicht hätte auch kein anderer als ein Inder einen Appell zur Moralität unmittelbarer zu machen gewagt. Nach ihm ist alle Immoralität nur eine Folge der Verfälschung des menschlichen Gewissens. An diesem somatischen Gedanken schließt sich freilich eine Theorie, die doch auf die Selbsterlösung aus der Gnosis hinausläuft.
Daneben ist vor allem der tiefe Pessimismus zu vermerken, der unter den Individualisten zu herrschen scheint. „Unsere Debatten schlagen keine Brücken zwischen der Kultur und dem Wissen“, wurde gesagt. Die Menschheit, die einmal in einer geheiligten Welt gelebt hat, weil sie in ihr das Werk Gottes sah, hat diese mit einer mechanisierten Welt vertauscht, die ihr entgleitet und der Fortschritt verschlingt sie. Ist unser Optimismus nicht vielfach nur zur Schau gestellt, ein Optimismus aus Notwendigkeit und Verzweiflung?
Kein durch bloße menschliche Erfahrung erbringliches Mittel kann das Leiden unserer Zeit heilen, antwortet eine Stimme. Wir müssen den ganzen Menschen wiederherstellen, ihn von neuem schaffen. Der Wortführer dieses neuen Renaissancegedankens ist Theophil Spoerri, der Schweizer Kulturphilosoph und Begründer der Züricher phänomenologischen Schule der Philologie. Seine Stellungnahme ist vielleicht eine der präzisesten von allen: Technik und Individualismus gehen beide auf die Renaissance zurück. Sie verknüpfte das Geistige mit dem Zeitlichen und erfand das Ideal des bürgerlichen Lebens. Wie aber allem menschlichen Streben, ob individuell oder kollektiv, ein geheimer Wunsch zugrunde liegt, so war der Traum der Renaissance die Herrschaft des Menschen in der Sphäre des Zeitlichen. So gewann das Zeitliche das Übergewicht. Die Grenzen des Weltlichen und des Sakralen wurden verwischt, der Mensch „verdinglichte“ sich, wir erlebten die Vergottung einer Rasse, einer Klasse, des Staates. Heute strebt der Mensch zum Sakralen zurück. Der Totali-tarismus, aus dem Bedürfnis nach dem Absoluten geboren, der moderne Nihilismus, gegen dieses gerichtet, werden zu Zeugen dieses Suchens. Auch der Marxismus ist ein solches: er befriedigt nur einen Teil des menschlichen Strebens. Der Individualismus stirbt: ein neuer Kollektivismus, der ihn ersetzt, ist ohne sakralen Gehalt. Der Mensch muß die Unterscheidung des Profanen und des Sakralen wiederherstellen: darin besteht die Renaissance unserer Zeit. „Auf Gott höre n“, sagt Pascal.
Die hauptsächlichsten europäischen Geistesrichtungen sind auf den „Rencontres Internationales“ zu Wort gekommen. Waren sie wirklich nur ein Bild der Wirrnis unserer Tage, wie manche Stimmen es behaupteten? Wir glauben es nicht. Die um 'die Entscheidung ringen, stehen in klaren Fronten.