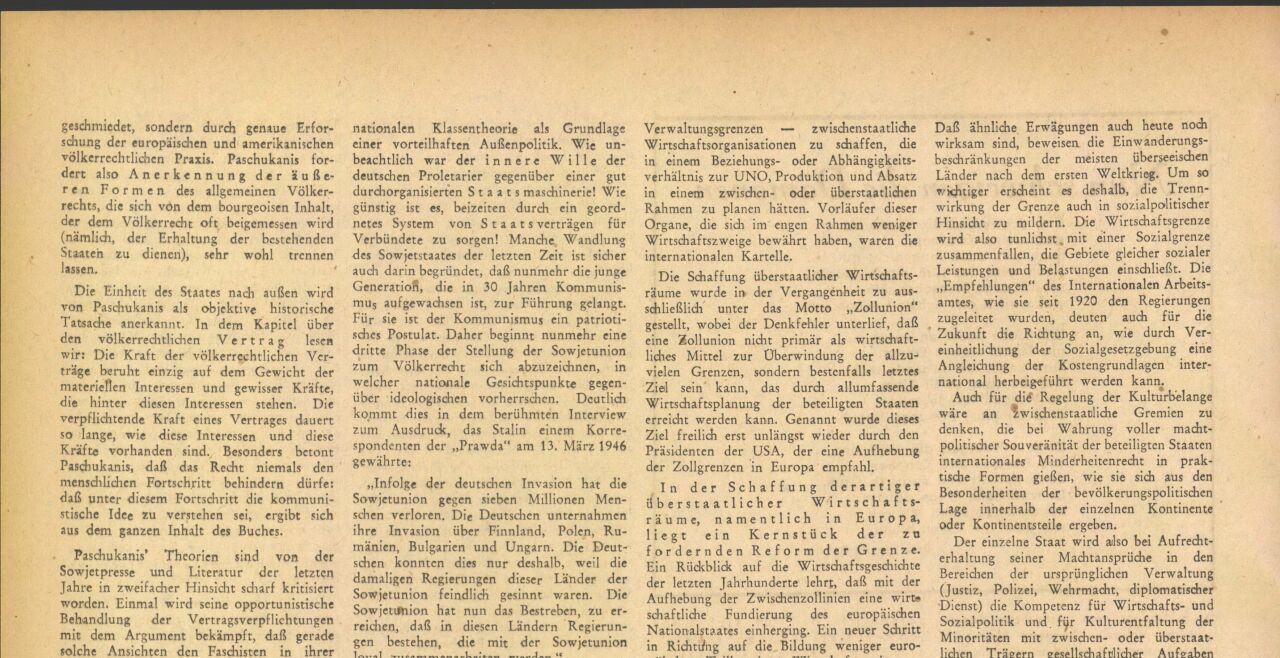
Als Napoleon sich in Erfurt mit Goethe über das Wesen der Tragödie unterhielt, meinte er, die modernen Trauerspiele unterschieden sich dadurch von den antiken, daß wir kein „Schicksal“ mehr hätten, dem die Menschen erlägen. An seine Stelle sei die Politik getreten. Diese müsse daher auch in der Tragödie als Fatum verwendet werden, als die unwiderstehliche Gewalt, der sich der einzelne zu beugen habe. Nicht also mit dem überlegenen Lächeln des großen Täters der Weltgesdiichte sprach der Kaiser das berühmte Wort, sondern mit mensdilichem Empfinden für die Tragik dieser Erkenntnis und das ehrt ihn, selbst wenn er dabei mehr an sich als an seine Opfer gedacht haben sollte.
Die Wahrheit seines Ausspruches hat die Gegenwart mit erschreckender Gewalt erfahren. „Nie in meinem Leben habe ich die Ohnmacht des Menschen gegen das Weltgeschehen grausamer empfunden. Da waren irgendwo im Unsichtbaren ein Dutzend Menschen, die man nicht kannte, die man nie gesehen, und diese zehn oder zwanzig Menschen, von denen die wenigsten bisher besondere Klugheit oder Geschicklichkeit bewiesen, faßten Entsddüsse, an denen man nicht teil hatte und die man im einzelnen nicht erfuhr und bestimmten dabei doch endgültig über mein eigenes Leben und das jedes anderen in Europa. Und da saß ich wie alle die andern in meinem Zimmer, wehrlos wie eine Fliege, machtlos wie eine Schnecke, indes es auf Leben und Tod ging, harrte und starrte ins Leere wie ein Verurteilter in seiner Zelle, eingemauert, eingekettet.“ So besdireibt Stephan Zweig in seinem letzten Werk „Die Welt von gestern“ die Tage, die dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges vorangingen, und tausendfältig haben alle, auch die meisten von den führenden Politikern, in den vergangenen Jahren dieses Gefühl der Ohnmacht empfunden und empfinden es wohl noch heute.
Ist dies nicht eine glänzende Bestätigxing der deterministischen Geschichtsphilosophie, ein Triumph für Hegel und Spengler? Lenkt nicht wirklich ein dunkles Fatum die Geschicke der Welt? Scheint es nicht in der Tat so zu sein, wie der Prophet des Untergangs des Abendlandes mit der unbeweglichen Miene des Verhängnisses verkündete: wir hätten die Entwicklungsstufe des Cäsarismus erreicht und seien mit den römischen Soldatenkaisern „gleichzeitig“? Der große einzelne herrsche über entnervte Fellachenmawen, die er als Schlachtvieh traktiere. Kolossalkriege der Cäsaren um Macht und Beute seien unser Schicksal, Ströme Blutes, und was uns Fellachen betreffe, Schweigen und Dulden? Wird es nicht in dieser Art weitergehen müssen? Denn zweihundert Jahre dauert ja nach dem „morphologischen“ Gesetz das Zeitalter des Cäsarismus, das mit Napoleon begann, und nach seinem Ablauf wird die abendländische Kultur endgültig zugrunde gegangen sein. Und hat Spengler bis jetzt in den Fakten recht, stimmt dann nicht vielleicht auch die Konsequenz, die er für die Praxis zieht, die Forderung an den Menschen von heute, „das Notwendige zu wollen“?
Sehr viele Such von den Wissenden haben jedenfalls nach dieser Maxime gehandelt, und namentlich in Deutschland haben viele, wie schon oft mit Hegel, das Wirkliche für das Vernünftige gehalten und ihre Freiheit durch Selbsttäuschung salviert. Sie haben das „Notwendige“ gewollt, das heißt, was die Machthaber der Stunde so nannten, die, wie es die Politiker zu allen Zeiten getan haben, damit die Pläne ihres Ehrgeizes umschrieben. Und diese Pläne fielen ja zusammen mit dem, was nach Spengler „streng wissenschaftlich“ zu erwarten, „also“ zu fordern war. Härten sich die Menschen widersetzt, um so schlimmer. Das „Notwendige“ hätte sich gleichwohl vollzogen.
Spengler war nicht der einzige Fatalist der Trostlosigkeit. Neben und nach ihm sind andere hervorgetreten, die uns die Gesetze des stählernen Weltalters offenbarten, nicht voller Entsetzen, sondern mit einem quälenden Entzücken, so Ernst Jünger, der in seinem Essay „Über den Schmerz“, vielleicht dem Unheimlichsten dieser Art, erklärte, daß der Schmerz als menschliche Regung abgetan sei und in unserem Zeitalter keinerlei Berücksichtigung mehr verdiene, und neuerdings Arthur Koestler, der in dem Buche „Darkness at noon“ die Entwertung einer persönlichen „menschlichen“ Weltansicht durch die kollektive Idee faszinierend schilderte.
Schon Max Scheler, dem Spengler damals noch unbekannt war, hat hinter einer solchen fatalistischen Haltung das Bewußtsein der Schuld erkannt, das durch sie zum Schweigen gebracht werden soll. Nur von einer Geschichtsbetrachtung, die von dem tätigen Einsehen der Schuld getragen ist, niemals aber von der Geisteshaltung des Determinismus, kann, so meint er, eine historische Erkenntnis erwartet werden, die nicht nur Vergangenheit schildert, sondern das Wichtigste tut, was historische Erkenntnis tun kann, nämlich von Vergangenheit entlastet und zu neuer Zukunft und Tatkraft frei und kräftig macht. Die Freiheit und der Glaube, es sei wahrhaft möglich, die Welt anders einzurichten, als die Welt war, die zum Kriege führte, sei das erste' innere Erfordernis zum Aufbau.
Die Freiheit und der Glaube — das sind andere Töne als die düster-kalten Offenbarungen jener Defaitisten der Humanität. Es ist die der Spenglerschen genau entgegengesetzte Anschauung. Aber die europäische Geschichtsschreibung, die sich .ils ein einziger großer schmerzvoller Reueakt darstellen sollte, ist ausgeblieben, und ein politisches Verhalten, das ihr entsprochen hätte, hat sich nicht durchsetzen können, so daß im tatsächlichen vielmehr Spengler recht zu behalten schien. Und doch hat es eine solche Betrachtung schon einmal gegeben, Scheler hafte darauf verweisen können: bei den Römern, die die Ursachen für die inneren und äußeren Katastrophen ihrer Geschichte nicht wie die deutschen Historiker und zum Beispiel auch Thuky-dides in irgendwelchen geschichtlichen Notwendigkeiten, sondern in Fehlern des eigenen Charakters und der eigenen Moral suchten. Und hierin darf man einen Fingerzeig sehen, welche von den beiden Auffassungen die fruchtbarere ist. Der Unterschied zwischen den politischen Erfolgen der Nation, die Hegel, Ranke und Spengler hervorbrachte, und den staatsmännischen Leistungen, die das Volk in das Buch der Weltgeschichte einzeichnete, dem Sallust, Livius und Tacitus angehörten, spricht da eine sehr deutlxhe Sprache.
Auch heute ist der energischeste Widerstand gegen jede Form von Determinismus, der nach wie vor das politische Denken und Handeln in seine engen und gefährlichen Bahnen zwängen möchte, das Gebot der Stunde. Wohl erscheint dem Erkennenden das Geschehene nachträglich als „notwendig“, wenn er das Moment menschlicher Schuld und moralischen Versagens in die Betrachtung einbezieht und auch die Zukunft vermag er vorauszusehen. Er muß für sie Schlimmes erwarten, weil er weiß, daß Fehler Konsequenzen haben und die Geschichte Kurzsichtigkeit unerbittlich bestraft, weil er sieht, daß, im Gleichnis Piatos zu reden, dem „Lenker Geist“ die Zügel entglitten sind und die Rosse, Trieb und Leidenschaft, dem Abgrund zueilen, weil er mit Besorgnis erkennt, daß das Maß der Schuld, unser aller bittere Schuld, sich nicht mindert, sondern weiter steigt. Aber das Gesetz der Zwangsläufigkeit, das hier waltet, ist kein „morphologisches“ oder metaphysisches, sondern ein logisch-kausales. Es schließt die Möglichkeit, ja die Notwendigkeit ein, daß Fehler vermieden werden und darum wird der Wissende nicht schmerzensstumm die Welt ihren Gang gehen lassen oder die politischen Dinge mit der bitteren Ironie der Gleichgültigkeit den Skrupellosen und Gauklern überlassen. Er wird eingreifen, wo immer er nur kann, und dies nicht im Sinne der „historischen Tendenz“, wie es Spengler und andere Liebediener des Augenblicks von ihm fordern, sondern gegen sie. Vor den öffentlichen Meinungen wird er nicht kapitulieren, selbst wenn sie sich noch sosehr mit dem Schein des Notwendigen umkleiden, noch willenlos in den allgemeinen Strom einmünden, sondern selbstverantwortlich handeln nach -den ungeschriebenen Gesetzen des Rechtes, der Vernunft und der Menschlichkeit. So verlangt es die heilige und schwere Verantwortung, die er vor der Menschheit trägt. Immer aber wird er alles tun, was in seiner Macht steht, um jene oft kleine, aber dennoch bestehende Chance nicht zu zerstören, daß das „Notwendige“ allen Erwartungen zum Trotz nicht geschieht.
Daß er sich dabei gegen das „Fatum“ stellen muß und den dumpfen Widerstand der Welt, kann den Kundigen nicht wundern. Denn diese Gegnerschaft ist die Wesensbedingung jeder guten und fruchtbaren Tat. „Rede man von welcher Tugend man wolle“, rief der junge Nietzsche aus, „von der Gerechtigkeit, Großmut, Tapferkeit, von der Weisheit und dem Mitleid des Menschen — überall ist er dadurch tugendhaft, daß er sich gegen die blinde Macht der Tatsachen, gegen die Tyrannei des Wirklichen empört und sich Gesetzen unterwirft, die nicht die Gesetze jener Geschichtsfluktuationen sind. Er schwimmt immer gegen die geschichtlichen Wellen, sei es, daß er seine Leidenschaften als die nächste dumme Tatsächlichkeit bekämpft, oder daß er sich zur Ehrlichkeit verpflichtet, während die Lüge rings um ihn herum ihre glitzernden Netze spinnt.“
Politik und Geschichte tragen den unheimlichen Doppelcharakter an sich, der der Menschennatur innewohnt. Der Freiheit des Geistes steht oft der Zwang der Triebe unausgeglichen gegenüber, der Macht des Geistig-Sittlichen die Dämonie der Lebensgier und -angst, die ins Große sich steigernd, den gewaltigen Anschein eines geschichtlichen Fatums gewinnen kann. Wer diesem Schein einseitig Glauben schenkt und ihn zu einem deterministisch pessimistischen Geschichtsbild verfestigt, ist der Gefahr erlegen, vor der Jakob Burckhardt warnte, „die eigenen geschichtlichen Perspektiven für den Ratschluß der Weltgeschichte zu halten“. Wie das Leben des einzelnen ist die Geschichte ein ewiger Kampf zwischen Gott und Satan, der der Fürst dieser Welt ist. Diese Einsicht, die das christliche Geschichtsbild seit dem heiligen Augustin und im Grunde noch dasjenige Goethes und Burckhardts bestimmte, wird immerdar recht behalten.
Doppelt wichtig ist es daher, der Trostlosigkeit des Determinismus der Vorausbestimmtheit und dem brutalen Pessimismus der Verkleinere,- des Menschen mit dem Glauben an sein? höhere Bestimmung entgegenzutreten und der Zerspaltung der abendländischen Geschichte in „morphologisch“ völlig getrennte Abläufe die unverlierbare Idee ihrer Einheit entgegenzuhalten. Nicht nur eine Renaissance hat das Abendland erlebt, sondern unzählige, und so wird auch auf diese furchtbarste aller Krisen eine Wiedergeburt folgen, die die großen und unvergänglichen Gedanken der Antike und des Christentums in ne-,e Wirklichkeiten heimholen wird.
Die Erschütterung ist freilich viel zu tief, als daß nicht vorher noch unendlich viel Schweres durchlittcn werden müßte und vielleicht wird keiner von uns Lebenden den neuen Tag der Menschheit erschauen. Aber dienen können wir ihm schon jetzt, wenn er auch vielleicht anders aussehen wird, als wir ihn uns denken, vielleicht kleiner und nüchterner oder auch unendlich großartiger und leuchtender. Frei von allen Illusionen und von keinen optimistischen Luftspiegelungen geblendet, müssen wir an das glauben, was Burckhardt jenes etwas bezeichnete, das „hinter dem Ablauf und der Flucht des Zeitlichen als ein einzig Wahres steht“. Dieses letzte Geheimnisvolle ist Gott allein und in ihm löst sich die Dialektik von Freiheit und Fatum, von Moral und Macht aus, die dem Measdien im irdischen Bereich so vielfach unauflösbar erscheinen. In ihm deutet sich die rätselhafte Hieroglyphe unserer geschichtlichen Entwicklung, die wir im zeitlichen befangen, nicht klar lesen können. Denn da herrscht weder die „wohltätige Notwendigkeit des Forschritts“, von der Herbert Spencer träumte, noch der trostlose Zwang des Untergangs, den Oswald Spengler, einer der „terribles simplifica-teurs“, an denen unsere Zeit so reich ist, verkündete, noch ist der „Gesamtcharakter der Welt in Ewigkeit Chaos“, wie Nietzsche meinte. Den letzten Sinn dessen, was sich begibt, können wir hier nie ergründen. „In die Zwecke der ewigen Weisheit sind wir nicht eingeweiht“, sdireibt Burckhardt. Aber soviel ist jedenfalls klar: in Geschichte und Politik vollzieht sich ein ewiger Wechsel zwisdien Phasen der Annäherung an die große Bestimmung des Menschen und an die Ewigkeitswerte und Phasen der Entfernung. Es gibt Epochen wachsender Gottesferne und Entmenschung, Zeiten des Hochmuts und der Unbußfertigkeit, und je mehr wir als Erkennende oder Handelnde dem Geist des Zeitalters folgen, desto tiefer stürzen wir selber hinab. Alle, die noch eine Verantwortung vor der abendländischen Geschidite in sich spüren, und die nicht selber aus Trägheit, Angst oder aus dem Gefühl der Ohnmacht die herabziehende Last mehren wollen, müssen es als ihre höchste Pflicht erkennen — ohne Blindheit gegen die „bete humaine“ —, sei es auch nur um ein Geringes, die Gegengewichte zu stärken. Es gilt Vertrauen zu haben auf die Würde und Freiheit der Menschheit, die in ihren einzelnen Individuen wie im ganzen aus der Undurchsich-tigkeit des Zeitlichen immer wieder zum Licht der Ewigkeit emporzustreben.




































































































