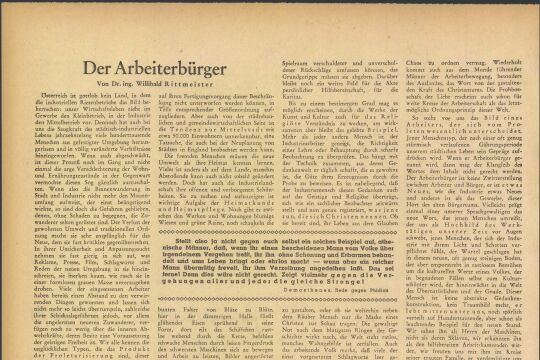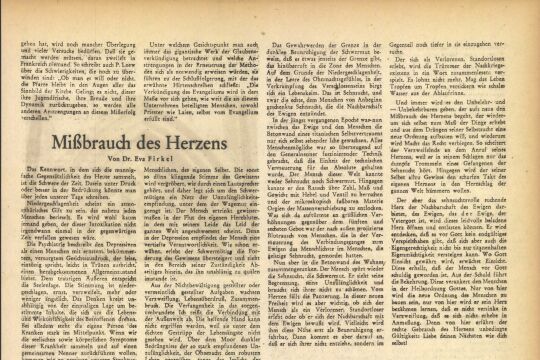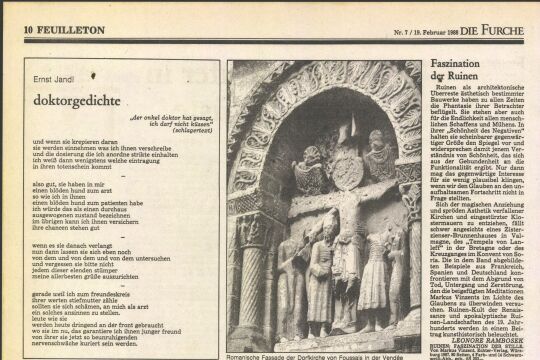Der Frieden ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln? Diese Einsicht ist nicht grausam; sie entspricht der Mobilität des Existierens. Es gibt keinen Stillstand; jedes Leben erneuert sich, wirft sich ins Fremde, gerät außer sich, geht in sich, vergeht; meine umgebrachten Freunde wirken durch die Erinnerung, aber wie lange noch?! Mit einer Geschwindigkeit, der wir nicht gewachsen sind, verändert sich das Bild dieser Welt. Achtzig, vielleicht noch weniger Generationen trennen uns von der Zeit der Kreuzigung in Jerusalem, fünf dieser achtzig Generationen sind uns auch persönlich bekannt.
Bekannt? Mit unserem Leben verwoben. Warum also sollte sich der Mensch und die von ihm geschaffene Gesellschaft in unserer Zeit nicht ändern?
Die Frage ist nur, ob diese Änderung einem vorbestimmten und erkennbaren Mechanismus entspricht oder ob sie von uns geprägt, geformt, mitgestaltet werden kann. Sind wir bloß passive Objekte eines umfassenden Determinismus metaphysischer oder marxistischer Art, oder wollen wir versuchen, das menschliche Leben und Zusammenleben frei zu formen, in Kenntnis der Bauelemente dieses Lebens und ihrer Beschaffenheit, aber doch auch von Hoffnungen, von Lust am Abenteuer, vom Glauben an einem Fortschritt inspiriert?
Das ist der eine Punkt, an dem sich im Jahre 1979 die Geister scheiden. Der Schriftsteller nun, der keine wichtigere Aufgabe hat, als die Dinge beim Namen zu nennen (und zwar genau, also die mobilen Zusammenhänge der Wirklichkeit ebenso beachtend wie die fortwährenden und selbstverständlichen Identitätsdifferenzen zwischen Ding und Wort), der Schriftsteller also kann sich der Pflicht nicht entziehen, die Dramatik des historischen Augenblicks zu artikulieren. Und zwar - und darin liegt sein scheinbarer Nachteil und wirklicher Vorsprung gegenüber den Kollegen vom Nachbarfach, nämlich den Soziologen - vom Standort eines radikalen Subjektivismus.
Denn er ist nicht nur Komponist seiner Arbeiten, sondern zugleich auch Instrument, das zum Tönen gebracht wird von der Luft des Atems oder durch Berührimg - in jedem Fall aber durch Ursachen und Einwirkungen menschlich elementarer Art. In diesen aber wirkt das Irrationale ebenso wie das Geordnete, das Instinktive ebenso wie das Geplante, der Archetyp ebenso wie das Individuum, das Chaos ebenso wie die Sehnsucht nach Erlösung durch Form.
Wenn wir uns nun zu unserem Recht auf Hoffnung bekennen und aus dem geschlossenen Weltbild des mechanischen Materialismus ausbrechen, wenn wir die Kriterien des Fortschritts zu ergründen suchen, wenn wir die Dinge beim Namen nennen, und zwar durchaus im Sinne eines schöpferischen Subjektivismus, dann haben wir damit das Instrumentarium und die Methodik des Schriftstellers andeutungsweise beschrieben.
Erschließen wir zuerst die Energie, die uns am nächsten liegt: die Kraft der subjektiven Erinnerung. Aus ihr treten die Toten dieses Jahrhunderts hervor, die schuldlos Hingemordeten, die Opfer des politischen Fanatismus. Sie sind es, denen ich mich Verpflichtet fühle, die ich vertrete, denen ich meine Stimme leihen möchte, solange ich lebe. Ich denke dabei nicht an abstrakte Kategorien, nicht an Schuld und Sühne, an anonyme und für ein ganz bestimmtes Denken offenbar auch gesichtslose Menschenmassen, sondern an Verwandte, an Freunde, an gute Bekannte: der junge Lyriker wurde am Wegrand mit dem Gewehrkolben erschlagen, die taubstumme Näherin wurde in ihrem Kämmerchen von der Bombe zerfetzt, die Söhne des Schneidermeisters wurden an der Ostfront erschossen, die Töchter des Uhrmachers in Auschwitz verbrannt, die Lehrmeister in revolutionärer Praxis im Jahre 1949 irrtümlich gehenkt, ein Freund im Gefängnis durch einen Kunstfehler umgebracht:
Er mußte künstlich ernährt werden, und man hatte ihn den bei solchen' Gelegenheiten verwendeten Schlauch nicht in die Speiseröhre, sondern in die Luftröhre geschoben. Wer kennt die Mörder? Und wer kennt die Verbrecher, die damals, bei irgend einem der großen Schlachtfeste dieses Jahrhunderts, ihre Opfer zwar nicht tödlich getroffen, aber verwundet oder seelisch deformiert haben, so daß sie Jahrzehnte später an den Folgen jener Hiebe dahinsterben müssen? Soll ich Herbert Zand nennen, Paul Celan, Reinhard Federmann?
Es ist meine, es ist unsere Pflicht den Toten gegenüber, politischen Fanatismus in allen seinen Erscheinungsformen gesellschaftlich zu isolieren, möglichst unwirksam zu machen - auch wenn die Fanatiker noch so überzeugt sind, sich auf die edelsten Motive berufen und meinen, auf ihre Fahnen die edelsten Parolen heften zu können. Daß eine solche Abgrenzung der geistigen Hygiene da und dort Lücken hat, ist eine alarmierende Tatsache. Der Schriftsteller, der das Andenken seiner Toten hütet, muß handeln: durch Worte, die sich in Taten verwandeln, denn die toten Freunde leben nur solange wir leben, und Geschichte wird bekanntlich von den Siegern geschrieben.
Nun erst dürfen wir darangehen, die Mobilität des gesellschaftlichen Seins zu beobachten und unsere Maße eines wirklichen Fortschritts zu formulieren - ohne Rücksicht darauf, wer welche Fahnen schwenkt, wer wann sich selbst oder einen anderen mit welchen Qualifikationen versehen hat. Ich glaube, in den hochindustrialisierten Ländern Europas “hat Fortschritt im Jahre 1979 sicherlich zwei Kriterien: Er muß eine Ausweitung der persönlichen Freiheit bringen und zugleich auch den Kreis der menschlichen Bewußtheit erweitern.
Mehr persönliche Freiheit bedeutet: Mehr direkte Demokratie und weniger staatlichen Einfluß; mehr eigene Entscheidung und weniger Dirigismus; mehr Abenteuerlichkeit des Lebens und weniger Kosten-Nutzen-Denken; mehr Möglichkeiten für die schöpferische Phantasie und weniger Hilfsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Trägheit; mehr Vielleicht und weniger Gewiß; mehr Fragen und weniger Antworten. Mehr persönliche Freiheit bedeutet auch: ein Parlament, das nicht von den Parteiführern, sondern vom Volk gewählt wird.
Und mehr Bewußtheit? Während die Technjk und überhaupt das Weltbild der Naturwissenschaften die Zeit der Dampfmaschinen längst hinter sich gelassen hat, steckt das politische Denken - in seinem Materialismus, in seinem naiven Voluntarismus, in seinem Vertrauen in die Wirksamkeit legisti-scher Maßnahmen - noch in der Phase des kindisch oder wenigstens heute bereits kindisch erscheinenden Positivismus; und also können all diese rührenden Denker einer vergangenen Zeit offenbar nicht verstehen, daß ihre Beglückungsrezepte die Menschen nicht beglücken, daß -im Gegenteil - eine allgemeine Lust-losigkeit um sich greift, und zwar nicht, weil der Mensch, wie manche behaupten, der Ware entfremdet und selbst zur Ware geworden ist, sondern, weil er im gesamten Beglük-kungsmechanismus wohl die angebotene materielle Sicherheit, zugleich aber auch die Unterdrückung spürt.
Denn er wird den Lügen eines Vulgärrationalismus unterworfen und im Ausloten des eigenen Schicksals gehindert, in die falsche Freundlichkeit eines gigantischen Betriebsausfluges hineingestoßen und also letztlich zum psychischen Krüppel gemacht. „Umgang mit Zwergen deformiert das Rückgrat“, notierte in Krakau Stanislaw Jerzy Lee.
Es mag nun sein, daß manche diesen allgemeinen Zustand, der in seiner geordneten Stabilität und gleichmäßigen Wärme an die große Zeit der Leibeigenschaft erinnert, für wünschenswert halten. Aber sie sollten uns nicht einreden wollen, daß Verzicht auf Freiheit und auf schicksalsbezogenes Wissen einen Fortschritt bedeutet.
Sie sollten den Mut haben und offen aussprechen, daß sie das Zurücksinken des europäischen Lebensgefühls auf die geistig niedrige Stufe einer harmlosen Idylle für richtig oder für unabwendbar halten, daß sie einen Rückfall wollen, einen Rückfall in das freundliche Zwielicht einer Gesellschaft, die, leidlich wohl versorgt, schlaftrunken konfliktscheu, vorbeihuschende bunte Bildchen betrachtend, träge dahindämmert -r während die Sache des historischen
Fortschritts auf anderen Kontinenten von anderen Völkern besorgt wird.
Rasch sind, wie gesagt, die Veränderungen der menschlichen Gesellschaft, und der Schriftsteller kann sich, wie ebenfalls bereits gesagt, der Pflicht nicht entziehen, die Dramatik des historischen Augenblicks zu artikulieren. Er sieht sich einer Alternative gegenübergestellt. Sie lautet: Neue Freiheit oder neue Leibeigenschaft? Und obwohl er durch das gute Zureden mancher gefühlsvollen oder in verschiedenen Theorien beschlagenen Zeitgenossen und noch mehr durch die Verlockung eines Erfolges auf dem Wege der Anpassung durchaus bereit sein könnte, als Herold der neuen Leibeigenschaft aufzutreten, muß er sich zuletzt doch für die Freiheit entscheiden.
Wachsam betrachtet er das eigene Dahinleben und Dahinsterben, staunend über das in ihm bewußt werdende Chaos all der Jahrtausende, über all die Variationsmöglichkeiten einer sozialen Urkraft, die immer wieder neue Strukturen schafft und Phantasmagorien hervorbringt: Einbildungen, die Zusammenleben normativ gestalten. Je stabiler die Existenzform, umso morbider die Süßlichkeit der Idylle, je größer die Sicherheit des Seins, umso schwieriger, den Sinn des Lebensablaufes zu begreifen, je geordneter die äußere Welt, umso hohler die innere - und womit könnte sich das Vakuum füllen, wenn nicht mit Arabesken, die durch das gestörte Verhältnis zur
Wirklichkeit entstehen, also mit Wahnsinn?!
„Stell dir bloß eine ganze, universale, eine Menschheitsordnung, mit einem Wort eine vollkommene zivilistische Ordnung vor: So behaupte ich, das ist der Kältetod, die Leichenstarre, eine Mondlandschaft, eine geometrische Epidemie“, schreibt Robert Musil.
Der Schriftsteller, ein Mensch der Irritation, ein Mann der Empörung (denn weshalb sonst wäre er zum Schriftsteller geworden?), muß die Freiheit wählen als das Lebenselement der Vitalität. Angesichts der Bedrohung durch jene „geometrische Epidemie“ wird er durch Beschreibung des Vorganges Alarm schlagen, um zugleich seine Vorkehrungen zu treffen, wenn es sein müßte, irgendwo in der Tiefe der sprachlichen Existenz zu überwintern.
(Dieser Beitrag ist ein Vorabdruck aus dem Band „Politik und Geist: Denken ohne Dogmen“, der im Verlag des Institutes für Wirtschaft und Politik in Wien erschienen ist)
Sebastian im Traum
Von Georg Trdkl
Rosige Osterglocke im Grabgewölbe der Nacht Und die Silberstimmen der Sterne, Daß in Schauern ein dunkler Wahnsinn von derStirne des Schläfers sank.
O wie stille ein Gang den blauen Fluß hinab
Vergessenes sinnend, da im grünen Geäst
Die Drossel ein Fremdes in den Untergang rief.
Oder wenn er an der knöchernen Hand des Greisen Abends vor die verfallene Mauer der Stadt ging Und jener in schwarzem Mantel ein rosiges Kindlein trug, Im Schatten des Nußbaumes der Geist des Bösen erschien.
Tasten über die grünen Stufen des Sommers. O wie leise Verfiel der Garten in der braunen Stille des Herbstes, Duft und Schwermut des alten Hollunders, Da in Sebastians Schatten die Silberstimme des Engels erstarb.