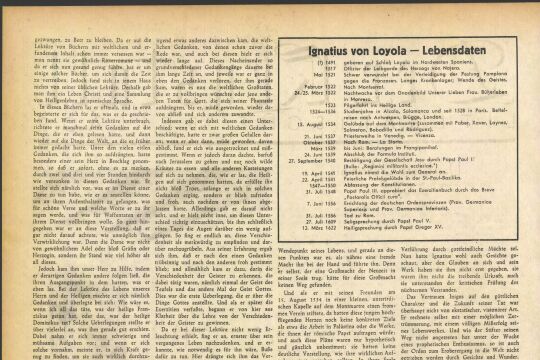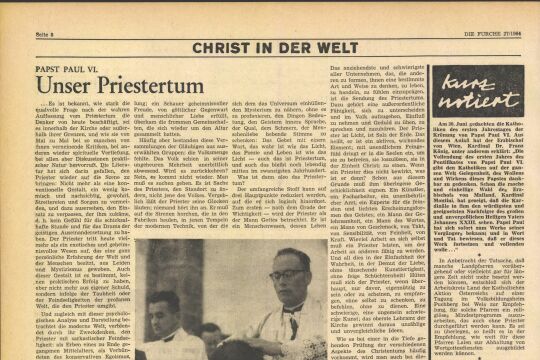Eineinhalb Jahrtausende ist die Kirche alt geworden und es gab — für die Außenwelt — keine Probleme der priesterlichen Existenz. Nicht nur deshalb, weil jene Jahrhunderte nicht Probleme, sondern „nur“ Wahrheiten und Gründe, Tugenden und Laster, Gutes und Böses, Tatsachen und ihre Darstellung kannten und jedes Wieso und Warum in einem indiskutablen Ordo seinen unverrückbaren Ort hatte. Selbstverständlich gab es Probleme der priesterlichen Existenz, und das in schwerer Menge. Jede Kulturgeschichte weiß davon. Aber als jene Geschichte Gegenwart war, war nichts davon problematisch. Der hierarchische Ort und die gesellschaftliche Stellung des Priesters war so selbstverständlich wie seine sakramental gegründete Macht. Heiligkeit und Versagen, Sünde und Buße waren keine „Probleme". Die psychologische Durchstöberung der menschlichen Handlungen kannte man nicht. Was der einzelne tat, wurde nach einem durchsichtigen Modell der Seele und nach der jedem klaren sittlichen Ordnung gewertet. Priesterromane waren vor 1800 unvorstellbar, und wo ein Priester bis zu dieser Zeit in der Literatur auftauchte, hatte er seine vorgegebene „Rolle". So noch als Alessandro Manzoni seine „Verlobten" und Wilhelm Meinhold seine „Bemsteinhexe“ schrieb.
Erst mit der innerpolitischen Selbstbestimmung nach 1848, die über den ganzen Kontinent hin die seit der Französischen Revolution fällige Neuordnung des demokratischen Staates freigab, wurde nicht nur die Stellung der Kirche zum Staat, wurde auch die Gestalt des Priesters innerhalb der Gesellschaft Subjekt und Objekt im innerstaatlichen Machtkampf. Aufklärung, Fortschrittsglaube, das ganze bürgerliche und liberale Kulturräsonnement der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schleiften auch den Priester, und das mit einer Vorliebe, durch ihre Problematik.
Michael Pf1ieg1er
Es gab auch äußere Anlässe. Die damals noch starke Spannung zwischen hohem und niederem Klerus; die faszinierende Gestalt Wessenbergs und sein Geist, der noch Jahrzehnte nach seinem Tode in einem kultivierten, integren, aber romfremden Priestertyp spürbar war; die Denkschrift süddeutscher Geistlicher gegen den Zölibat, die J. A. Möhler zu dessen Verteidigung aufrief („Der ungeteilte Dienst"), das alles wurde gierig aufgegriffen. Die Zeit, die Welt, diese Welt und ihre Literatur hatten auf einmal eine Priesterproblematik. Das Repertoire der Motive und Gestalten war nicht groß: der von einer frommen oder bußfertigen Mutter ins Priestertum Gedrängte, der dann am Zölibat litt oder zugrunde ging; der dickleibige, genießerische, rückständige, auf sein Dorfpascha- tum versessene Landpfarrer; der sture Fanatiker in Spannung und Kampf mit .dem „aufgeklärten" Priester; der politische Idealist, der am Klerikalismus eines Ordinariats scheitert — das waren die Hauptprobleme, so in den Priestererzählungen Ludwig Anzengrubers, so bei Ludwig Ganghofer, Rudolf Greinz; etwas zurückhaltender, religiöser gesehen, bei Peter Rosegger. Selbst Ferdinand Saar hat seine Vornehme Novelle „Innozenz" — und Maria Ebner-Eschenbach die ihre („Glaubenslos?"). Viele literarisch wertlose Romane, denen es um den Skandal ging oder denen es die Ehelosigkeit des Priesters angetan hatte, wie E. Marriots „Der geistliche Tod", bleiben ungenannt. Auch dieser liegt durchaus im Niveau der E. Marlitt und E. Werner. Selbstverständlich auch die Romane der katholischen Apologie, die jene richtigstellen wollten.
Wirkliche Größe haben einige Romane nach der Jahrhundertwende, in denen die menschliche und geistliche Schönheit des Priesterberufes, vor allem das Pfarreridyll, strahlend aufleuchtet. Freilich ist die Sonne, die über diesen stillen Pfarr
höfen und -gärten steht, schon die eines friedlichen Abends. Eine leise Trauer dämpft das Leuchten. Ein Bild wird gemalt, das und weil es im Vergehen ist. Hier haben die Flamen das Beste geschenkt, Ernst Claes mit seinem „Pfarrer aus dem Kempenland", Anton Coolen in „Brabanter Volk" und Felix Timmer
mans im „Pfarrer vom blühenden Weinberg", der trotz aller Güte und Weinmystik nicht sieht, wie neben ihm seine Nichte an einem seelischen Leid'zugrunde geht. Hieher zählen auch die Romane des Iren Sheehan L. Mathars „Herr Johannes“. Helene Haluschkas „Der Pfarrer von Lamotte"; auch H. Federers „Jungfer Therese“. Alle aber überleuchtet das Gedicht in Prosa „Der Pfarrer von Ozeron“ des flämischen Lyrikers Francis Jammes.
Man braucht neben diese Idyllen am Spätnachmittag nur die Priesterromane seit dem ersten Weltkrieg legen und man erschrickt über die völlig veränderte Situation. Ihre Zahl ist ungeheuer gewachsen. Und das ist, trotz allem, etwas Erfreuliches. Der Priester steht wiederum im Mittelpunkt des geistigen Interesses. Christen und Heiden kommen um ihn nicht herum. Er stellt sie und wird von ihnen gestellt. Alle Scheinproblematik des vorigen Jahrhunderts ist versunken. Der Priester als Priester stellt die Welt und sie ihn. Seine Existenz und die ihre stehen einander gegenüber. Aug in Auge. Unausweichlich. Er hat an sie und sie an ihn letzte Fragen. Warum jetzt?
Es hat sich auch sonst vieles begeben seither.
Der philosophische Existenzialismus ist, von seiner sonstigen Zeitbedingtheit und Dynamik abgesehen, ein Rückschlag gegen zwei Versuche, den Menschen mißzuverstehen. Er stand und steht auf gegen den philosophischen Idealismus, der den leibhaftigen Menschen, wie er ist und lebt und leidet und stirbt, als Ideal malte oder zu einer Idee verblaßte, die nichts anderes sei als ein Durchgangsstadium des absoluten Geistes auf einem Weg, an dessen Ende der reine Begriff des Allgeistes steht; und ist wiederum ein Rückschlag gegen den Materialismus und Positivismus, der den Menschen als ein Stück Natur nahm und alles abstrich, was jenseits der Triebwelt und der lückenlosen Kausalkette der Natur hinaus liegt.
Diesen Mißverständnissen entsprechen in unserer Literatur einerseits Idealbilder des Priestertums, spannungslose Schattenrisse in die Wolken, im Einklang mit allen Primizpredigten, meist orientiert an der ersten aller Idealzeichnuncyen des Priesterberufes, nämlich der Schrift des hl. Johannes Chrysostomus „Ober das Priestertum", aber uneingedenk der existenziellen Not, aus der sie der Hjeilige geschrieben hat.
Und ebenso war der Priester mißverstanden von jenen, die nur das 'Einzelschicksal sahen und das noch dazu aus einer naturalistischen und darum, durchaus unsachlichen Vorentscheidung heraus. Sie sahen am Priester nichts als den Zeloten, den Intriganten, den aufgeklärten Menschenfreund oder den stieren Fanatiker, den entmenschten Asketen oder den an seiner Einsamkeit Gestrandeten.
Diese Literatur ist von der 'gegenwärtigen einfach weggewischt, tier Priester wird in seiner priesterlichen. Existenz gesehen, gleich, ob ihn Skeptiker oder Christen sehen. Denn, und das fist wieder bezeichnend, diese Schriftsteller sind fast ausschließlich Laien.
Was sehen sie?
Die liberale Distanz und die billige Kritik und Polemik ist vyeg. Der Priester wird in seiner objektiven Größe und in seiner subjektiven T ragik erkannt, am aufregendsten in Graham Greenes „Die Kraft und die Herrlichkeit", in Dirk Ouwendijks „Das geschändete Antlitz". Und es ist wohl kein Zufall, daß Natha-
niel Hawthornes „Der scharlachrote Buchstabe" nach hundert Jahren Vergessenheit wieder neu aufgelegt wurde. (Hier handelt es sich um einen puritanischen Prediger.)
Diese Welt weiß, daß der Priester unausweichlich gesetzt ist zum Fall oder zur Auferstehung, daß er notwendig den törichten Heiden eine Torheit und den engstirnigen Gesetzes- erfüljern, den geschmeidigen Gesellschaftsmenschen, den Intriganten, den ambitionierten Denunzianten ein — vielleicht verwünschtes — Ärgernis ist und sein muß. Das Gewaltigste hat in dieser Hinsicht wohl George Bernanos in seiner „Sonne Satans" und Henri Gheon in „Die Spiele der Hölle und des Himmels" geschrieben, auch Emile Baumann „Der Exkommunizierte" muß hier genannt werdten.
Diese ganze Literatur ist ein Gericht über den „bürgerlichen Priester", den, der zuerst sein Gehalt und die politische Sicherheit will, und dann die Pflichten übernimmt. Der damit notwendig in seiner Existenz zu einem Kompromiß Wird, das seinem ihm eigenen und wahren Wirken den Boden, entzieht. Die größtp Klage und Anklage in diesem Sinne sind, bei allen Vorbehalten, die man anmelden muß, Bernanos „Die großen Friedhöfe unter dem Mond". In seinen Spuren Robert Morel, vor allem in seinem „Sonntag der Satten".
Dei| härteste Vorwurf gegen die Kirche in dieser Literatur ist die Gestalt Doktor Moosthalers in Stefan Andres' „Tier aus der Tiefe", obgleich man bei diesem Dichter den echt katholischen existenziellen Ernst der genannten Franzosen vermißt.
Allgemein ist der Ruf nach dem heiligen Priester. Ob nach dem Vorbild des heiligen Pfarrers von Ars (Bernanos „Tagebuch eines Landpfarrers", oder sein Kaplan Donissan in der „Sonne Satans", oder Don Carlo Andreini in Carlo Coc- ciolis „Himmel und Erde", oder der Father Smith in Bruce Marshalls „Die Welt und das Glück"); oder geformt nach dem Bild des hl. Franz von Sales (Bischof Latout in Willa Cathers „Der Tod kommt zum Erzbischof"; der Abbe de Dönges in der „Satanischen Trinität" Dirk Ouwendijks, oder in der großen Gestalt Fermoyles im „Kardinal“ von H. M. Robinson). Die kleine Novelle Franz!Herwigs „Sebastian von Wedding" schuf den dritten Typ des hier ersehnten Heiligen. Sie wurde vor fünfundzwanzig Jahren von der Jugend wie eine Fahne erhoben. Und sie hat in der „Mission de Franci", ferne allem Literarischen, eine
richtig existentielle Erfüllung gefunden. Obgleich auch sie bereits — die französischen Romanciers halten, mit der Stoppuhr am Armgelenk, Schritt mit der Zeit — ihre romanhafte Darstellung hat in G. Cesbron („Les Saints vont en Enfer", Paris 1952). Die Arbeiterpriester selbst lehnen sie scharf ab. Sie haben kein Verlangen nach Propaganda und noch weniger nach Mißverständnissen.
Was diese gegenwärtige Welt wieder, wenn auch unter Widerstreben, oder gar unter Flüchen, zum Priester treibt, ist das
heimliche oder offene Erlebnis der Gefährdung und der Angst. Wir werden abgetrieben wie nach einer Wetterkatastrophe und niemand will daran denken, wo wir enden werden. Und keiner kann es abwehren, daran denken zu müssen. Und mag das Sichtreibenlassen und das Gleiten noch so wohlig scheinen, es geht einem Abgrund zu. Dieser Mensch sieht im Priester nicht nur einen Halt, er sieht — und das ist für ihn packender — in seinem Los exemplarisch die freie Übernahme des Risikos und der Gefährdung; und will daran, wie er beides entschlossen bewältigt, selber Mut fassen. Darum ist ihm alle Einweltlichung und alle Halb- schlächtigkeit am Priester verhaßt, weil er in diesen sich selber wieder findet und findet, wovor er selber fliehen will.
Er will nicht den weltgewandten Beamten Gottes, denn er selbst erlebt das Einschläfernde einer Flucht in die Lebenssicherung. Das Ganz-andere, das er sucht, ist weder die ganz andere Sprache, noch andere Geste, und nicht die Zeitlosigkeit eines Ausdrucks mit dem Rücken gegen die böse Zeit. Robert Morel ironisiert den Pfarrer Tolerable (im „Sonntag der Satten"). Seine Kapläne planen die Zel'e- bration mit dem Antlitz zum Volk. Aber ihr Pfarrer ist dagegen. Er will weiter — mit dem Rücken zum Volk beten und leben. Alle salbungsselige Geruhsamkeit und Würde erbittert ihn. Er will den Bruder, der im Jenseitigen und da allein Anker geworfen hat, und will an diesem Halt seinen eigenen finden. Er sieht im Priestertum eine Berufung in eine innerweltliche Unsicherheit um einer, der einzigen Sicherheit willen. Er will den Priester, der sich verliert, um andere zu retten. Und er hat Verständnis dafür daß das Ja zu diesem Anruf Gottes ein Ja zu einem Wagnis ohnegleichen ist. (Hat er doch oft zeitlebens ein schlechtes Gewissen, daß er selbst das Ja zu diesem Wagnis nicht aufgebracht hat.) Denn diese Berufung und ihre Erfüllung ist eine Gleichung, die nie auf Null ausgehen wird, nie auf Null ausgehen kann. Die Selbstverwirklichung der priesterlichen Existenz ist ein dauernder Lauf nach einem Ziel, das im Unendlichen liegt. Priesterliche Existenz ist darum immer äußerstes Wagnis, (übrigens nur ein Sonderfall jeder christlichen, ja jeder menschlichen Existenz.) Auch die heiligsten Priester werden immer hinter dem Entwurf ihrer Berufung Zurückbleiben. Der Priester ist gekreuzigt von der Vertikalen der göttlichen Erwählung und der Horizontalen seines armen Menschentums. Und er muß ausharren von der sechsten Stunde bis zur neunten, Zeit seines Lebens. Und nur in diesem Ausharren wird er gerettet, werden die ihm Anvertrauten miterlöst. Anders gesagt: Der Priester lebt notwendig in einer Spannung zwischen der Heiligkeit seines Berufes und der Armut des Berufenen. An der Zerreißstelle dieser Spannung wachsen nicht nur die großen Heiligen und die großen Apostaten, hier und hier allein ist auch der Ort der Bewährung und der Bewahrung für jeden Priester.
Darum ist der Entschluß, Priester zu werden, immer einer zu einem Leben, das notwendig paradox und heroisch ist. Die Verpflichtung auf die Ehelosigkeit ist die Probe auf ein solches Leben. Und bleibt Wagnis. Dafür hat der Mensch heute Verständnis. Mit dem Finger auf die „Fälle" zu zeigen, wagt er nicht, so-
weit er ehrlich ist. Selbstverständlich ist das 19. Jahrhundert noch nicht ausgestorben und es meldet sich und stellt sich schon bloß im gegebenen „Fall". Aber wir rechnen und reden hier nicht mit Gespenstern, wir reden zum Menschen von heute.
Mit der Übernahme der Weihe entsteht für den Vierundzwanzigjährigen ein Zustand der Endgültigkeit und Unausweichlichkeit. Beides sind wesentliche Existenzielle des priesterlichen Lebens. Das macht die Entscheidung so ernst. Aber gemach! Auch jedes Christenleben kann vor seiner Unausweichlichkeit nicht ausbiegen, und jedem Christen gilt das Wort seines Meisters: „Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist" (Mt. 5, 48): die Verpflichtung auf ein Ziel, das im Unendlichen liegt. Und doch muß jeder den Weg gehen, obgleich er weiß, daß er nie ans Ende kommt und lebte er auch Millionen Jahre. Und wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, und wer es drein gibt, der wird es retten (Mt. 10, 39), gilt für jeden Christen. Das Paradox als Formulierung der christlichen Existenz stammt von unserem Herrn und Meister selbst. Nie werden wir sie besser umschreiben können.
Das rein Menschliche ebenso nicht. Schon die Tatsache, daß jeder, der sich selbst überwindet, sein Leben vollendet; und jeder, der sich auslebt, sein Leben zerstört, kann jeden Ernsten und Einsichtigen vor einem naiven Optimismus und Naturalismus bewahren.
Hier in dieser verborgenen Schicksalsgemeinschaft der priesterlichen Existenz mit jeder, der christlichen wie menschlichen, liegt die heimliche Anziehungskraft des Priesters und die vielleicht uneingestandene Hoffnung der Gegenwärtigen auf den Priester. Der Priester darf
diese Hoffnung nur nicht verkennen. Auch dann nicht, wenn sie anklagt oder widerspricht. Selbst nicht, wenn sie flucht. Der Mensch will nur, und jeder in seiner Weise, mit dem Priester in ein Gespräch kommen, das Offenheit als Ausgang hat, und das jenseits aller beiderseitigen Voreingenommenheiten und — aller Antworten liegt, die gegeben werden, ehe die Fragen gestellt worden sind.
Von dem Verfasser des vorstehenden Aufsatzes erscheint, die in den vorliegenden Ausführungen berührten Probleme in ganzer Breite erfassend, im Herbst ein Buch „Priesterliche Existenz — Versuch einer genetischen Typik“.