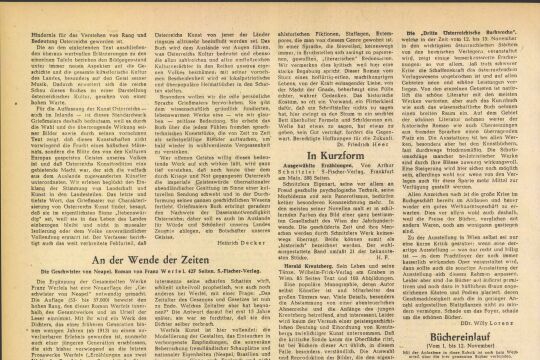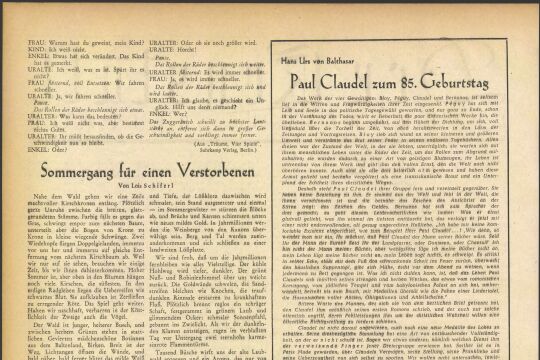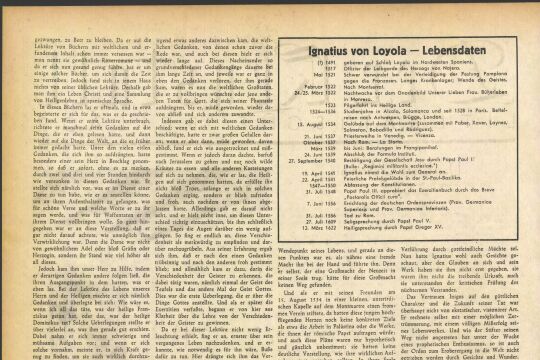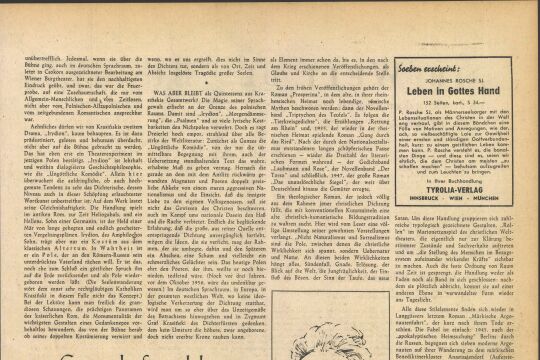Vor zehn Jahren, am Ostersonntag nachmittag, ist Reinhold Schneider in Freihurg im Breisgau gestorben. Durch diesen Tod hat die „Furche” damals einen ihrer aufmerksamsten Leser, einen ihrer treuesten Freunde und einen hochgeschätzten Mitarbeiter verloren. Seit es im Sommer 1946, als Reinhold Schneiders Heimatstadt Freiburg noch in Trümmern lag, möglich gewesen war, eine erste Verbindung mit ihm herzustellen, ist in den Jahren bis zu seinem Tod dieser Kontakt nie unterbrochen gewesen. Sein letzter Beitrag, den er für uns schrieb, „Abschied von Wien”, ist schon nach seinem Tod in der literarischen Beilage „Der Krystall” erschienen. Er beginnt mit den Worten:
„Anfang November, als ich hier ankam, blühten noch bleiche Rosen auf dem Aspernplatz, nun, beim Abschied im März, dunkeln die Schneewolken von Osten her. Das Wetter schlägt um, drei- oder viermal des Tags, und der Wind, der schon das Castrum Marc Aurels umbrauste, ermüdet nie. Man ist Abschiede gewohnt, aber so schwer ist mir selten einer gefallen; wir fahren auf der Straße zum Flugplatz an der riesigen Totenstadt vorüber: Welche Namen, die man unsterblich nennt und die hier von Jahrhundert zu Jahrhundert verhallen! Wie es immer geht: Freunde, die sich verabschieden wollten, verfehlen uns. Ich bin meiner nicht Herr: Ich soll doch wiederkommen, bald, Anfang Juni schon, für die Proben in der Burg, aber mir ist, als könnte ich nie .zurückkehren. Einmaliges ist vorbei, ich kann mich nicht fassen. Und dann fliegen wir, und der Flug ist immer ein Glücksgefühl, fast überschwenglicher Art — und ich blicke zurück.”
Dieser Rückblick auf Wien und Österreich ist Gegenstand des letzten Buches von Reinhold Schneider, „Winter in Wien”, das, wie die meisten seiner Werke, im Herder-Verlag erschien.
Der nachfolgende Essay ist identisch mit dem Text einer Ansprache, die Reinhold Schneider für eine Feier zur 100. Wiederkehr des Todestages von Joseph Freiherr von Eichendorff im Akademietheater vorbereitet hatte. Das Manuskript, das er während seines letzten Aufenthaltes in Wien dem Kulturredakteur der „Furche” schenkte, wird hier zum erstenmal veröffentlicht: anläßlich von Reinhold Schneiders zehntem Todestag und zum Gedächtnis an ihn, von dem geschrieben wurde, daß er unter den christlichen Dichtern der Gegenwart die klarsten Züge und die sicherste Stimme hatte. H. A. F.
Sie werden sich gewiß erinnern an den sangesfreudigen Aufbruch des Taugenichts aus der väterlichen Mühle, an die Frage der schönen Insassinnen der ihm begegnenden Reisekutsche, wohin er denn wandre? Er schämt sich, weil er sein Ziel nicht weiß, weil einfach die Wanderlust — und ein wenig auch der Unmut des Vaters — ihn getrieben haben, und antwortet „dreist”: „Nach Wien.” Natürlich ist das keine Willkür, sondern die verräterische Stimme seiner Berufung: Die Donau, auf der die Schiffe zwischen den Weinbergen hinabfahren, die Türme Wiens eröffnen, begrenzen die Landschaft des Taugenichts und seines Dichters. Die Erzählung wurde in Danzig geschrieben — um dessen beseelte Schönheit und Würde ich die Trauer nicht loswerden kann —, aber was das Herz angeht, in der Wachau, mit dem Blick auf St. Stephan … (Satz nicht weitergeführt.)
Ungeachtet des tragischen Unglücks der Schlesischen Kriege wird man doch Eichendorff, was die formenden Kräfte angeht, dem von Wien durchstrahlten Raume zurechnen müssen. Das Hultschiner Ländchen, am Oberlauf der Oder, wo das Schloß seiner Kindheit, das lebenslang gepriesene, lebenslang betrauerte Lubowitz stand — es kam übrigens erst durch die Mutter in den Besitz der zugewanderten Familie: dieses Ländchen war gegen Böhmen, Österreich,. geöffnet, auch die Erziehung im St.-Josephs-Konvikt in Breslau hatte — nach Josef Nadler — „altösterreichischen Zuschnitt”. Darum wurde Eichendorff aus der „Wendung nach Norden”, die er im späteren Lebenisgang vollzog, der Wendung also nach Ostpreußen, Danzig, Berlin, ein Vorwurf gemacht. Ich will das nicht erörtern; Eichendorff ist immer geblieben der er war. In Ostpreußen hat er das Inbild seiner Weltauffassung gefunden: die Marienburg, von deren Mauer die Jungfrau herrscherlich gen Osten blickt. Eichendorffs Dichtung gründet darin, daß er die Kindheit verlor, daß er das Heimweh nach einer nicht mehr betretbaren Heimat nie losgeworden ist und auch nicht loswerden wollte; daß es ihm gelang, die Klage dieses Heimwehs zur Aussage menschlichen Daseins überhaupt zu erheben.
Im äußeren hängt das — wie bekannt — mit der sozialen Umschichtung zusammen, die von der französischen Revolution ausging. Zwei Erfahrungen erfüllen das Gesamtwerk: Stille der behüteten Natur, der alten Ordnung des Schlosses im Wiesenland und die Bedrohung von der Geschichte her, die etwas Unabweisbares hat und keineswegs mit sentimentaler Klage beantwortet, sondern als elementares Ereignis verstanden wird. In tieferem Sinne bilden diese beiden Erfahrungen ein Ganzes. Vielleicht sind es die Erschütterungen der Geschichte gewesen, die der Naturerfahrung Eichendorffs ihren eigentümlichen Gehalt gegeben haben. Wohl kennt er die Morgenfrische, die den unbeschwerten Wanderer lockt, das funkelnde Erwachen unter dem Schmettern der Lerchen, die Mittagsruhe, in der die Schiffe einschlafen, den Gang der Segensmacht über die abendlichen Felder, den Trost der Nacht: Natur also jenseits der Geschichte — aber am Abend, von irgenwoher, fällt ein Schuß, Schwüle lastet auf den Wipfeln, fern spielen Blitze; es ließen sich unzählige Stellen anführen, die Natur im Gewitterschein sehen, unter dieser Gefahr erst sie auffassen — sofern eben ein Rätsel sich ergreifen läßt. Himmel und Landschaft sind wesentlich Räume des Gewitters. Der Friede wird in dem Bewußtsein erfahren, daß die Welt an ihrem Saume brennt; daß der Streit sich nähert, der den Befriedeten einfordem wird. Es enthüllt sich der zweite Anblick der Natur: Sie ist ein Abgrund wie das menschliche Herz:
Von üppig blühenden Schmerzen Rauscht eine Wildnis im Grund.
Schauer wehen aus der Tiefe; im Zwielicht „besprechen” einander Tier und Baum, unverständlich dem Menschen, den ein Grausen überkommt. Das Wort „besprechen” deutet auf beschwörende, bannende Kraft, auf Magie. Die Natur zieht hinab, das Gold der Erde wird dem Schatzgräber zum Verderben in Ewigkeit. Die Engel fliehen; die dunklen Mächte bereiten ein Schicksal, das sich nicht mehr aufheben läßt. Ängste, so heißt es in einem frühen Sonett, tauschen verworrene Worte mit dem Abgrund bodenloser Nacht. Durch eine jede Nacht sprengt der „Nachtwanderer” auf braunem Roß, gegrüßt von verderblichen Geistern, daher das Aufatmen beim ersten Klang der Morgenglocken, daher wieder und wieder das Gebet: Betend allein hält sich der Dichter zwischen Mächten, immer in Gefahr, an den Rand der Erde gedrängt zu werden; in Gefahr, daß aus der Natur das Chaos hervorbreche und ihn verschlinge. Aber er stellt sich den Blitzen, er jubelt ihnen zu:
Schlag mit den flammgen Flügeln!
Wenn Blitz aus Blitz sich reißt:
Steht wie in Rossesbügeln
So ritterlich mein Geist.
Insofern haben die elbischen Wesen, die weißen Frauen, Botinnen des Untergangs, echte Realität wie die Glaubenswelt Eichendorffs: in ihnen manifestiert sich die Nachtseite der Natur. Dies ist bestimmender Seelengehalt, angeboren sicherlich zu einem wesentlichen Teil und schon in frühen Jahren gestalthaft fortgebildet. Der Mensch ist heimatlos, unbenennbaren Wesen ausgeliefert; die Menschheit wandert viel hundert Jahr und kommt nicht von der Stelle, wie die Ströme in tausend Jahren den Ursprung nicht mehr erreichen. Pfitzner hat diese bedeutungsvollen Verse in großartiger Weise verstanden und musikalisch interpretiert.
Als Eichendorff im Jahre 1810 nach Wien kam, brachte er dieses Lebensgefühl mit; in romantischer Fassung eine Ur- erfahrung des Menschen, die sich ihm in betörenden Klängen löste. Aus diesem Jahre stammt das Gedicht von der „Heimkehr” in die nicht mehr betretbare Heimat, nach Lubowitz also, das Schloß an sich, die herrenhafte Lebensart überhaupt. Er betritt wieder den Hof wie Chamisso den von Boncourt und empfindet einen Schreck, den er bis zum Tode nicht verwinden wird: Seine Ahnen, in ihre Fahnen eingehüllt, sitzen aufrecht in der Stille. Die Schlösser brennen: das ist das Bild, das ihn nicht losläßt, das zu gestalten er sich immer wieder getrieben fühlt, das ihn geradezu verfolgt vom ersten Buch des Romans „Ahnung und Gegenwart” über die grandiosen Schilderungen des Adelsunterganges in Schloß Durande bis zu den Altersdichtungen. Die Schlösser brannten ab; sie werden nicht wieder errichtet werden. Endgültiges ist geschehen; Zukunft ist eine neue Bestimmung. Noch sucht die Familie Lubowitz zu halten: es soll nur bis 1823 möglich sein. Alles kommt nun darauf an: das Schloß in der Seele zu erbauen, das heißt in ritterlichem Geschichtsbewußtsein in die Welt zu treten und Adel von innen her zu bewahren.
In Eichendorffs ganzem Werk handelt es sich um einen Daseinswert, der wohl in tiefem Zusammenhang mit dem Lebensgange steht, aber keineswegs von diesem her aufgeschlossen werden kann. Sein Herz wird sich nur durch Wirrnisse im Feuer der Versuchungen zum Glück der Ehe hindurchgefunden haben; aber sein Liebesgefühl blieb überschattet, zum Tode geneigt, mit Schuld und dem Vorwurf der Untreue verschwistert, zur Klage gestimmt, die der Sentimentalität nicht immer entgeht, bis das Erschauern vor der dämonischen Frau, die mit kalter Hand dem Liebenden das Herz aus der Brust holt, jegliche Verschwommenheit, jeglichen Selbstgenuß des elegischen Gemüts vertreibt. Die Wahrheit von Joseph von Eichendorff ist sein Gedicht. Lebenslauf und Dokument spinnen sich verschleiernd darüber.
Es war um 1810 eine große Zeit Wiens, bewegt von der Einsicht, daß nur aus der gelebten Existenz hoher Werte Selbstbehauptung geleistet werden kann. Die sich hier zusammenfanden, bildeten eine geistige Macht, die das Wesen Europas im Widerstand gegen die sie überfremdende Gewalt in einer neuen Gestalt vertrat. Geschichte bleibt Mysterium: Wir können die Herausforderung des Korsen so wenig entbehren wie die der Hunnen, Hussiten und Türken, der Ungarn Kossuths vom Oktober 1848 und die vielfältigen, von außen wie von innen, von einander entgegengesetzten Richtungen angreifenden Gefahren unserer Tage. Das ist uralte Erfahrung: schon Jeremia bat seinem widerwilligen Volke gesagt: Babels Leben ist euer Leben (Volz, Prophetengestalten, 1938), Nebukadnezar, Euer Feind, ist Gottes Knecht. Und verdankt nicht die Ära Maria Theresias ihren hellen metallischen Klang den Sorgen und Kämpfen, die das glorreiche Matronat verdüsterten? — Unter solchen Anfechtungen hat Wien von Jahrhundert zu Jahrhundert zu sich selbst gefunden, zu einer neuen, einer oft höheren Gestalt seines Wesens und seiner Bestimmung. Eine religiöse Strömung hatte um die Jahrhundertwende die josephinische Ära überflutet; Bestimmungen lösen einander ab; ich habe es hier nicht mit Bewertungen zu tun und würde sie auch nicht wagen. Der Josephinismus kann leichter verurteilt als verstanden werden. Eichendorff, von seinem Bruder begleitet, mit dem er auf eine ergreifende Weise verbunden war, begegnete im Kreise Friedrich Schlegels Clemens Maria Hofbauer, er trat, natürlich nicht unvorbereitet, in das Kraftfeld vielleicht allzu hoffnungsfrohen und etwas schwärmerischen, aber doch mit der Verheißung der Erneuerung ausgezeichneten Denkens. Das wichtigste aber: das Bild der Geschichte, trug er als Erbe wie Erkenntnis in seiner Seele, bildete sich aus seinem Innern heran im Wechselgespräch mit der Epoche, in die sich hineinzuwerfen er entschlossen war. Was ihn schützte, ihn schützen mußte, war das Schloß im Herzen, die durch das Feuer getragene, aber nicht mehr akzentuierte adlige Form.
So ist in Wien seine wesentliche Aussage, sein Roman „Ahnung und Gegenwart”‘, entstanden; Dorothea Schlegel, Tochter Moses Mendelssohns, hat das Werk mit dem genialen Titel getauft. Er ist der Roman Eichendorffs, sein einziger; alle Motive treten hier auf. Er kann sie variieren und ausbauen, wandeln oder abwerfen kann er sie nicht. Eros und Verwirrung, die hier sich aussagen, verbirgt er in den folgenden Jahren unter rühmloser entsagungsvoller soldatischer Zucht, unter der nüchternen Gewissenhaftigkeit des Staatsdieners, strenger Bürgerlichkeit. Der Gegensatz zwischen dem Spielmann, der sich in der Fremde verliert, in ihr, sich zu Tode sehnt nach dem Vaterland und dem Oberpräsidialrat, Regierungsrat, Geheimrat, Dezernenten für katholische Kirchen und Schulwesen am Ministerium in Berlin, kann nicht härter sein. Den Verführungen des Empfindens, fesselloser Sehnsucht setzte der im Leben, in der Geschichte Gereifte ein unbeirrbares Ethos der Lebensführung, peinliche Loyalität gegenüber. Aus solchen Kämpfen und dem Durchleben des Zeitalters leuchtet schon früh das berühmte Bild der Geschichte auf, das „Ahnung und Gegenwart” krönt, „Im Kampfe sind wir geboren, und im Kampfe werden wir… untergehn”. Verloren ist, wen die Zeit unvorbereitet und unbewaffnet trifft. Aber auf den ungeheuren Kampf, dem Wandel der Gespenster und Sirenen, dem Vorübergang der Gewitter ruht eine Verheißung: Wunder werden zuletzt geschehen; die weiße Taube wird sich herniederlassen. Es ist eine prophetische Vorstellung, die für des Dichters Lebenszeit bis über das Jahr 1848 hinaus, für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, ausreichte, die auch weiter zu weisen scheint und, was die Metaphysik der Geschichte betrifft, den Streit transzendentaler Mächte in Völkern und Zeiten, nicht zu entkräften ist. Ehre der Zuversicht Joseph von Eichendorffs! Er konnte nach dem unversöhnlichen Konflikt mit dem Minister (1844) nach Schlesien, nach Neiße, sich zurückziehen; nach der herben Enttäuschung der Restauration erschien ihm das Los des Hohen, des Ritterlichen immer düsterer. Etwas von der Sieghaftigkeit des Kindes, das allein ins Himmelreich gerufen ist, hat er sich dennoch gerettet.
Er überflog seine Epoche, wie viele Irrtümer seiner Zeitgenossen. Er hat im letzten Recht behalten — weil eben Glaube im Rechte bleibt. Uns ist, sofern wir uns in Eichendorffs Sinne der Gegenwart stellen, wohl noch schwerer ums Herz als ihm. Denn die Gewalten, die uns zu regieren scheinen, hat auch er nicht gesehen. Stifter erkannte — schon im „Nachsommer”‘ —, daß in jenen Jahren die Naturwissenschäften zum „Gewicht der Weltuhr” werden. Lenau hat das als geistiges Schicksal erfahren.
Ich möchte, um unsere Schwierigkeit vor seiner Aussage zu bezeichnen, zum Schluß hinweisen auf den Wald und auf das, was er für den Dichter bedeutete, er ist Anfang und ersehntes Ende, Ort des Gelöbnisses, unverlierbare Heimat des in die verirrte Welt Verschlagenen, Ziel: wenn der Wald, Zeuge sittlichen Vorsatzes über das Grab rauscht, so ist der Kampf nicht verloren; das Rauschen des Waldes, dem das Ohr zugeneigt bleibt, ist Weisung auf den Straßen der Stadt, im Kriege, in wachsender Verwirrung; Weisung in der Kunst. Unsere Wälder sind nicht mehr, was sie für Eichendorff waren — oder für Stifter: sie wurden geplündert und von der Forstwirtschaft rationalisiert, deren Nützlichkeit gewiß nicht abzustreiten ist. Aber ein mißhandelter Wald ist eine schlimme Wunde am Körper der Welt. Für Eichendorff wie für Hölderlin gab es noch Ströme; wir haben Stellwerke und Abzugskanäle daraus gemacht, in denen die Fische sterben. Wir mußten das wohl. Ich stelle ohne Vorwurf fest: das ist unser Weg. Und wem unter uns weht noch der Schauer aus den Abgründen der Schöpfung, des Herzens und Geistes an, der Joseph von Eichendorffs Melodie gewesen ist? Was sagen uns die Schlösser, die der Blitz verzehrte?
Und doch bleibt das immanente Ethos seiner reinen Erscheinung. Eichendorff hat es entschieden abgelehnt, die Kunst einer Pragmatik, zu unterwerfen; wenn er auch den Glauben ausdrücklic hzum Richter über das Saitenspiel erhob. Sittlichkeit wie Glaube durchbluten absichtslos seine Gebilde; sie können nur überzeugen, weil sie da sind, nicht weil sie wollen. Was ist nun seine Kraft? Es ist der Segen, der mir, einem Vorüberwandemden, auf Österreich zu ruhen scheint; den er, ein in den Norden Versprengter empfunden und empfangen hat — mit allen Gefahren, die sich an eine Segensmacht ketten. Hier in der Stadt seiner Jugend, in einer „Luft voll Segen”, wie schon ein Vers des 13. Jahrhunderts von Wien sagt, sammelten sich, unter Napoleons Herausforderung Geistes- und Herzensmächte, festigte sich die Sitte, um tyrannischer Dämonie ins Antlitz zu widerstehen, und zwar mit der gefährlichsten Waffe: der Existenz, die genau das -ist, was sie sein muß, nicht um eines Haares Breite mehr. Sitte bedeutet Sein; wenn sie das nicht bedeutet, so ist sie nicht. Eichendorffs Heimat ist verloren, und wer gräbt noch nach den rauchgeschwärzten Steinen verschwundener Schlösser? Wer sucht Lubowitz, die Burg „Frag mir nicht nach?”. Wie die aus den Flanken Polens gerissene Beute ermangelte die Eroberung Friedrich des Großen der Beglaubigung. Der Dämon hat sie gebilligt, der Genius nicht Aber hier — das könnte doch der Sinn dieser bescheidenen Feierstunde sein —, sucht Joseph von Eichendorff seine Heimat; er hat nie eine andere gehabt; er ist Österreicher gewesen im Sinne der Menschlichkeit der Macht, die ihm vorschwebte, des Einklangs imperialen Auftrags mit Humanität, aber auch aus künstlerischer Verwandschaft; mit Recht hat Rudolf Bach die Konzeption Eichendorffs mit der Mozarts verglichen. Ritterlicher Geist, der von jeglicher Belastung des Standes und Besitzes frei geworden ist, der jegliche Möglichkeit der Fesselung abgestreift hat und sogar die Chance, noch verlieren zu können, hinter sich ließ, bittet um Herberge, in ihrem Dasein und Denken.
Eichendorff hat sich immer als Pilger empfunden und gerade diese Pilgerschaft hat ihn mit den ergreifendsten Liedern, den bedeutendsten Bildern, mit seiner Voraussicht beschenkt, wie es ja auch dem Propheten verboten war, sich gefangen zu geben in Haus und Hof; wie der Prophet einen Acker nur erwerben durfte zum Zeichen seines Gehorsams, auf verlorenem Grund. Wir erkennen, was wir verloren haben. Vielleicht behaupten wir uns wirkend in der Zeit, wenn wir wissen, daß sie uns Letztes nicht nehmen kann, weil dieses Letzte eben wir selber sind — über die Untergänge Die letzte Seite des Manuskripts von Reinhold Schneider hinweg. Er ist die Burg unseres Selbstbewußtseins, das in waldumrauschter Morgenfrische abgelegte Gelöbnis. Der früh aus seiner Umwelt Vertriebene, der — irdisch gesprochen — unsterbliche Pilger, sehnt sich, wie ein jeder Wanderer, nach Obdach. Er möchte seinen Wohnturm — gleich dem unversehrten Turm in der Griechengasse — aufbauen in ihren Herzen, in der Geschichtlichkeit, in der Existenz, die hier, und vielleicht mir hier, noch möglich ist; hier, wo von Jahrhundert zu Jahrhundert ihm höchst ehrwürdige, von ihm geliebte Daseinsform sich duldend und überwindend und ver- zichtend-lächelnd mandfestierthit