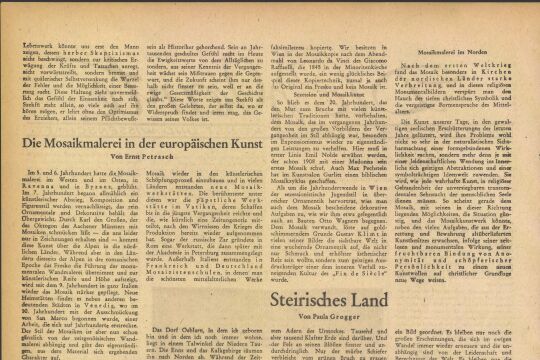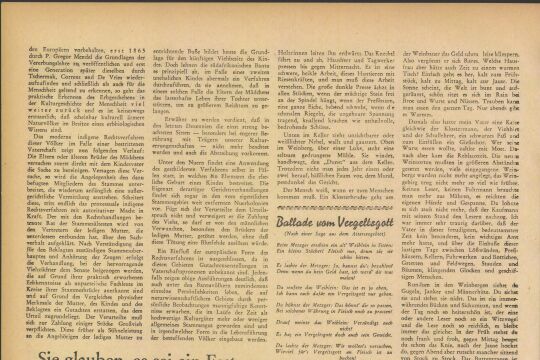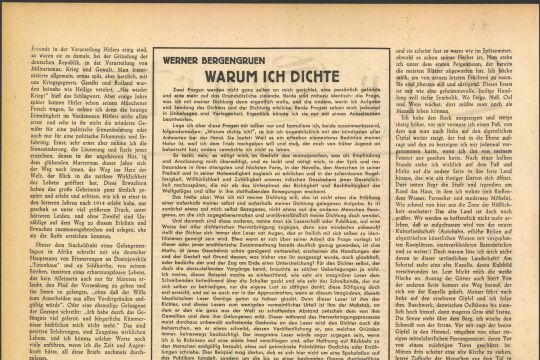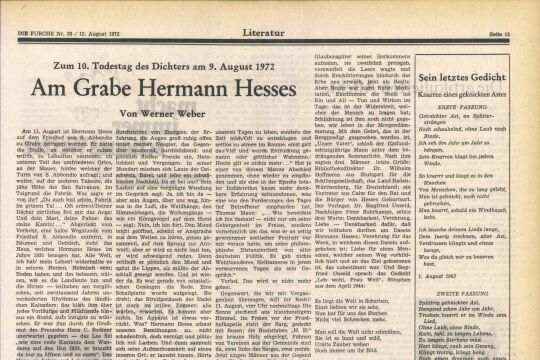Nun geht mein Autobus ab, und wir fahren durch Stammersdorf die Steigung der langen Kellergasse aufwärts. Der letzte Heurige an ihrem Ende liegt mitten im Weingarten; die Tische und Bänke, leer in der Morgensonne des Feiertages, werden von dichtstehenden Weinstecken bedrängt, günstig „zum Anhalten“ für Taumelnde... Wir kommen ins Freie. Beiderseits Akaziengebüsch, die Weinriede schützend, welche sich in ihrem Tauglanz links zum Bisam-berg sehr sanft hinauf und rechts zum tiefsten Teil des Marchfelds sehr sanft hinabziehen. Mitten in der flimmernden Weinflut eine Haltestelle an einem kreuzenden Hohlweg, und in seinem Schatten lagern ein paar Winzerinnen beim Morgen-trunk.
Ist hier nicht — als schöner Jüngling Joseph — Eichendorff gewandert? Hochgewachsen, schlank, mit feurigen Augen, dichtem, dunklem Lockenhaar und einem nach der Mode kokett ausrasierten Schnurr-bärtchen, ä la Frajo, lebhaft und unterhaltsam, weitgereist, katholischgläubig und zu hohem Geistesflug bereit: das romantische Idealbild eines beliebten, toleranten und selbstbewußten Edelmannes. Der Jüngling war zweimal in Wien gewesen: das erstemal, als er zu Schiff von Regensburg die Donau herabgekommen, , nur kurz, das zweitemal blieb er anderthalb Jahre, vergeblich eine österreichische Staatsstelle erstrebend. Aus den lange nach seinem Tod aufgefundenen Tagebüchern und Briefen dieser Zeit wissen wir von einer Notiz des Dreiundzwanzig-j ährigen vom 16. September 1811:
„ ... nahmen wir (mit meinem älteren Bruder Wilhelm) um halb 7 Uhr früh ein deutsches Frühstück bei Ta-roni, versahen uns wohl mit Pflaumen, wanderten durch die Leopoldstadt etc., vereinigten uns durch eine Menge Fuhrwagen, ganz mit Stäub bedeckt, hinter der ungeheuerlichen Taborbrücke mit dem treuen Diener Schopp, der vorausgegangen war und Wäsche etc. im Tornister trug, und wanderten darauf nach einem uns vom Portier mitgegebenen Wegweiser bei dem schönsten Herbstwetter auf Fußwegen über Berg und Tal mit den schönsten Aussichten schmauchend und lustig fort. Auf dem Berge, wo man Wien aus den Augen verliert und sich die einsame Aussicht auf das jenseitige Thal eröffnet, labten wir uns an einem Hut voll Weintrauben, die wir von einigen Weibern in den Weingärten wohlfeil gekauft. Vor 12 Uhr kamen wir auf die letzten Höhen über Stätten, wo die prächtige Aussicht auf das Donaugebirge und unten auf Seebarn ...“
In Seebarn hinter dem Bisamberg wartete ihrer die Gastfreundschaft heiterer Komtessen im Schloß des jagdlustigen Grafen Wilczek, in dessen Wiener Palais in der Herrengasse die Brüder wohnten. Eichendorff erwähnt auch Stammersdorf mehrmals, die „gütliche Labung“ im „Lustigen Wirtshaus“. Es ist das alte „Post-Rendezvous“ dort unten an Straße und Eisenbahn, wo einst die erste, inzwischen aufgelassene Bahnhaltestelle war; heute gedeiht das modernisierte „Rendezvous“-Gast-haus, jetzt von uns aus gut sichtbar, vom Autoverkehr auf der Brünner Straße auch nicht schlecht. Und Eichendorff erwähnt auch die frischgepflanzten Eichenwäldchen. An ihnen vorbei, die seither zu hohem Wuchs aufgeschossen sind, fahren wir im Autobus weiter.
So komme ich wieder nach Hagenbrunn und zu Fuß westlich zur Sankt-Veits-Kirche. In dieser Sicht vom Oktober, dessen Neubauten in Richtung Kirche vordringen, erscheint sie gar nicht so vereinsamt, wie ich es gestern, vom Wald herunterkommend, so schön erlebt hatte. Schon von weitem höre ich Orgelklang und Chorgesang: „Drum geloben wir“ aufs Neue / Jesu Herz, dir ew'ge Treue.“ Als ich eintrete, finde ich sie voll von festlichen Gläubigen und Weihrauchdüft.
Auf halbem Weg nach dem nahen Klein-Engersdorf halte ich, gegen meinen Schwindel kämpfend, Rast 1 unter drei uralten Linden, die mitten in den Feldern stehen, und genese allmählich an der kühlen Ostbrise und den vorbeiziehenden hübschen jungen Mädchen, Heimkehrerinnen aus der Kirche. Ihre modische Aufmachung hat allerdings auch das Geisterhafte einer Zwischenwelt: das Abscheiden des Regionalen unter Gleichmacherei.
Dann in Klein-Engersdorf selbst, auch ein Weinort mit viel „Aus-g'steckt“, besuche ich Schuldirektoi Ludwig Pobers Haus, Garten, Alpinarium und sein Heimatmuseum, Schuldirektor Pober weiß auch alte Sagen zu erzählen: von der Sommereiche auf dem Bisamberg, die jedes Jahr ihre alten Blätter bis zum Hervorsprießen der neuen im Frühjahr behielt, weshalb der dumme Teufe] seine Wette verlor, als ihm ein schlauer Bauer im Herbst seine Seele versprach „sobald die Eiche keine Blätter mehr hat“; vom „64er Wald“ bei Stammersdorf, der heute noch so heißt seit jener Zeit vor vielen, vielen Jahren, da Stammersdorf nur 64 Einwohner hatte; von den zahlreichen Bildstöcken, die ich auf dem Weg nach Seebarn und Manharts-brunn treffen werde, Steinsäulen, welche den nächtlichen Marktgängern nach Wien den rechten Weg leiten sollten, damit sie nicht zu Opfern der mitternächtig lockenden Hexen und Spukgeister würden.
Und weiter führt mich, an ungeheuerlichen „Erlkönig“-Weiden-stümpfen vorbei, die nächtliche Visionen begünstigen, der einsame Pfad sanft zur Wiesen- und Felderhöhe des Tradenberges empor. Dort oben, wie eine Erlösung aus dem schwülen Grund, „geht der prächtige Rückblick auf das Donaugebirge“, wie Eichendorff sich ausdrückt. Aber mich entzückt im Vorausblick die Anmut eines Tales, das sich genau Östlich hinaus zur Marchfeldebene senkt. Ich lasse das Tal rechts unten und erreiche später einen Querkamm, wo ich an einer mittagheißen Kieferanpflanzung ausgiebig Rast halte, hinabschauend auf einen romanischen Kirchturm, den abwechselnd Sonnenstöße treffen und Wolkenschatten flecken. Das ist Königsbrunn, und im Weitermarsch komme ich gerade vor die Kirche hin. Schöne < neue Anlagen umgeben sie, darin soldatenspielende Halbwüchsige aus Kindergewehren herumschießen, das einzige Leben hier. Königsbrunn selbst und alle folgenden Orte, die ich durchstreife, liegen in ihrer kalkgrellen Feiertagsstille wie ausgestorben da.
Sie kommen mir durcheinander, diese vielen weithin verstreuten Dörfer mit den schönen Namen, die auf -feld und -brunn endigen, wo die Hügelwellen sanfter noch, die Tälchen dazwischen flacher werden. Aber auch in der Einebnung öffnen sich überraschend verwilderte Graben, gelbe Riesenblumen wuchern aus feuchten Lößgründen zwei-mannhoch auf. Hecken, ineinander-verfilzt, teilen die fruchtbare Felder-, Obst- und Weinlandschaft in grün-und-braune Streifenmuster, die gleichlaufend bis an den fernen Horizont fortstreben und all die Gefilde übersichtlich ordnen. Und die — mir angekündigten — Bildstöcke, Andachts- und Ruhepunkte, diese weißblendenden Leuchttürmchen, darauf wie Brandung die Schatten der Halme tanzen.
Auf einmal liegt in einem stillen Grund ein dichter Hain vor mir, der Dorf und Schloß umfaßt: beides, Dorf und Schloß, sieht man fast nicht vor lauter Bäumen. Es ist ein einziger alter Park. Eine majestätisch ragende Pappelallee verkleinert sich perspektivisch langhin auf ein Schloßportal zu, das hell und winzig wie eine Perle am Grund dieser dunkelgrün glühenden Muschel ruht. Das ist Seebarn — lese ich an der Ortstafel — und das ist Schloß Seebarn. Ist es nicht jenes ländliche Eichendorff-Schloß, das dem Dichter des „Taugenichts“ und diesem selber zum Vor- und Inbild wurde, auch heute noch sonneleuchtend und mit grünen Fensterläden wie am Anfang und Ende der Novelle, die Vorbereitung des Umschwunges und schließlich der Umschwung selbst?
Alles ist da: „dicht am herrschaftlichen Garten ging die Landstraße vorüber, nur durch eine hohe Mauer von demselben geschieden“ — heute eine Seitenstraße und, obwohl mit schönem Klinker sorgfältig gepflastert, unberührter als vor hundertfünfzig Jahren zur Biedermeierzeit, da die Geschichte vom Taugenichts spielt. Auch gehört das Schloß noch immer den Wilczek, die feudale Stimmung ist geblieben, die derbe Bruchsteinmauer, von wildem Efeu überwuchert, ist allerdings niedriger geworden. Den sanften Serpentinenschwung begleitend, immer nur kurz vorausblicken lassend, was den Reiz erhöht, zieht sich die Herrschaftsparkmauer genau so lang hin — einen halben Kilometer — wie der Ort selbst, und auch diesem sind längs der andern Straßenseite die ebenerdigen Häuschen verblieben und das einzige kleine Wirtshaus. Nichts ist verdorben, alles noch so wie es Eichendorff gesehen hat. Im Wirtshaus höre ich von der „Herrschaft“ reden, als wäre es noch die Zeit, wo „die Bedienten den Herren die Hand küßten“ (wie Eichendorff einigermaßen verwundert bemerkt).
Und auch der Teich im Schloßpark ist noch vorhanden und ein Kahn gleich jenem, welchen der romantische Wanderer ruderte, dieser in alle Damen verliebte, voll naiver Galanterie der Gesellschaft seine Liebeslieder vorsingende Taugenichts, dem „das Herz zerspringen wollte vor Scham und Schmerz“, worauf er sich „in das Gras hinwarf und bitterlich weinte“... In jähem Wechsel ist er „so traurig und doch auch wieder so überaus fröhlich“, dann wird ihm wieder „zum Sterben bange“. So ergeht es ihm „überall und immer“.
Und ergeht es nicht auch mir so ähnlich? Es ist typisch romantisch, dieses Umschlagen in unnennbares Leid, auf jeder zweiten Seite des Taugenichts ausgedrückt oder zumindest fühlbar, das andere Extrem der romantischen Ironie. Die zahllosen Nachahmer Eichendorffs, bis auf den heutigen Tag in Winkelblättern und Heimatbüchern sich suhlend, spüren es nicht oder vermögen es nicht zu verspüren. Nur das Süße, nicht das Bittere wollen sie — und verfallen darum dem süßlichen Kitsch in „reiner Luft“ aufgeplusterter Dichterlinge, ohne zu merken, daß sie im Pleonasmus ihrer Adjektive erstik-ken.
Das geradezu Hamsunsche, um nicht zu sagen Hysterische der Romantik ist ein entscheidendes Ge- ; staltungselement Eichendorffs. Es ist das Irrationale, in der Inkonsequenz Konsequente, kurz, das Märchenhafte. Auf Schritt und Tritt wird i dem Wanderer der gefährliche Über- :
schwang der Romantik ausgetrieben, sozusagen sachlich ausgeglichen, um beim nächsten Schritt und Tritt wieder beseligend da zu sein: so bleibt der Dichter immer in der großen Stimmung der große Stimmungskünstler.
Doch heißt es in Seebarn bleiben, in Seebarn, das mir freilich von Besserwissern korrigiert werden könnte: insofern nämlich, als sie mit Recht darauf zu verweisen vermöchten, der Taugenichts „sah seitwärts durch die Bäume die Türme von Wien“ — was in Seebarn ganz unmöglich ist; desgleichen ist die Rede von Burschen, „nach den Tanzböden in der nahen Vorstadt“ ziehend, und wiederholt von der heraufrauschenden Donau — in weiterer Konsequenz unmöglich, wenn Seebarn das Taugenichts-Schloß sein soll. Es liegt ja viel zu weit von der Vorstadt und den Türmen von Wien entfernt. Gewiß und richtig! Indes ist es ein Verkennen des Dichterischen überhaupt, wenn man von ihm geographische oder gar photographische Treue verlangt: Dichten kommt nicht nur vom lateinischen dicare, sagen oder besser: aussagen, sondern auch vom deutschen Verdichten (was schon in Aussagen keimt). Widersprüchig scheint das Taugenichts-Schloß vor Wien einmal links der Donau zu liegen, sogar weit vom Strom entfernt, wie eben Seebarn, dann wieder, aus anderen Bemerkungen deduziert, rechts nächst dem Strome und der Stadt, ja heute längst in der Stadt, etwa in Nußdorf oder Döbling oder gar ziemlich zentral am Rennweg, vielleicht das Schwarzenbergschloß; widersprüchig wie eljen das Romantische, Wunderbare, Märchenhafte, dabei Impressionistisch-Genaue Eichendorffs ist, mit einem Wort: dichterisch. Er selber zieht sich mit einem Kunstgriff aus der Affäre, indem er seinen in Ichform erzäh-, lenden Taugenichts bei der Annäherung an Wien auf dem Wagentritt einfach einschlafen läßt... Er wacht erst wieder auf, als der Wagen in dem Garten des fraglichen Schlosses stillsteht.
Bei all dem darf man nicht vergessen, daß die Novelle viel später, erst 1826, geschrieben wurde, weit von Wien, fünfzehn Jahre „nachher“ in Königsberg, wo sich der zwar in Schlesien geborene, doch in Herz und Seele durchaus süddeutsche und katholische Dichter als Oberpräsidialrat und „so nahe der Schneelinie“ nicht sehr wohl fühlte. Sie ist aus dem Abstand heraus entstanden, aus den der Realität folgenden und durch sie bedingten Traumbildern, sozusagen ähnlicher als das Original. So erfordert es jedes echte Kunstwerk, Und so haben es auch Stifter im „Hochwald“, ebenso „nachher“ in Wien geschrieben, und Daudet in seinen „Lettres de mon moulin“, später in Paris geschrieben, gehalten. Eichendorff gestaltete seine Sehnsucht nach Wien, die Erinnerung an seine schönste Zeit. Darum, aus diesem örtlichen und zeitlichen Gegensatz heraus, wurde es ja auch eine so südliche, so mozärtliche Biedermeiernovelle und ein Hoheslied auf Österreich.