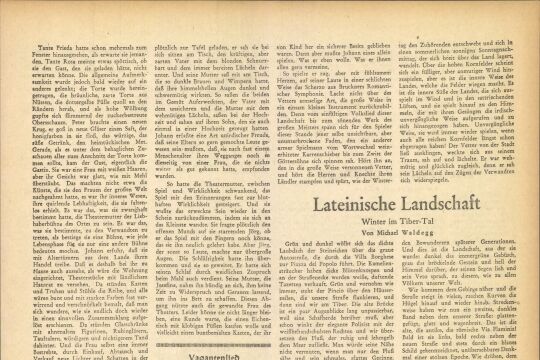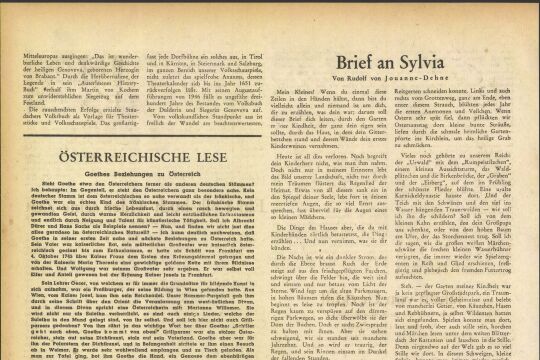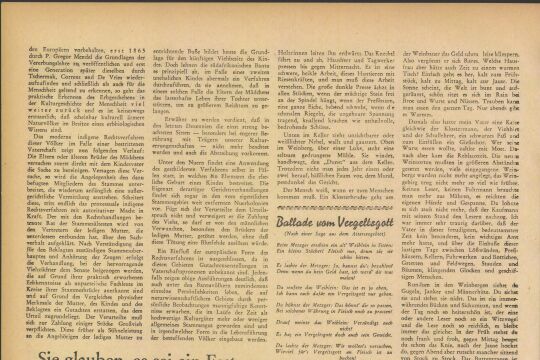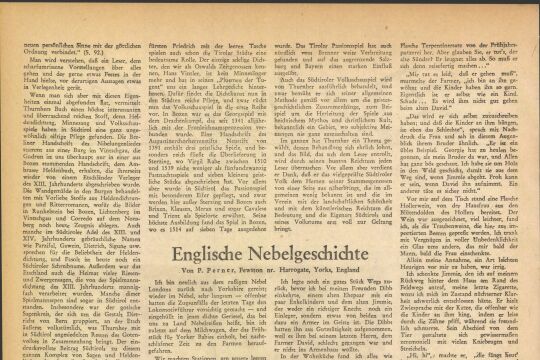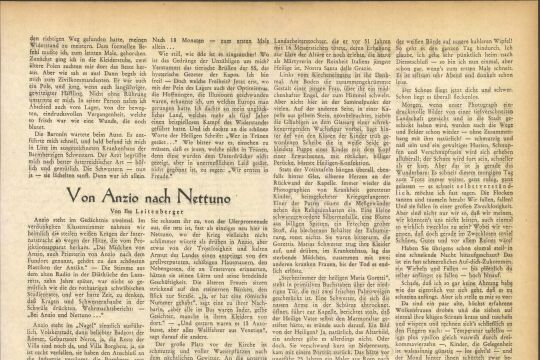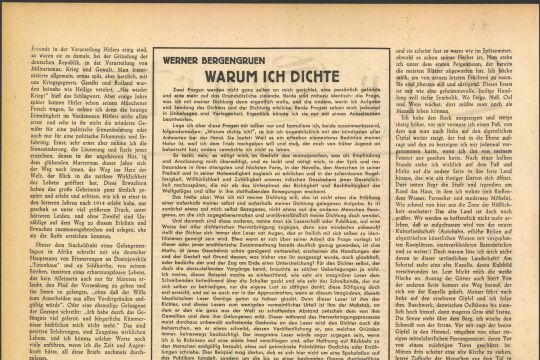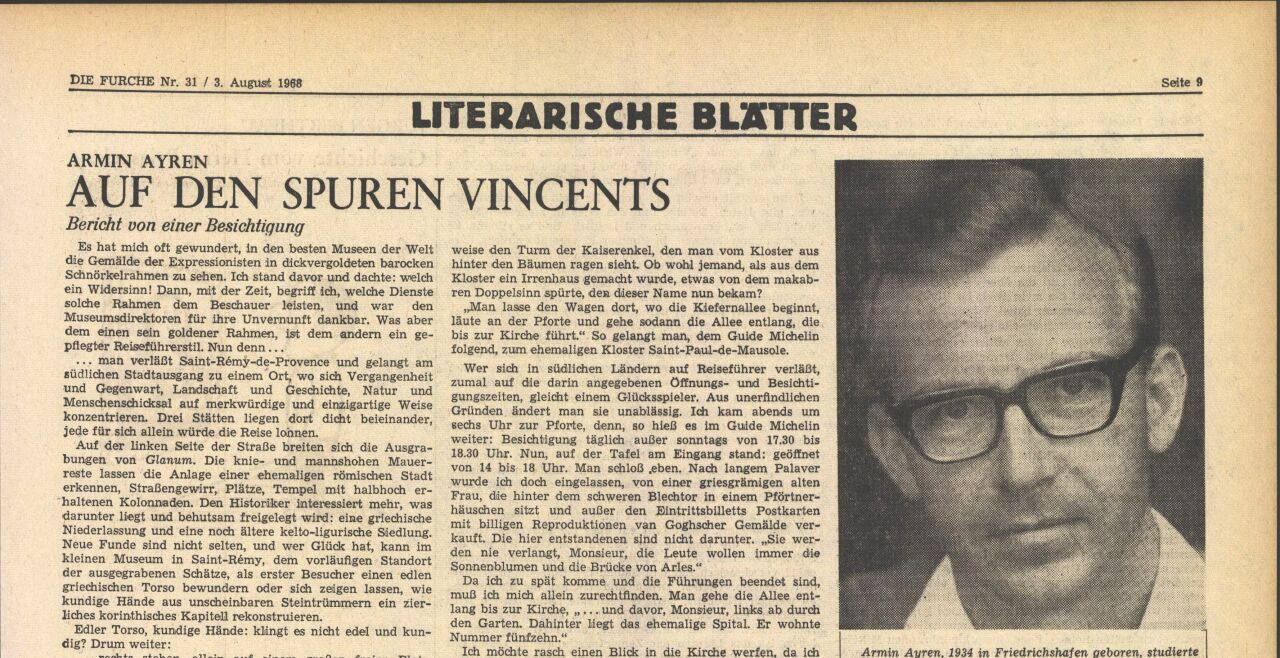
Es hat mich oft gewundert, ln den besten Museen der Welt die Gemälde der Expressionisten in dickvergoldeten barocken Schnörkelrahmen zu sehen. Ich stand davor und dachte: welch ein Widersinn! Dann, mit der Zeit, begriff ich, welche Dienste solche Rahmen dem Beschauer leisten, und war den Museumsdirektoren für ihre Unvernunft dankbar. Was aber dem einen sein goldener Rahmen, ist dem ändern ein gepflegter Reiseführerstil. Nun denn man verläßt Saint-Rémy-de-Provence und gelangt am südlichen Stadtausgang zu einem Ort, wo sich Vergangenheit und Gegenwart, Landschaft und Geschichte, Natur und Menschenschicksal auf merkwürdige und einzigartige Weise konzentrieren. Drei Stätten liegen dort dicht beieinander, jede für sich allein würde die Reise lohnen.
Auf der linken Seite der Straße breiten sich die Ausgrabungen von Glanum. Die knie- und mannshohen Mauerreste lassen die Anlage einer ehemaligen römischen Stadt erkennen, Straßengewirr, Plätze, Tempel mit halbhoch erhaltenen Kolonnaden. Den Historiker interessiert mehr, was darunter liegt und behutsam freigelegt wird: eine griechische Niederlassung und eine noch ältere kelto-ligurische Siedlung. Neue Funde sind nicht selten, und wer Glück hat, kann im kleinen Museum in Saint-Rémy, dem vorläufigen Standort der ausgegrabenen Schätze, als erster Besucher einen edlen griechischen Torso bewundern oder sich zeigen lassen, wie kundige Hände aus unscheinbaren Steintrümmern ein zierliches korinthisches Kapitell rekonstruieren.
Edler Torso, kundige Hände: klingt es nicht edel und kundig? Drum weiter:
rechts stehen, allein auf einem großen freien Platz, Les Antiques, zwei Monumentalbauten aus der römischen Kaiserzeit. Der eine, ein ziemlich schlecht erhaltener Triumphbogen, sieht unbedeutend aus, bis man näher tritt und an der Innenseite des Gewölbes eine Kassettendecke erblickt, die wie eine Offenbarung wirkt: hier hätten die Erbauer langweiliger Pantheone lernen können, welchen Reiz man dem einfachen Wabenmuster aneinandergereihter Sechsecke abgewinnen kann.
Links vom Triumphbogen erhebt sich hoch und schlank das sogenannte Mausoleum, ein Gedenkturm, den Kaiser Augustus seinen beiden frühverstorbenen Enkeln Gaius und Lucius Caesar errichten ließ. Dieser Turm zieht scharenweise Touristen an, denn ein schöneres und besser erhaltenes Bauwerk dieser Art gibt es nicht einmal in Italien. Fehlten nicht die vier Basreliefs am Sockel, die Kampfszenen aus dem Leben des Gaius darstellen, ziemlich verwittert, nichts würde ein Alter von zweitausend Jahren vermuten lassen.
Unter dem Turmhelm, in einer Säulenrotonde, stehen die beiden Kaiserenkel, in Lebensgröße, einander abgewandt, und schauen nach Norden und Süden in die Provence hinaus, steinern-gleichgültig und ohne sich einen Deut um die Horden besichtigungswütiger Fremder zu kümmern, die unten im Schatten des Omnibusses auf den Marmörstüfen sitzen bei Schinkenbrötchen und Coca-Cola und den Reiseleiter fragen, Was als nächstes drankommt.
Der mahnt zum Aufbruch, denn Saint-Paul-de-Mausole, hinter Glanum, durch Gebüsch und Bäume verdeckt, gehört nicht zum Programm. Bald wird es auch aus den gedruckten Reiseführern verschwinden. Das ehemalige Kloster, das im 19. Jahrhundert in ein Irrenasyl verwandelt und berühmt wurde, weil van Gogh dort von 1889 an zu wiederholten Malen interniert war, ist nur noch kurze Zeit zur Besichtigung freigegeben. Wer das Zimmer Nr. 15 sehen, wer im Blick aus dem Fenster ein berühmtes Bild wiedererkennen will, muß sich beeilen. Das seit langem leerstehende Gebäude wird wieder instand gesetzt, wird wieder
Mir scheint, ich habe den Ton einigermaßen getroffen. Nur wußte ich von alledem nichts, als ich eines Abends im Spätsommer 1964 von Arles her auf den Spuren Vincents nach Saint-Paul-de-Mausole kam. Heiliger Paulus vom Mausoleum. denn für ein Mausoleum hielt man früher irrtümlicher-
weise den Turm der Kaiserenkel, den man vom Kloster aus hinter den Bäumen ragen sieht. Ob wohl jemand, als aus dem Kloster ein Irrenhaus gemacht wurde, etwas von dem makabren Doppelsinn spürte, den dieser Name nun bekam?
„Man lasse den Wagen dort, wo die Kiefernallee beginnt, läute an der Pforte und gehe sodann die Allee entlang, die bis zur Kirche führt.“ So gelangt man, dem Guide Michelin folgend, zum ehemaligen Kloster Saint-Paul-de-Mausole.
Wer sich in südlichen Ländern auf Reiseführer verläßt, zumal auf die darin angegebenen öffnungs- und Besichtigungszeiten, gleicht einem Glücksspieler. Aus unerfindlichen Gründen ändert man sie unablässig. Ich kam abends um sechs Uhr zur Pforte, denn, so hieß es im Guide Michelin weiter: Besichtigung täglich außer sonntags von 17.30 bis 18.30 Uhr. Nun, auf der Tafel am Eingang stand: geöffnet von 14 bis 18 Uhr. Man schloß .eben. Nach langem Palaver wurde ich doch eingelassen, von einer griesgrämigen alten Frau, die hinter dem schweren Blechtor in einem Pförtnerhäuschen sitzt und außer den Eintrittsbilletts Postkarten mit billigen Reproduktionen van Goghscher Gemälde verkauft. Die hier entstandenen sind nicht darunter. „Sie werden nie verlangt, Monsieur, die Leute wollen immer die Sonnenblumen und die Brücke von Arles.“
Da ich zu spät komme und die Führungen beendet sind, muß ich mich allein zurechtfinden. Man gehe die Allee entlang bis zur Kirche, „ und davor, Monsieur, links ab durch den Garten. Dahinter liegt das ehemalige Spital. Er wohnte Nummer fünfzehn.“
Ich möchte rasch einen Blick in die Kirche werfen, da ich nun schon einmal hier bin. Sie ist nur von außen schön; innen herrscht Halbdunkel, das den üblichen Kitsch des vergangenen Jahrhunderts gnädig verschleiert. Doch dann eine Überraschung: durch eine Seitenpforte tritt man rechts in einen romanischen Kreuzgang hinaus. Er hat unterteilte Doppelbögen wie in Montmajour und Le Thoronet. Er ist wunderschön. Warum wird er im Reiseführer nicht erwähnt?
Das Begreifen dauert nur einen Augenblick. Denn wenn hier auch seit langem kein Kloster mehr besteht, gehen doch Gestalten umher, Gestalten in grauen, einförmigen Kutten, Männer und Frauen, für die dieser Kreuzgang wie ehedem für die Mönche die Außenwelt bedeutet, das Draußen, die einzige Möglichkeit, sich im Freien zu ergehen, wenn man den engen quadratischen Innenhof so nennen will. Schmale Treppen führen in die Säle und Zellen hinauf. Die Gesichter der Graugekleideten haben nichts Ruhiges, Weltentrücktes. Sie sind nicht heiter oder gesammelt. Sie erschrecken. Wer van Goghs wegen hergekommen ist, mag sich vorsehen. Er braucht sich nicht zu bemühen, Vergangenes heraufzubeschwören. Noch immer ist Saint-Paul-de-Mausole, wenigstens in diesem Gebäudetrakt, eine Irrenanstalt.
Nichts davon steht am Eingang; keine Tafel weist darauf hin. Da .war ich gekommen, um ein denkwürdiges Zimmer Zu sehen, und finde mich unvermittelt unter lauter Kranken, in einer geschlossenen Welt, fühle mich fremd, unbefugt, ein Eindringling, ein Gaffer. Irgendwo bimmelt eine Glocke, Bewegung kommt auf, der Kreuzgang füllt sich, aus allen Treppenaufgängen quellen Scharen Graugekleideter, wie Herden angetrieben und geführt von Ordensschwestern mit wehenden Flügelhauben, auch sie in grauen Kutten. Einmal lacht jemand laut; es ist ein wildes, hysterisches Lachen, das mir die Haut kalt werden läßt. Die Schwestern, derlei offenbar gewohnt, sehen nur mißbilligend drein und treiben ihre Schützlinge mit größerer Eile vorwärts, dem Speisesaal zu.
Vincent hat in einem ändern Teil der Gebäude gewohnt. Das alte Irrenhaus liegt drüben, auf der ändern Seite des Gartens. Den durchquert man wie eine Wildnis; er ist groß, sich selbst überlassen seit Jahrzehnten. Gefällte Bäume liegen, von Brombeerranken und Efeu überwuchert, vergessen zwischen Trümmern und Gebüsch im hohen Gras. Dann steht man davor und erkennt es, das langgestreckte, zweistöckige und doch sehr niedrige Asyl mit dem säulenbewehrten Hauptportal und den Bäumen davor. Es ist fast wie auf dem
Bild, aber trotz des schönen sonnigen Sommerabends geht etwas Beklemmendes davon aus, und man begreift bald, warum, wenn man nähertritt und genauer hdnsieht: die Fenster sind leer, innen hängen Überall Fetzen von der Decke und bröckelnder Kalk; das ganze Gebäude befindet sich in trostlosem Verfall. Im Innern heißt es umsichtig vorwärts gehen: die Gänge liegen voll herabgefallener Balken und Mauertrümmer, vergessene Baubretter lehnen an den Wänden, ein rostiger Schubkarren steht im Weg, offenbar hat man einmal eine Wiederherstellung vorgehabt und sie dann bleibenlassen. Im Boden, besonders in den Zimmern, klaffen Löcher. Manchmal schaut man durch eine Tür, und es ist nur ein schwarzes Viereck da, gähnender Abgrund, Kellerdunkel. So geht es nach rechts und nach links, überall dasselbe, den Korridor entlang und dann in die Querflügel hinein. Das späte Abendlicht fällt durch die Fensterhöhlungen und beleuchtet mit sanftroter Nachsicht die Verwüstung.
Ich steige auf der Suche nach Vincents Zimmer die Treppe zum oberen Stockwerk hinauf. Ich muß eine schmiedeeiserne Gittertür öffnen, wie zu einem Raubtierkäfig; vielleicht hausten oben die schwereren Fälle. Die Tür geht wider Erwarten ganz leicht auf, nach außen, sie quietscht mit einem langgezogenen Wehlaut. Dann stehe ich einen Augenblick sprachlos, weil sich dieses Quietschen fortsetzt, nachdem’ die Tür stillsteht. Es ist nicht das Echo. Ich versuche es noch einmal — dasselbe. Dieser seltsam verlängerte Laut in der völligen Stille ist wie ein Warnzeichen. Besichtigungen verlaufen anders.
Oben ist es heller, die Sonne scheint noch in die kleinen Zimmer. Überall der gleiche Verfall, leere, hallende Korridore, Türen, die zu engen quadratischen Zellen führen. Aber hier gibt es wenigstens Nummern über den Türen. Zelle 15 läßt sich leicht finden, sie liegt am Anfang eines Seitenflügels. Die Tür geht nicht auf, sie ist von innen verriegelt, man sieht es durch einen Spalt. Ich muß ins nächste Zimmer und trete durch eine Verbindungstür ein. Ich schiebe mich vorsichtig an der Wand entlang, denn der Boden hängt durch und schwankt bedenklich unter mir.
Hier aiso war es. Ein leerer, häßlicher, ehemals gelbgetünchter Raum; ein Fenster. Es könnte ebensogut daneben sein oder woanders. Keine Spur von van Gogh. Niemand treibt hier Kult mit Erinnerungen, und vielleicht ist das besser so. Aber hier war es, das zeigt der Blick durchs Fenster. Welcher andere Maler wäre wohl je auf den Gedanken verfallen, zu malen, was da draußen zu sehen ist: ein langweiliger viereckiger Grasplatz mit einer niedrigen Mauer drumherum, vielleicht ehemals der Klostergarten. Rechts hinten, wo die Mauer abschließt, außerhalb der Einfriedung ein paar Zypressen. Sie müssen alterslos sein, oder es sind längst andere, denn genauso stehen sie auf van Goghs Bild. Im Hintergrund, langgestreckt und eintönig, ein niedriger Hügelrücken. Es ist schon spät, und vom Flimmern der Luft im mittäglichen provencalischen Sonnenglanz, van Goghs Flammen und Wirbeln, sieht man nichts. Nein, hätte mein Zeichenlehrer gesagt, das ist kein dankbarer Gegenstand.
Man möchte gern verweilen und zu beschwören versuchen, was von des kranken Malers merkwürdigem Leben hier greifbar sein müßte, aber es geht nicht, man wird weitergetrieben durch die Zimmerfluchten, die Gänge, die zerbrök- kelnden Trakte. In die Zellen fällt jetzt das letzte Licht der untergehenden Sonne und gibt gespenstische Hinweise an den Wänden, bescheint Kritzeleien, und plötzlich liest man Worte und Musiknoten, Violinschlüssel, Worte in deutscher Sprache. In übergroßer spitzer Sütterlinschrift steht da: Oberdominante. Und weiter rechts: Kleine Terz. Darunter:
Schmerz. Daneben ein Kreis, in dessen Mitte ein großes C geschrieben steht, umgeben von Buchstaben der Tonleiter und Noten und der Bemerkung: besser in cis. Dann ein Pfeil, und an seiner Spitze in kleinerer lateinischer Schrift: Gallia cis-alpina, und es ist ein winziger Elefant dazugestrichelt.
Ein irrer deutscher Musiker? Ein Schulmeister? Wann hat er gelebt, wie hieß er, was hat ihn zerstört, wie kam er hierher? Nichts ist von ihm geblieben als ein paar Zeichen an einer Zellenwand, gegen die man sich schützen muß: er ist ja längst tot.
Ich weiß, daß dies stärker in der Erinnerung haften wird, es ist beklemmender, und die obszöne Zeichnung im übernächsten Zimmer, auf die mein Blick im Vorübergehen fällt, ist wie eine Erleichterung: banal, normal, das könnte auch auf einer Schulbank stehen oder in einer Bedürfnisanstalt.
Ich steige die Treppe wieder hinunter zum Mittelausgang. Die Gittertür, die ich beim Heraufkommen offengelassen habe, ist zu. Warum ist sie zu? Sie läßt sich ganz leicht aufschieben, mit der bloßen Berührung des Fingers, und gibt wieder ihren zu langen Klageton von sich, der wie eine spöttische, verschlüsselte Antwort klingt. Schwingt sie vielleicht von selbst zurück? Keineswegs, sie bleibt offen stehen. Und doch möchte ich schwören, daß niemand da war, denn Schritte, auch entfernte, hätte ich in den hallenden Gängen gehört. Ich tippe sie ganz leicht mit dem Finger an, ein Nichts, eher ein Gedanke als eine Bewegung: jetzt schließt sie sich, langsam, unglaublich langsam. Vielleicht war es der Wind.
Und nun folgt doch noch der unvermeidliche vierte Akt, das Satyrspiel, die Farce. Durch den Garten kommen geräuschvoll, bunt und mit vulgärem Lachen verspätete Touristen, eine größere Gruppe, ein Omnibus voll vermutlich, geführt von einem Mann, der entweder ein Sonderling ist oder ein zu dieser Aufgabe freigestellter „leichter Fall“: wallender weißer Naturapostelbart unter einem kugeligen, glänzendbraunen Gesicht, Tropenhelm, schmuddelige helle Hose mit viel zu weiten Beinen, über einem khakibraunen Militärhemd zusammengehalten durch einen zum Gürtel gewundenen Hosenträger — der ganze Kerl ein schwabbeliges Faß, auf dem der weißbehelmte Kopf wie eine Kugellaterne baumelt. Fahrige Blicke schießen unterm Schirm hervor und mustern unruhig die Gruppe.
Er ist Gärtner, wie er gesprächig versichert, aber natürlich nur nebenher, fürs gröbste. Richtig anzufangen hätte gar keinen Sinn. Hauptberuflich malt er. Er kopiert die Bilder van Goghs, nach Drucken. Zu einer genauen Kopie gehört auch das Signum „Vincent“. Wirklich, das leuchtet ein. Wenn man ihm glauben darf, macht er gute Geschäfte. Mit Amerikanern, was? fragt jemand, und alle lachen.
Dann erzählt er von van Gogh. Er weiß viel, erstaunlich viel, gibt Daten, Details, und das alles in mehreren Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch. Und es stimmt. Er spricht ununterbrochen. In Zimmer 15 vergißt er nicht, darauf hinzuweisen: machen Sie ein Photo von hier, bald können Sie’s nicht mehr, denn bald wird man das Gebäude instand setzen, bientöt il y aura ici cinq cent femmes folles, und er verdeutscht harmlos: fünfhundert tolle Frauen.
Man möchte heimlich lachen, aber dazu kommt man nicht, sieht man die nun vollends düsteren Gänge entlang. Auch ein Laie begreift, daß eine halbwegs gründliche Renovierung dieser Räume ebensoviel kostet wie ein Neubau. Doch offenbar soll hier gespart werden. Campagne de Stabilisation des prix, maßhalten. Irgendwo muß man ja anfangen damit.
Wir steigen wieder hinunter, und wieder ist die Tür geschlossen. Niemand bemerkt es. Der Führer öffnet sie, tritt hinaus in den Garten, zeigt auf einen Rasenplatz, sagt: Von hier aus hat van Gogh das Haus gemalt. Machen Sie ein Photo, junger Mann, bald können Sie es teuer verkaufen. Und wie um einen Anteil an meinen künftigen Gewinnen einzuheimsen, streckt er die Hand aus für das obligatorische Trinkgeld. Die Führung ist beendet.
Später, als der Omnibus fort ist, sitze ich auf den Stufen des Mausoleums. Nacht fällt ein über die Provence. Dunkel schwimmen die Umrisse der Säulen von Glanum vor der Silhouette der Berge. Die Sterne ziehen auf, und die Kaiserenkel verschmelzen mit den Säulen der Rotonde zu steinernen Schatten. Grillen zirpen und löschen die Erinnerung an weniger friedliche, weniger vertraute Laute: an ein irres Gelächter, einen zu langen Quietschton, eine häßliche Zahl, fünfhundert, und an ein Geräusch, das noch gar nicht zu hören ist, das Lärmen der Zementmischmaschinen und das Rattern der Bohrhämmer. Man wird es wieder instand setzen, dieses Irrenasyl, und vielleicht läßt der Staat, im Bewußtsein seiner Verpflichtung großen Männern gegenüber, auch wenn sie keine Franzosen waren, sogar eine Gedenktafel anbringen über der Tür: in diesem Zimmer wohnte
Aber wozu? Denn im Reiseführer, wenn er Saint-Paul-de Mausole noch erwähnt, wird dann stehen: on ne visite pas.