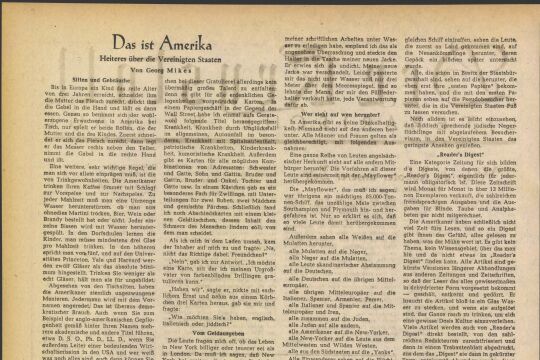24 Stunden gegen die Sonne
Der Flug Dr. Otto Kaspars steuert seinen letzten Landepunkten entgegen: Honolulu, Kalifornien ... Der breite Graben des Pazifik, der Ostasien und den amerikanischen Kontinent trennt, ist mit Hilfe der Technik in zwölf Flugstunden zu überwinden — schwerer zu überbrücken aber ist die Kluft zwischen asiatischer Massenarmut und amerikanischem „Well farc“. zwischen asiatischer Bildung und amerikanischen „studies“, zwischen Asiens mystischer Gläubigkeit und den sehr verschiedenen Frömmigkeitsstilen in den Staaten. Ist bei solchen Widersprüchen überhaupt eine erfolgreiche Asienpolitik der USA denkbar? — Wir wollen abschließend in diesem Zusammenhang wieder darauf verweisen, daß Dr. Kaspar seinen Flug „gegen die Sonne“ gemeinsam mit Pater Johannes Leppich SJ. unternommen hat. Die ReiseeindrUcke des bekannten Predigers erschienen kürzlich im Bastion-Verlag, Düsseldorf, unter dem Titel „Gott zwischen Götzen und Genossen“. „Die Furche“
Der Flug Dr. Otto Kaspars steuert seinen letzten Landepunkten entgegen: Honolulu, Kalifornien ... Der breite Graben des Pazifik, der Ostasien und den amerikanischen Kontinent trennt, ist mit Hilfe der Technik in zwölf Flugstunden zu überwinden — schwerer zu überbrücken aber ist die Kluft zwischen asiatischer Massenarmut und amerikanischem „Well farc“. zwischen asiatischer Bildung und amerikanischen „studies“, zwischen Asiens mystischer Gläubigkeit und den sehr verschiedenen Frömmigkeitsstilen in den Staaten. Ist bei solchen Widersprüchen überhaupt eine erfolgreiche Asienpolitik der USA denkbar? — Wir wollen abschließend in diesem Zusammenhang wieder darauf verweisen, daß Dr. Kaspar seinen Flug „gegen die Sonne“ gemeinsam mit Pater Johannes Leppich SJ. unternommen hat. Die ReiseeindrUcke des bekannten Predigers erschienen kürzlich im Bastion-Verlag, Düsseldorf, unter dem Titel „Gott zwischen Götzen und Genossen“. „Die Furche“
VI. Von Waikiki bis Manhattan
Amerika — besser gesagt: den USA - begegnete ich nicht erst, als mir der Immigra-tion-Officer in Honolulu den Kontrollstempel in den Paß drückte. Amerika in Asien lernte ich schon früher kennen ...
Wir fuhren durch Beirut. Mein Begleiter zeigte auf ein langgestrecktes Gebäude: „Die amerikanischen Universität. Hier werden die arabischen Nationalisten ausgebildet.“ Verblüfft frage ich, warum? „Nicht direkt und mit Absicht selbstverständlich. Aber wer .Gleichheit und Freiheit' als das non plus ultra eingepaukt bekommt, der will natürlich in seinem Land die Probe aufs Exempel machen. Und nach Beirut kommen Studenten aus ganz Arabien und Vorderasien...“
In Bagdad lernte ich einen jungen aufgeweckten Amerikaner kennen. Wir sprachen über das Tauziehen in Asien. Plötzlich fragte er mich: „Können Sie mir sagen, warum wir Amerikaner so verhaßt sind?“
Einen Tag später hätte ich ihm eine Antwort — soweit sie den Irak betraf — geben können: Die Amerikaner als unfreiwillige Konkursverwalter der alten Kolonialmächte, als notgedrungene „Vakuum“-Spezialisten wollen helfen, wie es der Mentalität des arglosen Amerikaners entspricht. Mit Geld und bewährten Einrichtungen. Sie haben die Demokratie nach Asien ebenso exportiert wie Schiffsladungen Reis. Die Sache mit der Demokratie ging ins Auge und die Spekulation, Freundschaft mit Geld zu kaufen, daneben. Vor?1ötem,f weil idftTfW ÖWef 'HiWsfcefeitschaft skrupellos ausgenützten Amerikaner in ihrer ungeschickten Offenheit so weit gingen, daß sie ihr schwaches Vertrauen in die Rechtschaffen heit der asiatischen Politiker nicht einmal aus Taktik verdeckten. Sicher sind Korruption und Politik in vielen asiatischen Staaten auch heute noch Synonyme. Aber auch Gauner und Kassenschränker haben einen Ehrbegriff. Wenn also die Amerikaner Millionen Dollars in die sogenannten „unterentwickelten“ Länder hineinpumpten, gleichzeitig aber offizielle „Aufpasser“ mitschickten, die die jeweiligen Regierungen aus der Finanzhilfe zu bezahlen hatten, so war das, amerikanisch gesehen, vernünftig, für Asien aber total falsch. Denn es wurde nicht mehr das Geschenk gesehen, sondern nur das Geld, das der amerikanische Ueber-wachungsstab bekam!
Die Amerikaner spielen weniger Theater als die Russen Vielmehr gar keines. Aber mit ihren harten Verhandlern, die, bar allen Taktgefühls und praktischer Psychologie, gegen Money Stützpunkte und strategische Sicherheiten einhandeln wollen, arbeiten sie, auf die Dauer gesehen, gegen sich selbst und damit gegen den Westen überhaupt.
Als ich während einer Flugpause mit einem jüngeren Amerikaner ins Gespräch kam — sie sehen sich übrigens alle irgendwie ähnlich, ob sie nun High-School-Dozenten, Diplomaten, Sektenprediger sind, Büromaschinen oder Pepsi-Cola verkaufen —, fragte ich ihn, warum wohl die Amerikaner in Asien mit so unübertrefflichem Geschick stets auf das falsche Pferd setzen. Er schien für meine Sorgen wenig Verständnis zu haben: „Okay, vielleicht haben Sie recht. Aber wir haben immer noch rechtzeitig geschaltet. Wir haben in den letzten zehn Jahren eine Menge dazugelernt...“
Schön wäre es. Leider sind es die sogenannten „starken Männer“, auf die die Amerikaner in Asien bauen. „Stärke“ im Sinne von Material, Material im Sinne von Armeen. Aber nicht nur in Asien sind Ideen und Gefühle auf die Dauer stärker als Bajonette, die übrigens nach zwei Seiten stechen können, wie die jüngste Zeit beweist. Und wenn schon die Amerikaner bereit sind, aus Fehlern immer wieder zu lernen, so trifft das nicht auf die Asiaten zu. Die lernen nur pinmal. aber da gründlich . .
Honolulu ist der Traum aller Teenager. Nur liegt es nicht auf der Insel Hawaii, sondern auf Oahu. Es ist zwanzig Kilometer lang und beherbergt ein buntes Volksgemisch von Einheimischen, Philippinos, Japanern, Weißen usw. Sie arbeiten dort wie anderswo auf der Welt in Fabriken und auf Feldern, allerdings bei einem Klima, das keinen Winter und Sommer kennt, sondern nur ewigen Frühling. Wer im Meer baden will, kann es zu Weihnachten ebenso wie im August. Die vulkanische Erde produziert ununterbrochen. Darum wachsen nur Früchte, die dem Boden keine Schonungspause gönnen. Jahraus, jahrein werden Ananas geerntet, wird Zuckerrohr geschnitten ,..
In Honolulu ist auch die größte Ananasfabrik der Welt: „Dole“. Tagesproduktion: eine Million Dosen. In der großen Empfangshalle wartete ich auf den aus Schweinfurt stammenden Chefingenieur, um von ihm durch das Riesenwerk geführt zu werden. An einer Wand waren Wasserleitungshähne, daneben ein Papiertütenbehälter. Wie alle anderen, hielt auch ich einen Becher unter den Hahn; aus ihm floß — Ananasjuice ...
„Waikiki — Märchenland.“ Der Schlagertextdichter muß es ja wissen. Ich fand hingegen auf eineinhalb Kilometer Länge am Strand zusammengepreßt eine Ansammlung von Hotelkasten, die zwar nicht in die Landschaft passen, aber sicher dem amerikanischen Hotelkomfort entsprechen. Hier trifft sich die „Welt“, bei 30 Dollar Zimmerpreis und Garden-Parties für 10 Dollar, bei denen auf einem Teppich das Hula-Mädchen vom Dienst sich mit jedem unter den Palmen verewigen läßt, der sich vom Standphotographen eine Schreibtischerinnerung vom Traumland Hawaii bestellt hat. Wie in Wien beim Pr&terpho*ographen. Betäubend ist nur der Duft der herrlichen Lei-Blumenkränze. Sonst ist Waikiki teuerster, internationaler, aber nichtsdestoweniger — Kitsch. Einen Kilometer daneben ist der idylliscne Strand wieder menschenleer und — schön. Und am anderen Ende von Honolulu liegt im Hafen von Pearl Harbour das von den Japanern versenkte Schlachtschiff „Arizona“ kieloben im Wasser, obenauf der Union-Jack. Mit 1400 toten Matrosen im stählernen Leib — als nationales Denkmal...
Zwölf Flugstunden oder fünf Schiffahrtstage östlich — die Küste Kaliforniens. Die Küste und die Täler bis weit ins Land sind von Milchbrei bedeckt. Im Flughafen von Los Angeles fallen mir beim Ausgang Zettel auf: jedermann wird darin aufgefordert, mitzudenken, wie man den „Smog“ beseitigen kann. Bald merke ich, was es mit diesem „Smog“ auf sich hat. Er ist eine Wortkonstruktion aus „smoke“ (Rauch) und „fog“ (Nebel) und liegt über Los Angeles, das einen Durchmesser von 90 Kilometer und rund 270 Vororte hat. Die hohe Bergkette hinter der Stadt ist zu nahe. So zieht die Luftströmung vom Meer über Los Angeles hinweg. Die acht Prozent-nicht verbrauchter Autoabgase, vermischt mit Ozon, geben eine beißende Mischung, die die Augen reizt und mit anderen Abgasen und Luftstaubteilchen zu einem Nebelbrei wird. Woher dieser „Smog“ kommt? Die einen sagen: vom Abholzen. Tatsächlich muß heute Kalifornien bereits die Orangen aus Florida einführen, weil die einst berühmten kalifornischen Orangenhaine der wildwachsenden Stadt zum Opfer fielen. Andere sagen, das Erdöl ist schuld. Es wird sogar aus dem Meer herausgeholt und verunreinigt übrigens durch schwimmende Teerbrocken den Strand. Wieder andere beschuldigen die Industrie, die aber schon viel gegen die Abgase bei sich unternommen hat. Und daß die Autos mitschuldig sind, daran ist kein Zweifel. Laufen doch bei 5,5 Millionen Menschen 2,7 Millionen - Autos. Abenteuerliche, echt amerikanische Pläne werden diskutiert. Man will dem „Smog“ zu Leibe rücken durch riesige Exhaustoren, man will einen Stollen durch das Gebirgsmassiv treiben...
Inzwischen wächst die Stadt weiter. Vorneweg immer ein Shopping-Center. Von dort sieht man bereits die Siedlungshäuser heranwachsen. Ist gleichgezogen, dann wird das nächste Shopping-Center — gleichsam vorgeworfen ...
Ich wohnte in Los Angeles in der Nähe des Pershing-Square. Er ist das, was in London der Hyde-Park ist. In einer Ecke hämmerte ein Sektenprediger seinen Zuhörern — Pensionisten, Arbeitslosen, Lebenskünstlern — mit gellender Stimme ein, sie wären alle verdammt. Mir kam er komisch vor. Vor Mitternacht ging ich durch eine übelbeleumundete Straße — nicht weit vom Pershing-Square — heimwärts. Alles war eindeutig. Die Lokale, die Aufschriften, die Bilder, die Frauen. Vor einem dunklen Hausflur stand ein Mann. Zwei junge Mädchen, die vor mir schlenderten, wurden von dem zwielichtigen Mann leise angesprochen. Er gab ihnen einen von den Zetteln, die er in der Hand hielt. Ein Kuppler? Ich wartete, trat auf ihn zu und verlangte.,ebenfajby,einen solsjftijt .
..Glaube an den Herrn Jesus Christus, und du wirst gerettet werden...“
Dieser Sektierer, der in der Nacht vor Striptease-Lokalen und Bordellen steht und seinen „Herrn Jesus Christus“ verteilt, kam mir nicht komisch vor. Ich fühlte mich plötzlich klein und beschämt...
Nahe der Grenze Kaliforniens, so nahe wenigstens, um wie ein Magnet die Spielwütigen anzuziehen, liegt Las Vegas, die Spielhölle in der Wüste Nevada. Ab und zu leuchtet der Feuerpilz einer Atomexplosion herüber. Nevada ist ein armer Staat, der vom Wüstenstaub nicht leben kann und darum das grüne Tuch zu seiner Existenzbasis gemacht hat. Nicht das von Mohammed, sondern das für Bakkarat, Roulette, Poker, Siebzehn und vier usw. Ungefähr zehn luxuriöse Spielhotels, man wohnt dort nur, um zu spielen, ziehen sich an der Wüstenstraße vom Flugplatz bis in die eigentliche Stadt, in der es weitere Dutzende Spieletablissements gibt. Sie knüpfen namentlich an die Zeit der Goldsucher an: „Golden Nugget“, „Pioneer“, „The Westerner“, „Silver Slipper“ u. a. Wer das Geldspiel mit dem der Liebe verbinden will, kann Tag und Nacht in einem der zahlreichen „Wedding-Chapels“ der Sekten einen auf Wüstensand eebauten Ehestand begründen.
In dieser Stadt, in der immer leichter Staub durch die Luft wirbelt, gibt es nur ein Gesetz: das Geldspiel. Hunderttausende Automaten rollen und klappern ununterbrochen, im Market, in dem die Frauen beim Einkauf sparen, um das Gesparte in den Spielautomaten zu werfen, beim Friseur, im Autosalon, im Coffee-Shop. In großen Papierbechern werden nicht Eisportionen gebracht, sondern klimpernde 5-Cent-Stücke. In den Hotels rollen statt der 5-Cent-Stücke die runden Silberdollars, die hier die erünen viereckigen Papierscheine verdrängt haben. Als ich am Abend aus der Stadt der Besessenen in Richtim? Flugplatz wanderte, kam ich an einem Motel vorbei. Leuchtreklame kündigte an, daß es außer freien Zimmern noch ein Swimming-Pool habe und in jedem Zimmer TV. Als Neon-Hauswappen hatte es die — Heilige Familie auf Herbergsuche. Das Motel hieß: ..Mater-mea-Inn“ ...
In Chikaeo bin ich einem deutschen U-Boot beeegnet. Nicht im Wasser, sondern vor dem „Museum of Science and Industry“. U 505 steht dort im Freien' und freut sich, wenigstens in einem der halbwegs erträglichen Viertel dieser nach dem Reißbrett entworfenen Stadt seinen Lebensabend zu verbringen. Eine einzige Straße, die „State Street“, läuft 60 Kilometer schnurgerade durch die Stadt. Die vom Süden zuwandernden Neger erobern Viertel um Viertel. Wo gestern noch Millionäre wohnten, breiten sich heute Slums aus. Die Eisenstiegen an den Außenmauern machen die einförmigen Gebäude noch trostloser. Und in den dunklen, oft nur karrenbreiten Schluchten zwischen . Wolkenkratzern, die in beklemmende Hinterhöfe führen, kann man sich sehr wohl vorstellen, daß hier die Polizei gegen eine organisierte Unterwelt einen hoffnungslosen Kampf führt.
An der breiten Straße am Michigansee stehen neueste Raketenabwehrwaffen, und vor einem kleinen Lokal, das „blue jazz“ mit einem berühmten Trompeter ankündigt, sind Schlangen von Jazzfans. Unter ihnen elegantest gekleidete Negerinnen. Von der Temple Church, die auf einem Wolkenkratzer einen gotischen Turm hat, dringt Orgelmusik wie Sphärenklänge. Unten aber rattert auf der einstöckigen Hochbahn — Elevator heißt das Ding - mitten über der Straße ein altmodischer Waggon, Und der Sohn des Milchmannes unseres Gastgebers, Schwarz ist sein Name, sitzt. Er ist mit siebzehn anderen in einer „Gang“ beisammen. Eines Abends fuhr die Platte aus Langeweile wieder los. Da trafen sie auf einen jungen Neger, der auf ein Auto wartete. Sie blieben stehen, und der junge Schwarz erschlug den Neger mit einem Hammer ...
Ein Pädagoge skizzierte mir einige geltende Erziehungsgrundsätze: Die Eltern meinen, der Jugend gehe es nie mehr so gut wie in den ersten Jahren. Darum solle sie sie auskosten. Man müsse sie nur wachsen lassen. Der „break“ komme dann von selbst, dann würden sie schon vernünftig. Man solle nur nicht herumnörgeln, das hemme sie nur.
Die Jugendkriminalität macht nicht nur den Clikagoern Sorge. In der Subway, der Untergrundbahn New Yorks, war ein Plakat. Zwei raufende Buben waren zu sehen und darüber stand: „When family life stops ... Delinquency Starts...“ Woher diese Krise kommt? Vom erbarmungslosen Existenzkampf allein? Oder auch von der Form des von manchen Europäern söMangehimmelte amerikanischen Lebens? Ein 'Seelsorger- klagte mir: „Alles ist hier fsteife! Der Beruf, die Familie, die Kirche, das Vergnügen! Alles ist vorfabriziert, zum Konsum reif. Sogar die ,Do-it-yourself'-Bewegung — Mach es selbst I Alles ist bereits bis zur feinsten Nuance vorgefertigt.“
Einmal war ich zu einem Abendessen eingeladen. Die Hausfrau in ihrer „amerikanischen Küche“, vom Eiskasten über Knochenzerhacker und Geschirrwaschmaschine zum Elektroherd mit Vorwärmer für das vorgefertigte TV-Dinner, das sich beim Fernsehen jeder holt, wann es ihm paßt, war in zehn Minuten mit den Zutaten fertig. Der Hausherr aber briet das Fleisch. So wie es einst gewesen sein muß, als Lederstrumpf noch jung war und der letzte der Mohikaner noch viele Brüder und Schwestern hatte. Auf einem offenen Rost lag über glühender Holzkohle das Lendenstück, und uns rannen die Tränen herunter, so viel Rauch gab es. Nach fast zwei Stunden waren auch wir, fertig und ernteten liebenswürdigen Spott der Hausfrau. Ich aber war froh, daß unser Gastgeber wenigstens dieses eine Ventil in seinem sonstigen Fabriksleben hatte . ..
Uebrigens: Er hat eine hübsche Tochter. Natürlich kann sie ausgehen mit ihrem Freund. Er holte sie im Wagen ab, mit einer Orchidee versteht sich, und brachte sie nachher wieder nach Hause. Die Mutter wartete so lange. Dann bekam er noch einen Abschiedsdrink, und alles war okay. Das ist ebenso amerikanische Jugend wie die tausenden Buben und Mädel, die in den 300 Musikschulen von Chikago (von denen jede so groß ist, daß sie Abgangsdiplome ausstellt) ein Musikinstrument lernen. Die meisten für ihren Privatgebrauch. Oder wie die jungen Menschen, die ich im Metropolitan Museum of Art in New York gesehen habe. In diesem Museum, mit freiem Eintritt und einem eigenen Restaurant für die zahlreichen Besucher, sitzen sie in Ecken oder auf dem Boden und zeichnen Gemälde ab oder skizzieren Plastiken nach.
In New York, von dem es heißt, daß dort mehr Italiener als in Rom, mehr Juden als in Israel und mehr Iren als in Irland leben, war ich eines Tages in einem Park in der Avenue A zwischen der 9. und 11. Street. In diesem Viertel wohnen Sizilianer, Portorikaner und Ukrainer. Die Mischung war toll. Die Ukrainer, DPs, saßen auf den Parkbänken noch immer so, wie sie auf den Auswandererschiffen gesessen sein müssen. Entwurzelt und mutlos.
Vielleicht mit dem Trost, daß sich ihre Kinder zurechtfinden werden ...
Eine kleine unscheinbare Frau mit blondem strähnigem Haar kommt auf uns zu. Sie begrüßt meine Begleiterin, eine Schweizer Journalistin, die in der Gegend wohnt. Sie hat sie vor Tagen eingeladen. In ihr neues Haus. Eine Stunde von New York entfernt liegt es, an dem Beach. Heute erzählt sie ihr, sie wäre mit ihrem Olds-mobile nicht mehr zufrieden, sie kaufe sich einen besseren. Und ein Photo habe sie jetzt auch von ihrem Haus: Acht-Zimmer-Villa, direkt am Strand, mit Süßwasser-Pool und Blick über den Strand. Wie im Film, denke ich mir ...
Die Frau ist die Park-Oberwärterin. Im vergangenen Jahr machte sie mit ihrem Mann bVi Wochen Urlaub in Europa ...
In der Nähe, in der Christie-Street, ist Dorothy Day zu Hause. Ehemals Kommunistin, heute der gute Engel für tausende Gestrandete in der Steinwüste von Manhattan. Mit ihren Leuten gibt sie auch ein Blatt heraus, den „Catholic Worker“. Dorothee Day war nicht da. Ein junger, schmalbrüstiger Helfer, Lehrer von Beruf, zeigt mir das armselige Haus. Er sieht schlecht aus und scheint das Leben mit diesen Armen zu teilen. Aber grundgütige Augen hat er. Ich sehe die Aufenthaltsräume, den kleinen Eßraum, täglich bekommen hier 200 Leute morgens, mittags und abends Nahrung. Eventuell auch Kleider. Eine kleine SOS-Gemeinschaft. Sie leben von Spenden und Gottvertrauen. Ein Bild von Gandhi ist beim Tisch Dorothy Days. Sie war mit ihm in engem Kontakt. ..
In einer New-Yorker katholischen Zeitschrift luden mich die Kollegen ein, meine Eindrücke von Amerika niederzuschreiben. Ich mußte ablehnen. Ich würde auch nicht meine Eindrücke von Europa nach 14 Tagen niederschreiben.
Es war immer alles anders, als ich es von der Schablone her wußte. Wenn es noch möglich war, „dem Amerikaner in Asien“ nachzuspüren, so verlor sich seine Spur in Amerika — für mich zumindest. Amerika ist — menschlich gesehen — auch heute noch das Land aller Möglichkeiten. Wer sich darum dem Amerikaner nähern will, mit einem fixen Stempel aus seinem Begriffs-katalog, hat ihn schon aus den Augen verloren.
Was wir aber nicht aus den Augen verlieren sollten — für mich das Erlebnis der Weltreise — ist viel wichtiger als eine Schimmelvorstellung für Amerika:
Wir sollten Asien mehr in den Griff bekommen! Zwar haben Begriffe, wie „Bandung“,
Kennmelodie für den politischen Kristallisationsprozeß der asiatischen Staaten, und „unterentwickelte Länder“, Ausdruck eines taktlosen Patronatsgefühls des Westens, in unserem Sprachschatz bereits Wurzeln geschlagen.
Aber wissen wir wirklich, was dieses Asien ist, wie es fühlt, wie es denkt und wie es sich diesem Denken entsprechend verhält?
Ich glaube, daß wir die Ursche des fast schon chronischen Scheiterns des Westens in asiatischen Fragen nicht bei denen suchen sollten, die w i r nicht verstehen, sondern bei uns, die wir versäumt haben,'Asien eine von uns diametral abweichende Lebens- und Denkweise zuzubilligen. Wer Politik in Asien betreiben oder verstehen will, der muß sich wohl oder übel bequemen, Asiens Besonderheit zu studieren, der wird von seinem hohen abendländischen Roß heruntersteigen müssen, weil es für asiatischen Boden ungeeignet ist.
Asien fehlt. Nicht mehr im Völkerkonzert. Dort schlägt es bereits hörbar die Trommel. Asien fehlt in unserem Verständnis. Asien ist für uns ein Fremdkörper. Das kann für uns aber eine größere Gefahr werden als die seit Jahrzehnten beschworene Angst vor der biologischen Ueber-macht dieses Kontinents.
ENDE