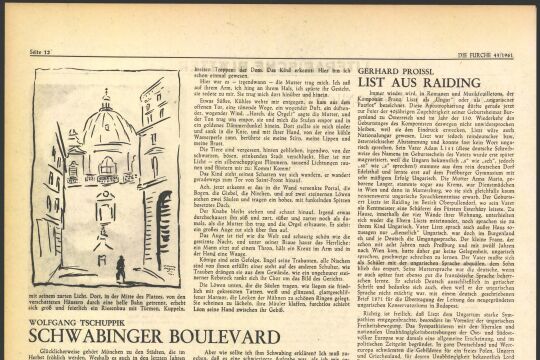Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die andere Seite
Ein heller Tag. Du trittst aus der Tür, und Zuversicht überfällt dich. Die Stadt liegt vor dir. Häuser rieseln auf Gehsteige. Und freudig atmest du Straßen ein.
ßevor ich in Berlin lebte, lebte Berlin in mir. Der Drang, dorthin zu fahren. Als Kind mit den Eltern. Einmal im Jahr bei der Rückreise vom Ostseeurlaub. U-Bahn-Sehnsucht. Nur in Berlin konnte ich unter die Straße steigen und durch das Dunkel gleiten - dann entlassen in das künstliche Licht eines Bahnhofes. Und ich hastete an der Hand der Mutter den Ausgang hinauf, trat an einer Stelle ins Freie, die nichts mit dem Ort des Einstiegs verband.
Schroffe Schnitte der Bilder; rascher Erlebniswechsel. Jeden Moment registrierten die Augen hier doppelt soviel.
Das war anstrengend. Das war schön. Eben kein gemütlicher Spaziergang im Heimatstädtchen, kein beschauliches Promenieren am Ostseestrand.
In Berlin schien vieles ungewiß. Offen. Möglich. Schon bei der Übernachtung stellen sich Probleme ein, Abenteuer in der beängstigend großen, faszinierend lebendigen Stadt. Und erst ihr westlicher Teil: Kaugummiautomaten mit nie gesehenen Schätzen. Zu Mittag Bananen. An Häuserwänden glitzerten Leuchtreklamen.
Zu Hause legte ich auf dem Vorkriegsplattenspieler gern eine schwarze Scheibe auf: „Du bist verrückt, mein Kind, du mußt nach Berlin, wo die Verrückten sind, da gehörst du hin.” Ja, das reizte. Nicht das Ziel vor den Augen, eher stete Verlockung im Hinterkopf. Ob ich je so verrückt sein würde, daß ich nach Berlin gehörte?
Da die Platte oft auf dem Dachboden meines Opas erschallte, untersagte er ihr Abspielen. Die Nachbarin stamme aus Berlin, sie sollte sich nicht provoziert fühlen.
Da waren die Abstecher als Jugendlicher. Allein, mit Freund oder Freundin. Häufige Probleme beim Trampen. Auf der Autobahn vor Berlin Polizeikontrollen, Mitfahrer sortierte man gelegentlich aus.
Und in der Stadt die Suche nach Leuten, die man einmal besuchen konnte. In Cafes, Kneipen, Kinos, Ausstellungen, im Theater. Gemeinsame äußere Zeichen, lange Haare, Kutten erleichterten Kontakte. Zum Beispiel bei Rockkonzerten im legendären „Rübezahl”, jetzt ein auf gutbürgerlich getrimmter Gaststättenkomplex am Müggelsee.
Bei einer der ersten Reisen mein vergeblicher Versuch, die Nacht mit Freundin auf der Parkbank zu verbringen. Zweimal verscheuchen uns Männer, die vor Polizeihelfern warnen. Dann ein Polizeihelfer, der das Nahen eines Polizisten androht. Zur vierten Bank kommt ein Polizist und meldet unsere Namen der Zentrale. Fahndungskbntrolle. Sie suchen ausgerissene minderjährige Mädchen.
„Jeden Sommer hauen Dutzende in die Hauptstadt ab”, erklärt der Uniformierte entschuldigend. Reicht die Ausweise zurück. Rät, es auf einer Bank in einem Vorort zu versuchen. Wir fahren zum Ostbahnhof, um in der „Mitropa” die Nacht abzusitzen, ab und zu an der Brause nuckelnd. Schlafen können wir am nächsten Tag im Bad oder im Zug.
Einer mit wahnsinnig langen Haaren spricht uns an. Erzählt, daß er jedes Wochenende den Konzerten seiner Lieblingsgruppe hinterhertrampt. Mit Berlinabstecher. Sein Ubernachtungs-tip: mit der S-Bahn sich ins Depot kutschieren zu lassen. Heute wartet er auf eine Freundin. Drei Stunden Verspätung, na ja, bei diesen sturen Autofahrern faule einem der Arm ab.
Zwei Polizisten schlendern durch den Raum, die Gäste musternd. Drei schlafen am Tisch, entziehen ihr Gesicht der Kontrolle. Die Streife entfernt sich wortlos.
Und wir reden den Rest der Nacht gegen die Müdigkeit an.
Ich rede mit Harald Hauswald über diese Zeit. Unsere Erfahrungen unterscheiden sich. Er stammt aus dem „Tal der Ahnungslosen”, der westfernseh-freien Gegend im Land. In Berlin erhielten für ihn anonyme Popidole Fernseh-Fleisch und-Blut. Die ersten Westwagen auf der Straße sah er dort, Cola gab es eher. Der Handel mit Westschallplatten nahm hier seinen Anfang, zweihundert Mark das Stück. Man überspielte Bänder, las verbotene Bücher, bekam Tips, wo wann was steigt: Feten oder Auftritte von Bands.
Denn nicht alles, was Berlin ausheckte, startete in Berlin. Es war Anlauf zentrale, unaufhörlich arbeitender Motor, von dem sich jedermann Energie abzapfte.
Alle Fäden liefen da zusammen, wurden zum unentwirrbaren Knäuel. Das Gefühl, näher dran zu sein. An der Welt, die weitgehend der andere Teil der Stadt repräsentierte. Der Westen im Osten.
Auch ich suchte das zu Hause Vermißte und spürte den Sog, der aufgeweckte Leute dorthin trieb. Ich bewunderte die Selbstsicherheit der Berliner, ihr offenes Reden über heikle Dinge. Doch Westfernsehen war für Weimar, Erfurt oder Gera alltäglich. Rundfunksender empfingen wir in Thüringen mehr. Intensives Hören frecher Jugendsendungen weckte Sehnsucht nach revolutionären Veränderungen. Der Preis eines Che-Guevara-Posters lag knapp unter dem der Rolling Stones.
Freunde dachten wie ich, sicher eine Minderheit, uns reizte jedenfalls die Hauptstadt auch als Möglichkeit, kritische Westinformationen aus erster Hand zu bekommen. Ich traf Maoisten, hörte zum ersten Mal den Begriff „Anarcho-syndikalismus”. Ich denke an die Black Panther Party, Sektion Jena, die wir gründeten. Aus Berlin kam erstes Studienmaterial. Darunter haßsprühende Anklagen eines farbigen Bürgerrechtskämpfers gegen die Regierung seines Landes. Wir diskutierten heftig über seine einzige kritische Anmerkung zur sowjetischen Politik: sie versäume es, die Zentren des amerikanischen Industriekapitals mit Atombomben auszuradieren.
Die Gier nach dem Besonderen. Pferderennen in Hoppegarten und Karlshorst. Eine wettsüchtige Atmosphäre, neben offiziellen existieren illegale private Wettbüros. Da kann auf Pferde in Paris oder London gesetzt werden. Auch Hunderennen finden statt — exotische Nischen in der ganz auf olympische Medaillen ausgerichteten Sportförderung.
Oder der Vergnügungspark Plänterwald. Er beherbergt die ersten und bis zum heutigen Tag einzigen fest installierten Computerspiele im Land.
In der U-Bahn. „Gerade hinsetzen!” befiehlt der Vater.
Zwei Männer verbessern ruckartig ihre Sitzhaltung.
Der Sohn lümmelt unbeeindruckt weiter auf seiner Bank.
Ich sehe zwei Polizisten, hinter einer Ecke versteckt, zwei Polizisten beobachten, die auf dem Bürgersteig ihre Pflicht tun, die darin besteht, langsam entlang-zuschlendern und nichts zu tun, als ein Gefühl von Ordnung zu verbreiten. Ich sehe die Polizisten auf ihre Kollegen zeigen und lachen.
Sekunden später erzähle ich es einem Freund, wir sitzen auf einer Bank, als ein fünfter Polizist naht und unsere Ausweise sehen will. Gern reichen wir sie ihm.
Er blättert darin wie der Kenner in einem Band moderner Lyrik. Gibt sie zögernd zurück.
Ich wünsche einen „Guten Dienst!” Der Uniformierte stutzt, zieht es vor, sich zu bedanken, und geht hastig fort.
Eine Taube berührt fast unsere Köpfe, die ihr nicht wichtig genug scheinen, um die Flugbahn zu ändern.
Guter Dinge kaufen wir zwei Currywürste, die Verkäuferin nickt freundlich und vertraut. Da eilt ein Hund vorbei, im Maul einen Ball.
Da sehen wir ein Kind sich in die Mülltonnen wühlen. Auf Schatzsuche, für Mutti zum Geburtstag.
Später spielen zwei junge Männer Tennis in der S-Bahn. Flott und sicher schlagen sie den Ball über acht Köpfe hinweg. Und alle sehen belustigt zu.
Aus dem Band „Ojtberlin” des in der DDR lebenden Autors, der im kommenden Herbst im Verlag Piper, München, erscheint.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!