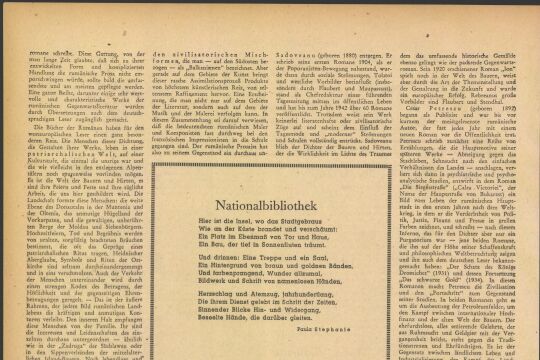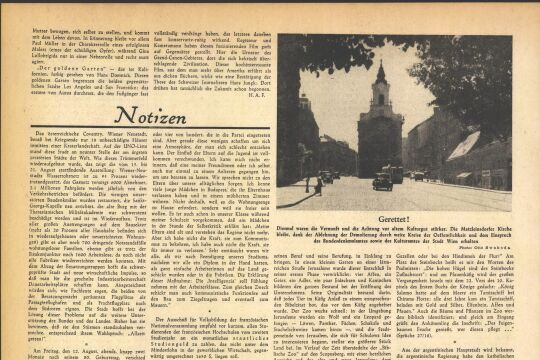Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Als Majorarzt im Kongo
„FASTEN SEAT BELT, NO SMOKING“, zeigt die Leuchtschrift im Innenraum der amerikanischen Hercules-maschine. Es ist die Führungsmaschine eines US-Transportgeschwaders, die der Kommandant, ein Colonel der Air Force, selbst steuert. Sein Co-Pilot ist ein Oberstleutnant, als dritter sitzt ein Arzt im Oberstleutnantrang in der Flugzeugkanzel. Im Inneren der Maschine sitzen eng nebeneinander entlang der Bordwand 42 Mann des österreichischen UN-Sanitätskontingents, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften. Die Ärzte stammen zum Teil aus dem aktiven Sanitätsoffizierskorps des Bundesheeres, zum größten Teil sind es Zivilärzte, die für die Dauer ihres Einsatzes die UNO-Uni-form mit dem ihrem Alter entsprechenden Dienstgrad mit dem Zivilrock vertauscht haben. Seit Tagen wurden Kraftwagen, Sanitätsgeräte, Wirtschaftsgeräte, eine komplette Lazaretteinrichtung in amerikanische Transportmaschinen vom Typ Globemaster am Schwechater Flughafen verladen. Endlich war der Tag der Abreise gekommen: ein Sommertag. Nicht jedem von uns ist es jetzt so wohl zumute, als man sich den Anschein gibt oder als man sich vor einigen Wochen freiwillig zu dem Unternehmen gemeldet hat. Der Abschied von den Angehörigen, ein völlig fremdes Land, fremde Menschen, die Ungewißheit, was die nächsten Monate bringen werden, sind Grund genug zu dieser Stimmung. Kurz nach dem Start sind alle trübsinnigen Anwandlungen verflogen, das herrliche Flugwetter, der Blick von oben auf die österreichische Landschaft und ihre Städte, viel Neues und Unbekanntes lassen keine Zeit dafür übrig. Und weiter geht es über die schneebedeckten Gipfel der Alpen, über die oberitalieni-sche Tiefebene, über das Tyrrhenische Meer entlang der Westküste Italiens, über das Mittelmeer Nordafrika zu.
Nach gut fünfstündigem Flug setzt die Maschine am Flugplatz des amerikanischen Flugstützpunktes Wheelus unweit von Tripolis auf. Mit der für die Amerikaner typischen Exaktheit ist alles ausgezeichnet organisiert. Wir werden von bereitstehenden Autos in unsere Unterkünfte gebracht, das Abendessen schmeckt ausgezeichnet und anschließend folgt ein kleiner Spaziergang unter dem südlichen Sternenhimmel, das erstemal auf afrikanischem Boden. Früh am nächsten Morgen geht der Flug weiter, diesmal über 12 Stunden bis Leopoldville mit einer einstündigen Zwischenlandung in Kano, Nordnigeria. So abwechslungsreich der gestrige Flug war, so eintönig ist er heute über der Sahara und dem afrikanischen Busch. Nach kurzer Dämmerung beginnt die Tropennacht, und gegen acht Uhr abends landen wir in Djili, dem Flugplatz von Leopoldville. Hier bekommen wir erstmals Kontakt mit UN-Dienststellen. Der Empfang ist freundlich, man ist bemüht, uns gute Quartiere für die Nacht anzuweisen, und nach einem kleinen Imbiß schaut man so rasch als möglich ins Bett zu kommen, um die paar Stunden bis zum nächsten Morgen, an dem es schon wieder zeitlich weitergehen soll, zum Schlaf auszunützen.
NACH WEITEREN VIER FLUGSTUNDEN am nächsten Vormittag ist unser vorläufiges Ziel erreicht. K a-m i n a, eine ehemals belgische Militärbasis, jetzt UNO-Stützpunkt in Ka-tanga, der Provinz Tschombes. Es ist Sonntag mittag, ein heißer, trockener Wind bläst über die ausgedorrte Ebene. Es dauert einige Stunden, bis wir die für die Unterbringung kompetenten Stellen aus der sonntägigen Ruhe mobilisieren können. Doch dann werden wir in hübschen Bungalows untergebracht und richten uns für die nächsten Wochen häuslich ein. Jede Nation innerhalb der UN hat im Kongo sein bestimmtes Einsatz- und Aufgabengebiet. Nach der unfreundlichen Aufnahme des ersten Kontingents durch die Eingeborenen in Bukawu — bekanntlich wurde es Monate zuvor gefangengenommen — war dort für uns kein Betätigungsfeld, und wir mußten warten, bis das UN-Hauptquartier in Leopoldville für uns Österreicher ein neues bestimmte. Inzwischen hatten wir Gelegenheit, uns als Ärzte und Sanitätspersonal im dortigen Krankenhaus und in den umliegenden Dispen-saires, das sind kleine Krankenambulanzen, zu betätigen. In der Freizeit war Möglichkeit zum Schwimmen. Gelegentlich wurden Fußballspiele gegen andere Kontingente arrangiert, manchmal auch gegen eine Balubamannschaft, wobei der Ausgang des Spieles für uns weniger rühmlich war, da die Schwarzen mit geradezu akrobatischer Geschicklichkeit mit dem Leder umzugehen verstehen.
Eines Abends erschienen in unserer Offiziersmesse ungefähr 40 Negerbuben im Alter von acht bis zwölf Jahren unter Leitung katholischer Patres aus der nahegelegenen Mission, die „Troubadours du Roi Baudouin“. Die hübschen Knabenstimmen, begleitet von Tatam-Trommeln, Tschondus und selbstverfertigten Xylophonen, waren ein unvergeßliches Erlebnis. Als besondere Überraschung sangen sie nach vielen Eingeborenensongs und anderen folkloristischen Darbietungen „Guten Abend, gute Nacht“ — in deutscher Sprache! Rege und zäh ist die Tätigkeit der größtenteils katholischen Massionäre, ein Erfolg jedoch erst auf weite Sicht, wie mir immer wieder in langen und interessanten Gesprächen mit diesen großartigen Idealisten geschildert wurde.
Ein zweitägiger Ausflug führte mich ungefähr 500 Kilometer in den Busch. Die Straßen, anfänglich noch asphaltiert, werden mit zunehmender Entfernung immer schlechter, die Sandpisten werden zu ausgefahrenen Pfaden, die man nur mit dem Jeep bewältigen kann. Die Fahrt ist äußerst strapaziös, jedoch durch die gewonnenen Eindrücke Iohnenswert. Der von den Eingeborenen kilometerweit angezündete Busch, eine wenig waidgerechte Art der Jagd, eine von Missionären geleitete Leprastation und endlich die Eingeborenendörfer abseits jeglicher Zivilisation. In einem einzigen Raum einer Lehmhütte spielt sich das Leben dieser Menschen, die wenigstens Jahrhunderte hinter uns Europäern sind, ab. Die Primitivität ist unbeschreiblich. Wir lassen unsere Fährzeuge mitten im Ort anhalten, werden sofort von den Bewohnern umringt, sie machen jedoch einen durchaus friedlichen Eindruck, wollen Ananas, Bananen, Papayas verkaufen und sind sehr neugierig. Abenteuerlich ist die Bekleidung; die Frauen tragen buntbedruckte Stoffe, die Männer alte, zerrissene Hosen, manchmal Hemden, zerbeulte Hüte, einige haben Schuhe, die meisten sind barfuß.
Alles wirkt verkommen und entsetzlich schmutzig. Nach kurzem Palaver, meistenteils in Zeichensprache, und Kauf von einigen Früchten, vielleicht auch einem alten Speer oder einer Tamtam als Souvenir, verlassen wir die Siedlung, die winkenden Bewohner und eine Staubwolke zurücklassend.
EIN GANZ ANDERES von dem mir bisher bekannten Afrika lernte ich in Stanleyville und seiner Umgebung kennen. Zunächst fällt der klimatische Unterschied auf. Hier, ganz nahe dem Äquator, ist es rein tropisch, feucht und schwül, häufig Regen, der kaum Abkühlung bringt; die Vegetation üppig und farbenprächtig. Wundervoll ist der Blick vom Balkon meines Hotelzimmers auf den direkt unter mir fließenden Kongo, dessen Farben je nach der Tageszeit vom lehmigen Gelbbraun über Grün und Blau bis Silber wechseln. Während man in Kamina in einer Art militärischer Enklave lebt, befindet man sich hier mitten unter der einheimischen Bevölkerung, während man dort nur gelegentlich Negerdörfer besuchte, hat man hier Gelegenheit, die Kongolesen ständig zu beobachten, ihre Lebensgewohnheiten zu studieren, ihren Tagesablauf mitzuerleben. In der Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung sind sie verhältnismäßig zivilisiert und aufgeschlossen, allerdings nicht arbeitsamer. Eines Morgens, es regnete in Strömen, kam ich in meine Ambulanz und fand zu meinem Erstaunen statt der üblichen dreißig bis vierzig Patienten keinen einzigen vor. Auf meine Frage sagte mir der Infirmier, daß bei Regenwetter die Neger nicht zu arbeiten brauchen, also auch nicht zur ärztlichen Behandlung gehen. Einmal kam in meine Ordination ein Minister der Regionalregierung mit Frau, Kindern, Schwiegermutter und noch zwei weiblichen Mitgliedern der Familie. Er ließ sich und seine Angehörigen genauestens untersuchen, Ratschlage geben und Medikamente verordnen. Ich erklärte ihm, daß ich die ärztliche Untersuchung kostenlos durchführen wolle, obwohl er nicht der UNO angehöre, er aber die Medikamente bezahlen müsse. Er erwiderte mir, daß er den Betrag anweisen werde — und kam nie wieder...
Der oberste Sanitätschef bei den UN ist ein indischer Oberstarzt, ein vollendeter Gentleman, der besonders uns Österreichern sehr gewogen war. Wiederholt stattete er unserem Kontingent in Stanleyville Besuche ab, war von unserer Arbeit sehr beeindruckt und von unserer bescheidenen Gastfreundlichkeit sehr angetan.
UND WIEDER ANDERS ist die Wirkung, die die Hauptstadt Leopoldville auf den Fremden macht. Breite Avenuen, gepflegte Parks, moderne Hochhäuser erwecken den Eindruck einer neuzeitlichen Großstadt. Allerdings ist das nur der erste Eindruck. Bei genauerem Hinschauen erkennt man auch hier die Zeichen der Anarchie. Es fehlt eine geregelte Verwaltung, alles lebt von heute auf morgen, in den Auslagen der Geschäfte findet man Waren von einer Qualität, wie sie bei uns kurz nach dem Krieg angeboten wurden. Die Restaurants schließen gegen 22 Uhr, einige wenige Nachtlokale mit Phantasiepreisen bleiben die Nacht durch geöffnet. Direkt angrenzend an die Innenstadt liegen die Eingeborenenviertel, die zum Teil ansehnlicher sind als anderswo. Lehmhütten sind seltener, manche Bezirke dieser Siedlungen bestehen aus äußerlich recht hübschen Wohnblöcken, die, will man sich den Eindruck bewahren, man von innen besser nicht ansieht. Dreißig Kilometer außerhalb von Leopoldville liegt auf einer Anhöhe eine Ansammlung großer, schöner Gebäude, eine Klinik, ein herrliches Schwimmbad, eine in modernstem Stil gebaute, dabei äußerst geschmackvolle Kirche: Die Jesuitenuniversität Lovanium. — In Leopoldville ist als Zentrale ein großes UN-Hospital, ein riesiger, erst wenige Jahre alter Komplex, der noch zu Zeiten der Belgier erbaut worden war, modernst eingerichtet. Ich hatte Gelegenheit, dieses Krankenhaus und seinen Betrieb genauer kennenzulernen. Hier gibt es fast alle Abteilungen einer Klinik, die indischen Ärzte, unter deren Leitung es steht, sind auf fachlich anerkennenswerter Höhe, die Schwestern und das übrige Pflegepersonal exakt und besorgt. Ich hatte durchaus den Eindruck von einem Krankenhausbetrieb, wie er bei uns kaum besser zu finden sein wird. Wenn man zudem die Schwierigkeiten berücksichtigt, die sich allenthalben in diesem Lande derzeit entgegenstellen, kann man den indischen Ärzten und ihrem Sanitätspersonal Bewunderung nicht versagen.
Je länger ich in Afrika weilte, desto schneller verging mir die Zeit. Als ich nach Österreich zurückberufen wurde, wähnte ich erst einige Wochen da gewesen zu sein, und doch war über ein halbes Jahr vergangen. Nichtsdestoweniger begrüßte ich erfreut die die Heimat verheißenden Berge, als ich auf der Rückreise in Oberitalien das erstemal meinen Fuß wieder auf europäischen Boden setzte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!