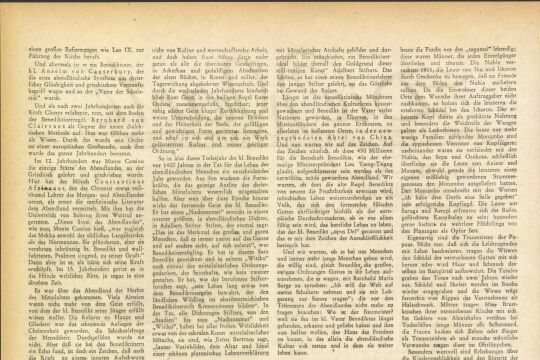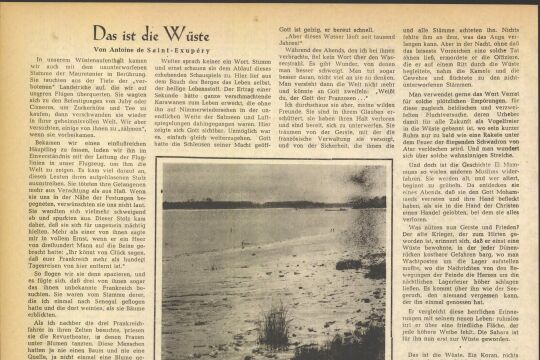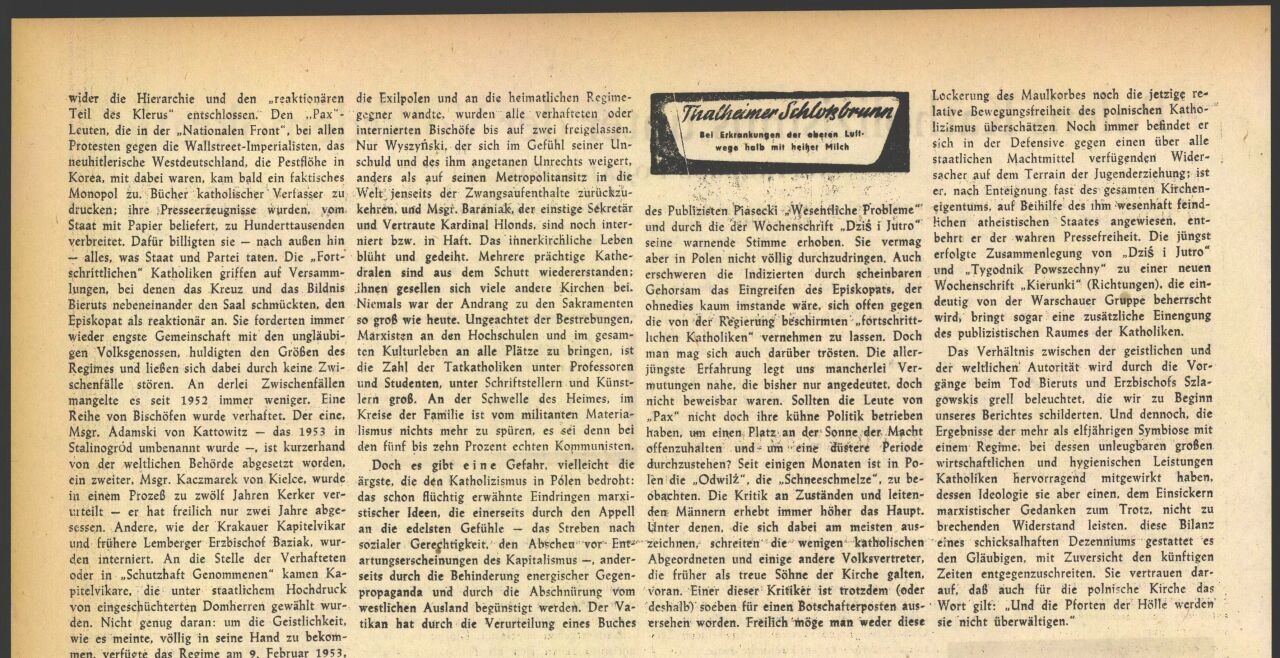
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Kreuz von Karasburg
Im Jahre 146 landete der portugiesische Seefahrer Bartholomäus D i a z in AngYä Pe-quena und errichtete dort ein eisernes Kreuz. LHe rauhen Felsen der Küste mit ihren dahinter liegenden, bis zu 200 Meter hohen Sanddünen und der vollständig wasserlosen Namibwüste versperrten ihm das Vordringen in das Innere des Landes. Erst 12 ließ sich der Bremer Kaufmann Adolf L ü d e r i t z hier nieder, er-, warb vom Hottentottenhäuptling Josef Frederiks von Bethanien ein Stück Land und .nannte von. da ab Angra Pequena „Lüderitzbucht“. Dort landeten viele unserer Missionäre..
Kahle Felsen, auf denen das Hafenstädtchen nach .europäischem Stil erbaut.ist, grüßen den Neuankommenden. Die von-den Deutschen in den Jahren 1906 bis 190 erbaute Bahn bringt ihn dann ins Innere des Landes. Langsam nur erklimmt sie die steile Küste und führt dann durch die hohen, rötlichen Sanddünen. Kolonnen von schwarzen Arbeitern schaufeln das Geleise immer wieder frei von dem stellenweise meterhoch angewehten Sand. Die Sanddünen laufen allmählich aus in die völlig vegetationslosen und wasserlosen Sandflächen der Namibwüste.
Längs der Bahn führt auch eine „Autobahn“ ins Innere des Landes. Vielfach sind es nur zwei im Sand eingefahrene Radspuren. Oft sind diese nicht einmal mehr sichtbar, da sie vom Sand zugeweht sind. Manchmal zeigen dem Autofahrer nur noch mit Sand gefüllte Zementfässer längs der „Päd“, daß er noch auf dem rechten Weg ist. Große Warnungstafeln in drei Sprachen künden ihm immer wieder, daß er sich im „Sperrgebiet“ der Diamantenfelder befindet und er den Weg nicht verlassen dürfe, ohne schwerer Strafen gewärtig zu sein. Wehe dem Autofahrer, der kein festes und verläßliches Fahrzeug hat:. 130 Kilometer weit findet er keine Hilfe, wenn nicht zufällig ein anderes Auto des Weges kommt.
Nirgends ist ein Baum zu erspähen, unter dem man etwas kühlenden Schatten finden könnte. Der Weg zieht sich durch unendliche, weite Flächen der Wüste. Die roten Sanddünen sind hinter uns. Weißer, kieselartiger Sand glitzert nun, der Tropensonne ausgesetzt, und tut den Augen weh. In der Ferne tauchen die „Ausberge“ auf. Da liegt in einer Höhe von 1447 Meter das malerische Gebirgsdörfchen Aus. Man sagt, es hätte den Namen davon, weil es da mit der Wüste aus sei. Eine Herde. Straußvögel stolziert durch die Wüste. Scheu springen ein paar Springböcke in weiten Sätzen davon, aufgeschreckt durch das Motorengeräusch. Normalerweise kann man heute mit dem Kraftwagen in drei Stunden, mit der Bahn in sieben Stunden, die Namibwüste durchqueren. Die Pioniere des Landes brauchten früher mit dem Ochsenwagen drei Wochen. Im Wüstensand gebleichte Skelette von Zugtieren zeugen noch von den uns heute unvorstellbaren Opfern dieser Zeit.
Nach Aus ändert sich das Landschaftsbild. Es beginnt das Hochplateau des Farmlandes. Unendlich weite Flächen, die von langgestreckten Hügelformationen durchzogen sind. Trockene Flußbette durchziehen die Landschaft. Die Flüsse führen nur zur Regenzeit (von Dezember bis März, hier dem Hochsommer) manchmal Wasser für ein paar Stunden oder Tage, ie nach dem Regenfall. Der Regen kommt nur mit starken Gewittern verbunden, denen gewöhnlich ein heftiger Sandsturm vorausgeht. Vielfach jedoch bringen die Gewitter nur „afrikanischen“ Regen, d. h. Sandstürme. Längs der trockenen Flußbette stehen auch einige Dornbüsche und Kameldornbäume. Sonst sieht man nur. so weit das Auge reicht, weit zerstreut, einzelne kleine Dornbüsche, dazwischen vertrocknete Gras-büschel. die den Tieren als Weide dienen, Wiesen, Felder oder Wälder gibt es hier nicht.
Das ganze Land Wird von den Europäern beherrscht. Gewisse Teile sind als „Reservate“ den Eingeborenen zugewiesen. In diesen haiten sich aber meist nur ältere und gebrechliche Leute mit ihren paar Ziegen, ihrem einzigen Reichtum, auf. Die weiße Regierung sorgt für Wasser. Die Bohrlöcher haben oft eine Tiefe von hundert Metern. Alle arbeitsfähigen Eingeborenen stehen im Dienste der Europäer als;deren Viehwächter oder Farmarbeiter, wo sie sich ihr karges Brot verdienen. Neben jeder europäischen Siedlung ist hier auch eine Siedlung der Eingeborenen — , Werft“ genannt. Die Trennung zwischen Europäern und Eingeborenen ist hier scharf ausgeprägt.
Das Land ist, abgesehen von den Eingeborenenreservaten, aufgeteilt in Farmen, die im Besitz der Europäer sind und in ihrer Größe von 5000 bis 60.000 Hektar wechseln, je nach der Fruchtbarkeit, die durch den Regenfall und die erschlossenen Wasserstellen bedingt ist. Der Regenfall im südlichen Teil Südwestafrikas (der uns Oblaten des heiligen Franz von Sales zur Missionierung anvertraut ist) ist sehr gering und beträgt jährlich zwischen 90 und 100 Millimeter, in Trockenjahren nicht einmal soviel. Linser Missionsgebiet liegt in diesem südlichen rege'narm'eh Teil des Landes. Es ist wohl nicht nur das regenärmste, sondern auch das sand-und steinreichste Missionsfeld Südafrikas, wohl auch das schwierigste und ärmste. In unserem Missionssprengel (Apostolisches Vikariat Keet-manshoop), das beinahe 290.000 Quadratkilometer umfaßt, wohnen nach der 1953 erstellten Statistik 17.000 Europäer und 59.600 Eingeborene. Unser Vikariat ist dreieinhalbmal größer als Oesterreich.
Die Europäer sind durchweg Protestanten und Calviner, nur 510 sind nominell katholisch. Von den 59.600 Eingeborenen bekennen sich heute 13.700 zum katholischen Glauben, die übrigen gehören zum Großteil der protestantischen Kirche, aber auch verschiedenen Sekten an. Nur ein ganz geringer Prozentsatz sind noch Heiden. Auf diesem ungeheuren Missionsfeld mit einer so geringen Bevölkerung arbeiten heute auf katholischer Seite ein Missionsbischof, 30:Priester, 7 Brüder, 75 Schwestern und 56 Ka-techästen (Lehrer).
Als die katholische Mission hier im Jahre IS9S Fuß faßte, mußte sie sich mit der Tatsache abfinden, daß die protestantische Kirche (Rheinische Mission) hier bereits sechzig Jahre unter den Eingeborenen gearbeitet hatte und sie schon zum Großteil für das Christentum gewonnen hatte. Bis 1907 konnte die katholische Mission hier nur in der Stille arbeiten, da die deutsche Regierung neben der protestantischen keirie andere Missionstätigkeit unter den Eingeborenen erlaubte. Erst als einer unserer Patres (P. Malinowsky) den Frieden zwischen der deutschen Schutztruppe und den kriegführenden Eondelwarts (Hottentotten) 1906 vermitteln konnte, erhielten wir von der Regierung die Erlaubnis, unter den Eingeborenen öffentlich zu missionieren und Missionsstationen zu gründen.
Trotz all dieser Schwierigkeiten haben wir hier heute 26 Schulen mit über 3000 Schulkindern. Die nötigen Schulgebäude mußte die Mission selbst herstellen, aber die Regierung bezahlt bisher die staatlich geprüften Lehrkräfte (weiße und farbige) und stellt auch das Inventar der Schulen. Hoffentlich bleibt es so. Das Unterrichtswesen ist sehr gut ausgebaut. Die Schulkinder wie auch die Erwachsenen sind hier durchweg zweisprachig, wenn nicht dreisprachig. Die Unterrichtssprache ist neben der Eingeborenensprache (Nama-Hottentott oder Herero) in den unteren Klassen Afrikaans (Landessprache) oder Englisch (zweite Landessprache). Die Kinder bekommen auch wenigstens einmal am Tage eine Mahlzeit (Hülsenfrüchte oder Maisbrei), die die Regierung zur Verfügung stellt.
Die Eingeborenen sind gewöhnlich sehr arm. Da sie kein Stück Grund käuflich erwerben können, wo sie ihr eigenes Heim errichten können, sind sie gezwungen, ihre Hütten (Pontok) nur auf fremden Grund aufzustellen, wo sie eben gerade Arbeit finden. So haben wir es hier mit einem ausgesprochenen Nomadenvolk zu tun, wodurch die seelsorgerliche Betreuung sehr erschwert ist. Heute sind die Leute hier und in ein paar Wochen oder Monaten schon wieder anderswo, vielleicht hundert Kilometer weit weg bei einem anderen Arbeitgeber. Deswegen genügt den Leuten auch als Wohnung eine einfache Hütte, die sie jederzeit abbrechen und und wieder auf einem anderen Platz aufschlagen können. Ein paar dünne Stecken werden im Kreis in den Boden gegraben, oben zusammengebunden, waagrecht ebenfalls ein.paar Stecken, und darüber alte Säcke, Pappendeckel, Blechstücke von Konservendosen, die sie irgendwo aufheben; das ist alles, woraus gewöhnlich die Hütten bestehen. Ein hur ganz notdürftiger Schutz im Sommer gegen die brennende Sonne und im Winter gegen die schneidene Kälte. Ein Kochtopf mit drei Füßen ist der Herd. Als Hauptnahrung .dienen ihnen Maisbrei etwas “Fleisch und Milch, soweit sie Ziegen halten können. Sie sitzen und schlafen gewöhnlich auf bloßem Boden. .. “
Im Sommer kann es hier sehr heiß weiden.
50 Grad Celsius im Schatten sind keine Seltenheit. Im Winter jedoch fällt nachts die Temperatur oft unter Null und steigt tagsüber wieder auf 20 bis 30 Grad. Dieser große Temperaturwechsel ist auch die Ursache der vielen Erkrankungen unter den Leuten. Sie haben keinerlei Schutz gegen Kälte und Wind im Winter. Mit hohem Fieber liegen die Kranken oft in ihren armseligen Hütten auf einem auf dem Boden ausgebreiteten Fell. Daheim kann man sich das gar nicht vorstellen.
Das Seelsorgegebiet der meisten hiesigen Missionsstationen ist gewöhnlich so ausgedehnt wie daheim eine große Diözese. (Der Schreiber dieser Zeilen wirkt seit etwas über zwei Jahren in Karasburg, einer Missionsstation, die .128 bis ISO Kilometer nördlich vom Oranjefluß liegt.) Das Seelsorgegebiet von Karasburg hat die Größe Kärntens. — Größere Siedlungen der Europäer liegen in einer Entfernung von durchschnittlich 200 Kilometern voneinander.
Der Missionar baut mit Hilfe von Wohltätern aus der Heimat, soweit er eben Hilfe bekommt, Schulen und Kirchen für die Eingeborenen. Freilich muj. er ihnen auch materiell helfen und ihre Not lindern, soweit es eben in seinen Kräften steht. Die Schulkinder müssen nicht nur von den weit entlegenen Plätzen zusammengesucht und in die einzelnen Missionsstationen gebracht, sie müssen dort aueji verpflegt und oft - auch eingekleidet werden. Ohne Schulen ist eine Mis-sionsärbeit unmöglich.
Ueberdies erfordert die seelsorgerliche Betreuung große körperliche Strapazen und kostet viel Geld. Versehgänge, besser gesagt Versehfahrten, bis zu 100 Kilometer und mehr sind keine Seltenheit. Um den Gläubigen auf den weit zerstreuten Farmen und Außenplätzen ab und zu Gelegenheit für Gottesdienst und Sakramentenempfang zu bieten, legt der Pater an Sonntagen oft über 200 Kilometer zurück, nur um an einem oder zwei Plätzen Gottesdienst halten zu können, wobei er vielleicht bis zu dreißig Leute zusammen erreichen kann. Die Eingeborenen besitzen nichts, sie können daher auch nichts geben. Ja, sie suchen noch Hilfe beim Missionar. Der Missionar soll und muß ihnen helfen.
Im Angesicht des unvorstellbaren Elends denke ich oft an das Gleichnis in der Heiligen Schrift, wo der Heiland vom reichen Prasser und einem armen Lazarus spricht. Dieser arme Lazarus sind die armen Menschen hier. Aber auch für sie ist Gottes Sohn Mensch geworden, am Kreuz gestorben, und. will, daß auch sie Seine Brüder seien. . ..............
Hilf.' einem hilfesuchenden Missionar, damit er diesen Aermsten der Armen ein barmherziger Sämaritan ssin kann!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!