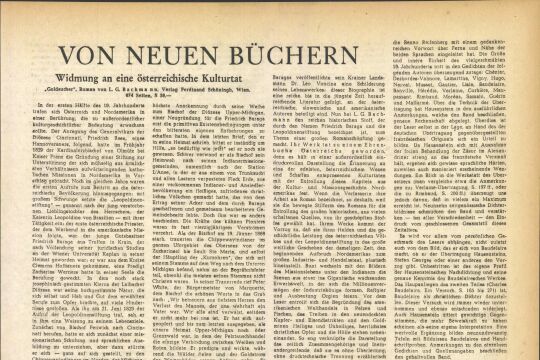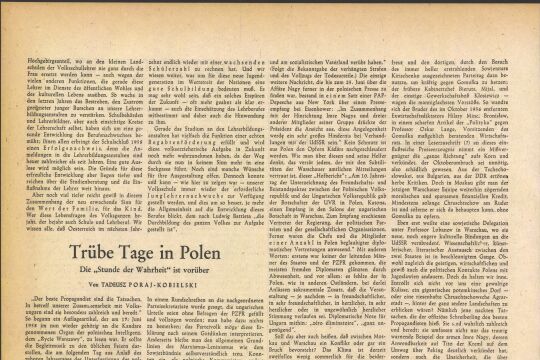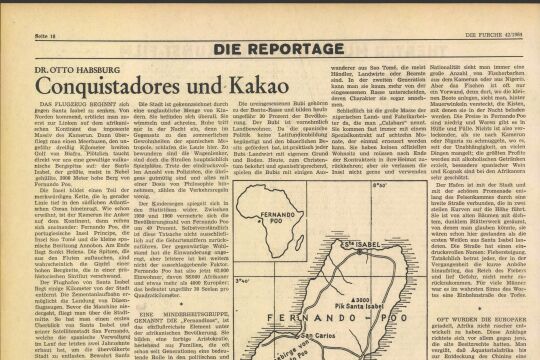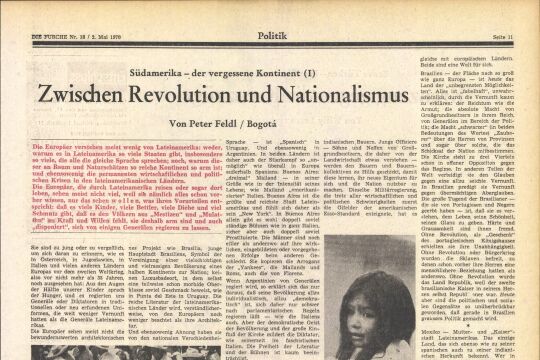WENN MAN NACH MEXIKO von dem texanischen Grenzort EI Paso herkommt, gelangt man nach 375 km zu der ersten größeren Stadt, Chi-huahua. Diese Hauptstadt des gleichnamigen Staates, deren 150.000 Einwohner fast 1400 m hoch wohnen, ist vor allem dafür berühmt, daß hier Pater Hidalgo und General Allende, zwei Begründer der mexikanischen Unabhängigkeit, 1811 von den Spaniern hingerichtet wurden.
Obwohl 1709 gegründet, weist die Stadt reicht so viele historische Gebäude auf wie andere mexikanische Städte. Dagegen ist sie für mexikanische Verhältnisse wohlhabend, da sie im Zentrum eines landwirtschaftlichen- und Bergwerksgehietes 'liegt. Mit Erstaunen bemerkt der Besucher europäisch-altertümliche Trachten der Menoniiten in dem Straßenbüld. Die Menoniten kamen zu Ende des vorigen Jahrhunderts aus den Vereinigten Staaten und leisteten einen beträchtlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Staates. Dabei drängten sie aber die Tarahumara-Indianer zurück. Diese hatten als Nomaden die Landwirtschaft des ungeheuren Gebietesi, das sie durchstreiften, wenig gefordert.
DIE TARAHUMARAS HATTEN MEINE Aufmerksamkeit geweckt, als ich in amerikanischen Zeitungen las, ein Jesuiiitenipater, der sie betreute, habe ihr großes Elend in Vorträgen eindringlich geschaudert. Daraufhin sei in Louisiana ein Hilfszug mit zehn Waggons zusammengestellt worden, der aber von der mexikanischen Regierung aus beleidigtem Nationalstolz nicht angenommen worden sei.
Um einmal Indianer zu sehen, die von der Neuzeit weniger berührt waren aus ihre amerikanischen Stammesgenossen, zog es mich zu den Tarahumaras.
Von Juanito aus fuhren wir per Bahn, da es nur eine äußerst vernachlässigte Sandstraße gibt, nach Creel — dem AufenfthaMsort des Jesuitenpaters.
In Creel fanden wir ein Hotel vor, das uns, entsprechend der Gegend, wie das Imperial anmutete, für 20 Zimmer gab es zwei Bäder. In den drei Tagen, die wir dort verbrachten, verirrten sich vier Amerikaner dahin. Die Amerikaner kamen mit der Bahn. Man kann von dem Badeort Mazatlan aus mit der Bahn nach El Paso fahren. Manche Leute unterbrechen in Creel, um den Baranca del Cobre zu besuchen, eine Schlucht, tiefer als der berühmte Grand Oan-yon in Arizcna. In der mit Orchideen bewachsenen Talsohle hausen die Tairahumaras.
Im Zeitalter des Tourismus gibt es ein riesiges Gebiet, das, nur 150 km von der texanischen Grenze entfernt, ein Ferieraparadies werden könnte, aber noch unberührt ist. Creel (3000 Einwohner) hat nur ein Hotel und ein Restaurant für Ausländer. Die Mahlzeiten sind mehr teuer als gut. Licht gab es nur von 18 bis 22.30 Uhr.
Am Morgen suchten wir zuerst das Pfarrhaus auf. Jedoch der Pfarrer war in Sisgouichi, dem Sitz des jesuitischen Bischofs, der der Mission vorsteht. Es gibt zehn indianische Pfarreien, die von zehn Pfarrern und 13 Fraitres des Jesuitenordens betreut werden. Ihnen helfen fünf Maristen-Fratres und achtzig Nonnen. Die Jesuiten unterhalten acht Internate, vier Schulen für Externe, 40 Schulen, in denen per Radio gelehrt wird, drei Spitäler und acht Krankenreviere. Ein Spital in Creel speziell für Kinder. Um die Größe der Aufgabe, die sich die Jesuiten gestellt haben, zu ermessen, muß man wissen, daß das Tarahumara-gebiet beinahe 42.000 Quadratkilometer umfaßt. Es wirrt von 56.000 Indianern in 1774 Dörfern bewohnt.
MIT DEM ALLRAD-COMBI des Hotels fuhr ich in das Gebiet, das 6 km nach Creel beginnt, und zwar zu einem Flughafen. Er wird von amerikanischen Ärzten benutzt, die monatlich einfliegen, sowie von unregelmäßig verkehrenden kleinen Personen- und Frachtflugzeugen. Wir flogen nach Chihuahiua und sahen dort eine Höhle, in der eine Tarahu-
mara-Familae lebt. Nach außen weit offen, so daß die kalten Winde ungehemmt hereinziehen können — es kann Frost neun Monate im Jahr geben —, Decken und Wände ruß-gaschwärzt, ich war verblüfft, daß diese Indianer so primitiv lebten.
Die Höhte wies nichts a/utf, was das Leben erleichtert. Die Familie schlief auf einem großen Hoüzgesteill, zusammen unter einer schmutzigen Decke. Die Nahrung bestand aus getrockneten Maiskörnern, die dm einer alten Benzinkanne aufbewahrt wurden. Aus den Körnern machen die Indianer „Pimote“, das sind geröstete, gemahlene Maiskörner, die mit Wasser gemischt werden. Das Wasser muß über weite Strecken hergeholt werden, denn es gibt nur wenige Quellen. Selbst in Creel ist das Wasser knapp.
Die jungen Tarahumaras haben schöne Gestalten, kräftige Beine. Sie sind als Langläufer berühmt, heißt doch Tanahumara Läufer.
Wenn die Männer in die Stadt gehen, tragen sie eine weiße Bluse, rote Knickers und binden Sich ein weißes Tuch um den Kopf. Die Frauen müssen sich mit abgetragenen Kaittunkleidern begnügen.
Das Land, das sie bewohnen, ist hart und karg. Häufig kann der Mais nicht geerretet werden, weil der Frost zu früh hereinbricht. Die Tarahumaras besitzen ausgedehnte Waldungen. Aber es fehlt ihnen an Kapital, um das Holz selbst zu schlagen und zu verarbeiten. Darum haben sie die Wälder an Mexikaner verpachtet, von denen sie finanziell arg betrogen werden.
Seit der Verpachtung der Wälder haben die indianischen Gemeinden nicht nur keime Einnahmen erhalten, sondern das wenige Geld, das sie zusammengespart hatten, verloren. Jedes Jahr werden sie mehr verschuldet.
Mit Hilfe der Jesuiten haben die Tarahumairas Deputationen in die Hauptstadt geschickt, um sich über die Pächter zu beschweren. Vergeblich. In Mexiko gibt es nicht, wie in den USA, eine Regierungsstelle, die dlie Interessen der Indianer wahrnimmt. Die Mexikaner haben zuviel mit sich zu tun, als daß sie sich um die Indianer kümmerten. Allerdings setzt die Regienjng jährlich einen bescheidenen Betrag aus, um die Indianer vor dem Verhungern zu schützen.
Wiederholt hat die Regierung
Beamte geschickt, die die Beschwerden der Indianer überprüfen sollten. Diese erklärten jedesmal die Beschwerden für unbegründet, nachdem die Waldpächter ihnen angemessene Zuschüsse zu ihrem mageren Gehalt zugesteckt hatten.
Der gegenwartige Präsident, Oiaz Ordaz, versprach, sobald er Beweise in der Hand habe, rücksichtslos durchzugreifen. Aber die Amtszeit eines Präsidenten ist zu kurz, um die Korruption, die das öffentliche Leben in Mexiko zerfrißt, zu beseitigen.
DEN TARAHUMARAS WARE GEHOLFEN, wenn man es ihnen er-
möglichen würde, Kooperative zur Ausnützung ihrer Wälder zu bilden. Jedoch, wer wird diesen Kooperativen Geld borgen? Ist doch das Geld so knapp, daß der Mindestzimsfuß 10 Prozent beträgt. Nutzbringend wäre es für sie, wäre das Gebiet dem Tourismus erschlossen. Jedoch, da nun diese scheuen Nomaden nicht so gewiegt sind wie ihre Brüder in den USA, werden sie die Fähigkeit, die Touristen zu .^schröpfen“, erst nach und nach entwickeln. Dringend wäre der Ausbau einer guten Autostraße — als Vorbedingung für die Erschließung dieses Gebietes —, aber die mexikanische Regierung hat einen Straßenbau erst für 1973 vorgesehen.
Infolgedessen sieht die unmittelbare Zukunft für die Indianer nicht verlockend aus. 80 Prozent ihrer Kinder werden nach wie vor sterben,
bevor s<e das fünfte Lebensjahr erreicht haben.
Wir trafen in Creel eine Dame aus Colorado, die Gelder für das Kinderspital sammelt. Creel hat einen einzigen Arzt. Orte wie Creel hätten überhaupt keinen Arzt, wenn diese
nicht von der Regierung gezwungen würden, nach Absolvierung ihres Miliitärdienstes in sollchen Orten anzufangen.
Die Dame führte uns in das Spital. Hier sah man Kinder, die ebenso-viele Pfund wogen, wie sie Monate zählten.
Die Krankenschwestern waren drei halbwüchsige Mexikanerinnen, die sich ihrer Patienten mit mehr Liebe als Erfahrung annahmen. Da sie aber, mit Ausnahme des Kochens, auch noch die Hausarbeit verrichten mußten, fehlte es ihnen an Zeit.
In einem Bett lag ein kleines Kind, das unnatürlich ruhig und apathisch vor sich hinschaute. Seine Eltern
kümmerten sich überhaupt nicht um das Mädchen.
Im allgemeinen sind die Indianer gute Eltern, die ihre Kinder über Entfernungen bis zu 80 km ins Krankenhaus tragen und trotz der Entfernung mehrmals im Monat besuchen. Dabei verbringen sie mehrere Nächte auf dem Erdboden neben dem Spital.
Da lag in einem Gitterbett ein achtjähriger Bub, der ausgesetzt worden war, weil er geistig zurückgeblieben. Eines Tages war er am Weg gefuntdien worden.
Von den 18 Kindern, die in dem Spital lagen, wiesen höchstens zwei normales Gewicht auf.
Ais Arzneien gab es Verbände und Penicillin. Man bemüht sich, amerikanische Ärzte dazu zu bringen, ihre Arzneiproben, die sie von den che-
mischen Fabriken erhalten, dem Spital zukommen zu lassen.
Die Mission benötigt dringend einen Allrad-Krankenwagen, mil dem die Indianer in die verschiedenen Spitäler gebracht werden können.
IN MEXIKO HAT DIE KIRCHE lange Zeit die Vermehrung ihrer Reichtümer für ihre vordringliche Aufgabe angesehen. Zur Zeit Maximilians gab es 'in den mexikanischen Kirchen mehr Gold und Juwelen als in irgendwelchen anderen Kirchen Amerikas. Der soziale Unterschied zwischen dem hohen und niedrigen Klerus war schroff. 1865 erließ der Kaiser ein Gesetz, das Gehorsam gegenüber den päpstlichen Erlässen verfügte und andererseits die Nationalisierung des Kirchen-eigentumes, die bereits 1859 von Benito Juarez verordnet worden war, aufrecht erhielt. Dafür woilrte der Staat die Kirche unterstützen.
In Creel bemerkte ich mit Verwunderung den Bau einer neuen Kirche, obwohl die alte für 3000 Einwohner durchaus ausreichend schien. In Mexiko sind besonders die Armen gläubige Christen. Auch die oberen Schichten sind fromm, während die noch recht kleine, aber aufstrebende Mittelklasse gegenüber Tradition und Religion skeptisch eingestellt ist.
Ich fragte den Pfarrer, ob der Bau einer neuen Kirche wichtiger sei als ,die Erweiterung des Spitals. „Beides ist wichtig“, entgegnete der Geistliche. „Die Mexikaner wollen eine neue Kirche und sind am Spital weniger interessiert. Andererseits werden alle Beträge, die für das Spital bestimmt sind, auch nur für dieses verwendet.“
Im Verlauf des Gespräches verlor ich meine anfänglichen Vorbehalte, denn Pater Louis J. Verplanken (flämischer Abstammung, aber in Mexiko geboren) zeigte, daß er trotz der großen Kluft, die ihn von den Indianern trennt, der gute Hirte geblieben war. Der 40jährige Geistliche war ein guter Organisator. Bei den den Zeitströmungen gegenüber Aufgeschlossenen fanden meine kritischen Fragen in bezug auf die soziale und politische Entwicklung Mexikos größeren Widerhall als erwartet.
Bald war dlas Gespräch auf die von der Regierung nicht angenommene Wohlfaihrtgsendung gekommen. Der Pfarrer meinte, wenn die amerikanischen Spender ihre Wohltaten nicht sosehr propagiert hätten, wäre Sie angenommen worden.
Ich sah in 'einem Lagerhaus einen Teil der Spenden. Die Spender hätten keine Veranlassung, sich zu loben. Ein großer Teil der Sachen hätte nämlich in einen Abfalllkübel gehört.
Wir unterhieillten uns ausführlich über die Hilfe, die die Mission den Indianern angedeihen läßt. Es schien mir, daß hier die Jesuiten wirklich
die dienende und liebende Kirche verkörpern, wenn sie auch unvermeidlicherweise nur einen sehr kleinen Teil der Not beseitigen können.
Mit wachsender Erleichterung verließen wir das schöne, aber so grausame Land.