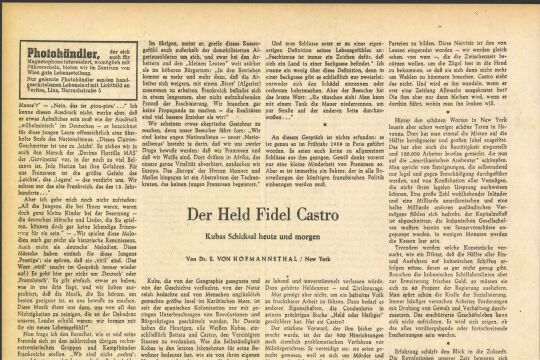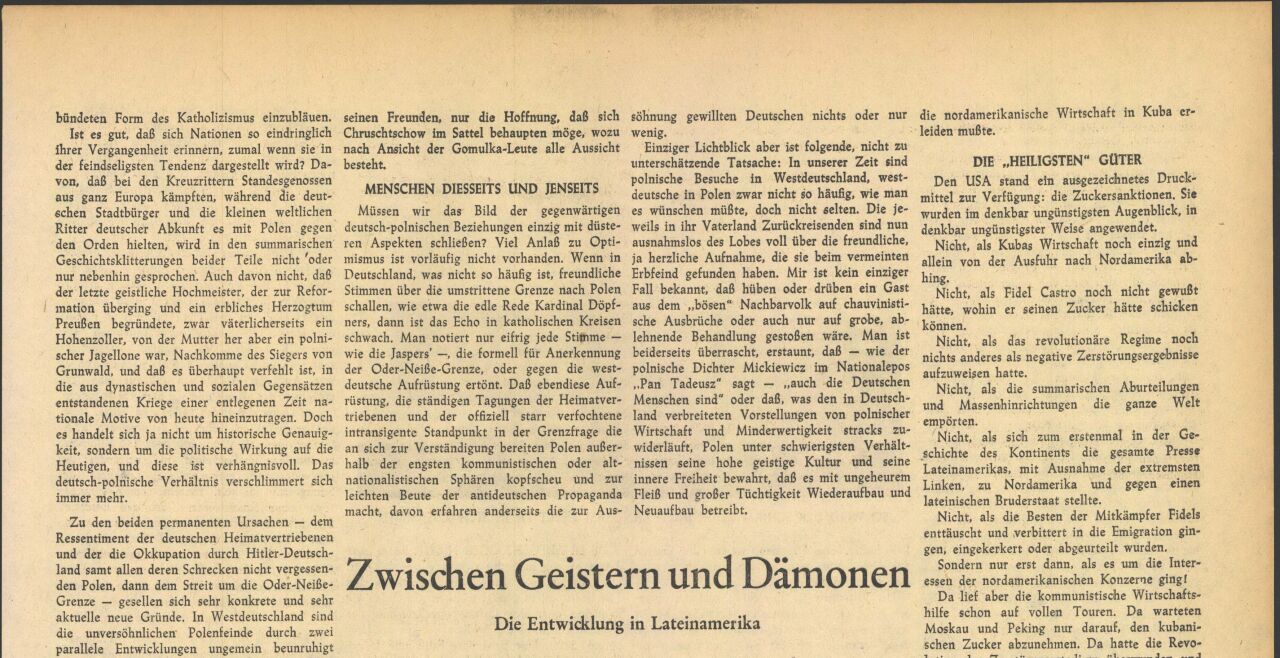
Gestern waren es Guatemala und Nikaragua, weil Präsident Idigoras Fuentes' Vorgänger der mit nordamerikanischer Hilfe gestürzte Chilo-Kommunist Arbenz war und Präsident Luis Somoza der Sohn eines mit nordamerikanischer Hilfe gehaltenen Diktators ist.
Heute könnte es Kolumbien sein, weil die roten „Kleinfürsten“ Julio Merchan und Cruz Varela aus den Anden vorbrechen, um gegen den „Yankeefreund“ Lleras Camargo zu marschieren, oder Bolivien, weil die Bauernmilizen aus Cochabamba ihre Stammesfehden unter Anti-Yankee-Devisen und mit kommunistischer Hilfe ausfechten wollen. Morgen können es die Arbeiter der Kupferminen von Chile sein, weil m.- di5 ,.nqidame4kanischen Gesellschaften nationalisieren“ wollen, oder das paraguayische „Movimiento de 14 de Maio“, weil es wieder einmal General Strössner stürzen will, oder die Studentenschaft Perus, weil sie den mit nordamerikanischem Geld regierenden General Beitran des „Verrates an der Nation“ bezichtigt, oder Ekuador, weil die „Federacion Ekuadoriana de los Indios“ im Zeichen des Anti-Yankeetums aus ihrem Schattendasein herausgerissen werden soll, oder Argentinien, weil sich Peronisten und Fidelisten gegen Frondizi und die Soldaten erheben, die gemeinsam mit Wirtschaftsminister Alsogaray das Land an die „Fremden verkaufen“, oder Brasilien, weil sich die jährlichen „Hungerkolonnen“ aus den Notstandsgebieten des Nordostens unter das Kommando des gegen die „nordamerikanischen Aussauger“ kämpfenden „nationalistischen“ Kommunistenführers Carlos Prestes stellen. — Oder sonst irgendwo in Lateinamerika, aus sonst irgendeinem Gründl
Denn „Fidelismus“ ist nur ein neuer1 Name für eine alte Sache. Es ist der natürliche, doktrinlose Ausdruck einer durch geographische, ethnische Gegebenheiten, nationale Entwicklungen und soziale Notwendigkeiten bestimmten Einstellung. Die Geister, die Fidel Castro rief und die sich seines Namens bemächtigten, warten sprungbereit seit hundertfünfzig Jahren. Zwischen den Geistern, die er rief, und den Dämonen, in deren Arme er getrieben wurde, geht Fidel dem Schicksal eines Zauberlehrlings entgegen. Doch weder Geister noch Dämonen noch der Gefangene seines Schicksals, Fidel Castro, können die Urheberschaft für die Ereignisentwicklung der letzten Gegenwart für sich allein in Anspruch nehmen oder ihrer beschuldigt werden. Vor der Geschichte werden die Vereinigten Staaten von Nordamerika voll verantwortlich mitzuzeichnen haben. Die Erklärung, warum Fidel, der kein Kommunist sein kann, da er ausschließlich „Fidelist“ ist und keinen anderen Gott neben sich dulden wollte als sich selbst, fremden Göttern oder Dämonen dienen muß, ist aber wieder ein Kapitel aus der von Irrungen und Wirrungen strotzenden Geschichte der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Nordamerika und den lateinamerikanischen Ländern. Es ist ein Kapitel verkannter und verpaßter Gelegenheiten, falscher oder falsch angewandter Mittel. Ein schicksalhaftes Kapitel, da es sich zu einer der schicksalhaftesten Epochen unserer Zeit abspielt. Ein langes Kapitel, aus dem nur einzelne Punkte hervorgehoben werden können.
Nicht nur die öffentliche Meinung Nordamerikas, sondern auch die unverhohlene Duldung nordamerikanischer Behörden haben Fidel Castro auf seinem Siegeszug über Batista begleitet. Fidel, der Ungebärdige, der Gefährliche, unternahm, kaum daß er sich in seiner Machtfülle zurechtgefunden hatte, seine erste und bisher einzige Auslandsreise: nach New York und Washington! — Nicht in Windjacke, mit offenem Hemdkragen und wirrem Haupt- und Barthaar, sondern in sorgsam geknöpftem Waffenrock, mit weißem Kragen, schwarzer Krawatte, wohl geglättetem und gestutztem Haupt- und Barthaar. Man empfing ihn freundlich und auch freundschaftlich. So sehr, daß sich manche, nicht nur nördlich, sondern auch südlich des Rio Grande, wunderten. Man beging aber einen verhängnisvollen psychologischen Fehler. Man nahm den Mann, der sich tödlich ernst nahm, nicht ernst. Und man beging auch einen nicht minder verhängnisvollen Rechenfehler. Man zuckte die Achseln, als Fidel den Preis nennen ließ, um den er sein politisches, wirtschaftliches, soziales und kulturelles Reformwerk innerhalb der kontinentalen und okzidentalen Gemeinschaft hätte durchführen, wollen.
WAS SIND 30 MILLIONEN?
Es war der Preis, um den es ein Problem Kuba — zumindest, in seiner heutigen Form — nicht gegeben hätte. Um den der Einbruch Moskaus und Pekings auf dem amerikanischen Kontinent aufgehalten worden wäre. Um den es vor allem Fidel Castro erspart worden wäre, hinter dem einzigen wirklichen Marxisten seiner Helfer, Che Guevara, zurückzustehen. Es war der Preis, um den jene naturgegebene Einstellung der lateinamerikanischen Völker, die man nunmehr „Fidelismus“ nennt, nicht die explosive Virulenz angenommen hätte, die den ganzen Kontinent zu sprengen droht.
Der Preis belief sich auf 30 Millionen jährlich.
Die USA-Hilfe für die unterentwickelten Staaten wurde ab 1960 auf sieben Billionen jährlich veranschlagt. Der sogenannte Eisenhower-Plan sieht 500 Millionen Dollar als ersten Schritt einer Notstandsaktion für Lateinamerika vor. Hinzuzurechnen sind sämtliche Verluste, die die nordamerikanische Wirtschaft in Kuba erleiden mußte.
DIE „HEILIGSTEN“ GÜTER
Den USA stand ein ausgezeichnetes Druckmittel zur Verfügung: die Zuckersanktionen. Sie wurden im denkbar ungünstigsten Augenblick, in denkbar ungünstigster Weise angewendet.
Nicht, als Kubas Wirtschaft noch einzig und allein von der Ausfuhr nach Nordamerika abhing.
Nicht, als Fidel Castro noch nicht gewußt hätte, wohin er seinen Zucker hätte schicken können.
Nicht, als das revolutionäre Regime noch nichts anderes als negative Zerstörungsergebnisse aufzuweisen hatte.
Nicht, als die summarischen Aburteilungen und Massenhinrichtungen die ganze Welt empörten.
Nicht, als sich zum erstenmal in der Geschichte des Kontinents die gesamt Presse Lateinamerikas, mit Ausnahme der extremsten Linken, zu Nordamerika und gegen einen lateinischen Bruderstaat stellte.
Nicht, als die Besten der Mitkämpfer Fidels enttäuscht und verbittert in die Emigration gingen, eingekerkert oder abgeurteilt wurden.
Sondern nur erst dann, als es um die Interessen der nordamerikanischen Konzerne gingt
Da lief aber die kommunistische Wirtschaftshilfe schon auf vollen Touren. Da warteten Moskau und Peking nur darauf, den kubanischen Zucker abzunehmen. Da hatte die Revolution das Zerstörungsstadium überwunden und unleugbar Positives geleistet. Da waren die Verfolgungen und Hinrichtungen vergessen. Was aber die Bekämpfung des Fidelismus über die früheren Mitkämpfer Fidels betrifft, wurden ihre Möglichkeiten mit einer Blindheit und Blindwütigkeit sondergleichen vor den Ausschüssen des USA-Senats im Keime abgewürgt: Es wurden nicht nur öffentliche Verhöre vorgenommen und durch marktschreierische Publizität entwertet, sondern auch schwer belastete Mitarbeiter Batistas oder Kollaborateure als Kronzeugen gegen Fidel vernommen I
Es wird kein Krieg um Kuba geführt werden. Kuba ist für den Osten eine Propagandastaffel. Es wird nie ein militärischer Stützpunkt sein. Guantanamo wird nicht aufgegeben. Nicht, weil er seine alte strategische Bedeutung beibehalten hätte, wohl aber, weil den neuen Freunden Kubas nicht Platz gemacht werden darf und weil von Guantanamo aus federn Versuch, einen gegnerischen Stützpunkt .entrichten, schlagartig, vorgebeugt werden könnte. Auch um den Preis eines kriegerischen Konflikts. Das weiß man in Moskau und Peking besser als irgendwo anders und denkt nicht daran, Investitionen ä fonds perdu zu machen.
MIT GLEICHEN WAFFEN?
Über die Einstellung der Kirche zum Fidelismus und ihr Verhältnis zum revolutionären Regime von Kuba ist viel gesagt und geschrieben worden. Viel zuviel I — Es ist nicht nur schwer, sondern falsch, schon jetzt irgendeine Ansicht äußern, geschweige denn ein Urteil fällen zu wollen. Wenn man für die Entwicklung der Dinge in Kuba selbst eine Formel anwenden wollte, könnte man sie dem letzten Hirtenbrief des kubanischen Erzbischofs Perez Serantes entleihen: „Es ist kein Kampf zwischen Washington und Moskau. Es ist ein Kampf zwischen Rom und Moskau!“ Was aber das Verhältnis der Kirche zum Fidelismus im allgemeinen betrifft, sind die Grenzen der Erwägungen viel weiter zu spannen. Wenn Fidelismus für Kuba vielleicht gleichbedeutend mit Kommunismus werden könnte, wäre solche Gleichstellung für ganz Lateinamerika zweifellos fehl am Platze. Nicht die Arbeiterschaft, sondern die Studentenschaft ist hauptsächlich vom fidelistischen Rausch erfaßt. Und die Studentenschaft ist wohl revolutionär, wie es seit eh und je auch in Lätein-amerika ihr Recht war, doch auch noch in ihrer überwiegenden Mehrheit nationalistisch, wie es gleichfalls auch in Lateinamerika seit eh und je ihre Art war.
Die Klärung des Verhältnisses zwischen Kirche und Fidelismus fällt weithin mit der Auseinandersetzung zwischen Religion und Jugend zusammen.
Die These taucht auf: Linksradikalismus könne nur durch Rechtsradikalismus bekämpft werden. Dem revolutionären Vorstoß der Linken müßte ein revolutionärer Gegenstoß der Rechten gegenübergestellt werden können.
Unter den 180 Millionen lateinamerikanischen und 6,5 Millionen kubanischen Katholiken gibt es nicht wenige, die meinen, daß sich aus einer solchen Kräftekonstellation eine unerwünschte, aber nicht unwirksame Rückenstärkung für eben jenen, zwischen Geistern und Dämonen zu stehen gekommenen Fidel Castro ergeben könnte ...
IM GEGENSATZ ZUR NOTBREMSE in einem Eisenbahnzug, die man bekanntlich nur in höchster Gefahr betätigen darf, ist die Benützung des Fallschirmes, der ursprünglich auch nichts anderes war als die Notbremse des Hiegers, nicht nur, erlaubt, sondern' sogar ein eigener Sport, an dem taüsende Menschen ein ausgesprochenes Vergnügen finden. An einem Griff zu ziehen gilt es hier wie dort, wenigstens dann, wenn man einen „manuellen“ Fallschirm auf dem Rücken hat — es gibt auch automatische, die sich ganz von selber öffnen, wenn man aus dem Flugzeug gesprungen ist.
Doch ohne Rücksicht auf feinere Unterschiede ist bekanntlich die Hauptsache, daß der Fallschirm sich überhaupt öffnet. Da bekanntlich auch das Gegenteil schon vorgekommen sein soll und der Mensch überhaupt eine angeborene Abneigung besitzt, von irgendwo herunterzufallen, staunt er Leute, die das Fallschirmspringen als Sport oder gar als Beruf betreiben, wie Wundertiere an. Sie wiederum erklären mit betonter Bescheidenheit, während sie das Angestauntwerden sichtlich genießen, daß der Absprung aus einem Flugzeug erstens völlig ungefährlich ist, weil man für den Fall, daß der Fallschirm sich nicht öffnet, noch einen Reserveschirm mit hat, und zweitens, daß es nichts Schöneres auf, unter und über der Erde gibt, als den freien Fall in die Tiefe und das anschließende Schweben unter der Seidenglocke.
Was mich betrifft: ich bin sehr dafür, alles auszuprobieren, und dieser Versuchung auch schon dann und wann erlegen. Darauf, dieser Reportage zuliebe, auch das herrliche Gefühl des Fallens zu erleben, habe ich verzichtet. Ich bin durchaus davon überzeugt, daß mir auf diese Weise ein großes Erlebnis entgeht. Trotzdem ... Ich kann also nur wiedergeben, was ich aus zweiter Hand weiß, und auf keine eigenen Erfahrungen hinweisen.
VIER KRITISCHE MOMENTE GIBT ES. Der erste ist der Augenblick des Absprungs. Wer Phantasie hat, kann sich selbst vorstellen, wie er an der großen Öffnung steht, die Tür wurde vor dem Start ausgehängt, wie er hinunterschaut: Winzige Häuser, Hügel wie auf einer lieh heftig. Die Striemen, welche die Gurten auf dem Körper zurücklassen, sieht man noch eine ganze Weile.
Der Fallschirm ist also offen, und der Springer sinkt zur Erde hernieder. Anfangs geht das recht langsam, aber je näher er ihr kommt, desto schneller scheint sie ihm entgegenzusteigen. Der Fall ist immerhin so schnell, daß sich die Wiederkehr auf den festen Boden ungefähr so vollzieht wie ein Sprung aus vier, fünf Metern Höhe. Nur kommt man nicht immer schön senkrecht herunter, sondern meistens mit einer gewissen zusätzlichen Horizontalgeschwindigkeit, denn schließlich herrscht meistens nicht gerade Windstille. Wenn man durch Ziehen an den richtigen Leinen den Schirm richtig gesteuert hat, kommt man wirklich auf der Wiese an, die für die Landung vorgesehen war. Und wenn man sich durch die entsprechenden gymnastischen Übungen schön in
OB ER AUFGEHT ODER NICHT, hängt ganz davon ab, ob man ihn richtig eingepackt hat. Jeder Fehler beim Fallschirmpacken kann den Tod bedeuten. Es genügt nämlich nicht, daß die Reißleine oder der Öffnungsmechanismus des manuellen Schirms das Seidenpaket aus der Umhüllung reißt. Eine bestimmte Falte muß so gelegt sein, daß sich der Fahrtwind in ihr fängt. Dann dringt die Luft in das Innere der Seidenglocke ein und bläht sie mit einem mächtigen Stoß auf. Wenn der Schirm nicht richtig gelegt worden ist, strömt die Luft rechts und links an den zusammenklebenden Seidenbahnen vorbei. Dann hat man entweder noch einen Reserveschirm — oder es ist aus.
Aber erstens ist der Reserveschirm klein und der Aufprall auf dem Boden dementsprechend heftig. Zweitens kam eine besonders bekannte französische Fallschirmsportlerin dadurch ums Leben, daß sich die Leinen ihres Notfallschirms gen mit dem manuellen Schirm die Hand immer an der Brust bleiben, am metallenen Handgriff.
Oder sie soll ihn wenigstens rechtzeitig suchen, denn manchmal braucht der Springer im freien Fall seine Hände. Und zwar dann, wenn er sich darin übt, durch entsprechende Bewegungen mit Armen und Beinen seinen Sturz zu steuern. Ein Sport, bei dem sich der Mensch dem Vogel gleich fühlen soll.
Ein französischer Fallschirmspringer brachte vor Jahren eine aufsehenerregende Bildserie zustande. Er ließ sich mit geschlossenem Schirm, waagrecht liegend, das Gesicht nach oben, in den Himmel, in die Tiefe fallen und machte mit dem Teleobjektiv Großaufnahmen von einem Kameraden, der wenige Augenblicke später, Gesicht nach unten, nachgesprungen war. Auf den Aufnahmen erkennt man jede Einzelheit der Mimik und der Steuerbewegungen.
Der Dauer des freien Falles sind heute, außer der beschränkten Höhe der Atmosphäre, keine Grenzen gesetzt. Wenn 200 oder 250 Kilometer je Stunde einmal erreicht sind, verhindert der Luftwiderstand eine weitere Zunahme der Sturzgeschwindigkeit. Einzelne Leute sprangen sogar ohne Sauerstoffgerät aus den untersten Schichten der Stratosphäre zur Erde — wenn man anfangs jede anstrengende Steuerbewegung unterläßt, hält man es in der sauerstofflosen Höhenluft so lange aus, bis man in atembare Luftschichten gefallen ist. Die Kälte ist unter Umständen eine größere Gefahr.
ABER DER WEG von den ersten Trainingsstunden in Aspern bis zum Rekordsprung gleicht ungefähr dem Weg von der Kletterschule im Wienerwald auf den Mount Everest. Und so, wie bei der Kletterei, sind auch beim Fallschirmspringen die Anfänger viel größeren Gefahren
DER SPRINGER MACHT SICH ZUR LANDUNG FERTIG UND FASST DIE BEIDEN TAUE, IN DENEN DIE SCHNÜRE ZUSAMMENLAUFEN, UM SICH IM LETZTEN AUGENBLICK DARAN ETWAS IN DIE HÖHE ZU ZIEHEN UND DAMIT DIE HEFTIGKEIT DES AUFPRALLS ZU MILDERN ausgesetzt als die Meister. Weltrekordleute verunglücken nicht so leicht, außer sie beginnen ihr Können zu überschätzen und übermütig zu werden.
Sie beherrschen ihr Handwerk. Und Unfälle sind sehr selten auf ein echtes Versagen des Materials zurückzuführen und fast immer auf ein Versagen des Menschen, der sich des Materials bedient.
So ungefähr müßte die Antwort lauten, wenn man gefragt wird, ob Fallschirmspringen gefährlich sei.
Was keine Leugnung der bekannten Tatsache darstellt, daß der Mensch außerdem noch Glück haben muß.