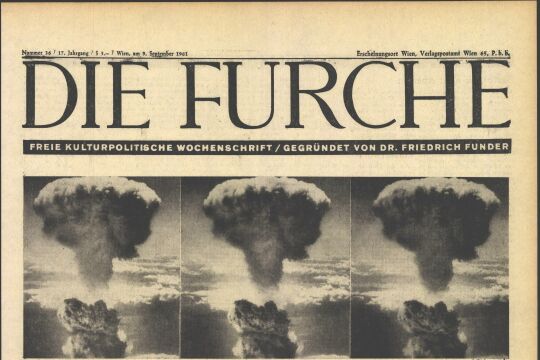Der Vergleich mag ein wenig hinken, doch er steht auf festen Füßen. Wir haben bis vor kurzem von der anderen Seite des Mondes nicht mehr gewußt, als daß sie existiert. Erst jüngst ist es gelungen, über sie einiges, und noch recht Fragmentarisches, zu erfahren, und zwar aus dem Osten, dank des sowjetischen Lunik. Mit dem Kernproblem unserer Gegenwart: Entspannung zwischen den beiden einander gegenüberstehenden Weltmächten, zwischen Ost und West, oder, um es brutal herauszusagen, Vernichtungskrieg oder nicht — wir setzen mit Absicht nicht: Frieden, denn an mehr als einen Waffenstillstand auf möglichst lange Frist vermögen wir kaum zu glauben —, mit dieser uns alle angehenden, vordringlichen Schicksalsfrage steht es nicht anders, als mit der Mondoberfläche. Bis vor kurzem haben wir nur über unsere Seite genug, und mitunter mehr als genug, zu hören und zu lesen bekommen. Doch erst in jüngster Zeit erscheinen vor uns verschwommene, immerhin unbezweifel-bare Bilder aus dem Osten, die geeignet sind, das einzig auf dem Llm-blick über unseren bisherigen Horizont beruhende Bild von der gegenwärtigen Lage und die davon abgeleiteten Ausblicke auf die Zukunft zu korrigieren.
Das, was wir von unserem Standort aus zu sehen erhielten, war düster und trüb. Der tiefer Schauende, der sich weder durch die Propaganda der Eigenen (oder der Befreundeten) noch durch die der Widersacher beeinflussen ließ, der also weder die Verteidigungsfähigkeit des Westens noch die Friedfertigkeit des Ostens als geoffenbarte Wahrheit hinnahm, der nur zu gut die Uneinigkeit, die Zerfahrenheit und den Streit zwischen den einzelnen unheiligen nationalen Egoismen der führenden westlichen Mächte erkannte, dagegen keinerlei Möglichkeit besaß, die Meldungen über ähnliche Aufsplitterung im Osten zu kontrollieren: er mußte sich angesichts der ununterbrochenen Angriffe in Wort und Schrift, die aus dem kommunistischen Block gegen die böse kapitalistische Welt vorgetragen wurden, immer wieder fragen, warum, bei so unüberbrückbaren Gegensätzen, das Unheil noch nicht losgebrochen war. Anlässe, Vorwände fehlen ja nie, wenn Gewaltige dieser Erde sich stärker glauben als ihre auserkorenen Opfer, und der frisch-unfröhliche Krieg, der stets einer der Befreiung ist und der den unterdrückten Nationen und Klassen frommt, kann, als einziges Mittel, den Weltfrieden zu retten, zunächst einmal beginnen. Die Ideologen, die Professoren und die Publizisten werden schon nachher die erdrückenden Beweise für die Gerechtigkeit und für die Unabdingbarkeit dieses Kampfes erbringen. In dieser Hinsicht hat sich seit Friedrich II. von Preußen und den Kriegen um Schlesien nichts geändert.
Wenn wir also bis auf diesen Tag wiederholt „noch einmal davongekommen“ sind, trotz Korea und den Pestflöhen, trotz Suez und der ungarischen Erhebung, trotz Berlin und Laos, dem Kongo und Kuba, so gebietet uns die Logik, die Ursache dafür in Vorgängen und Zuständen auf der anderen, uns unsichtbaren Seite des Mondes zu suchen. Während wir aber früher, vornehmlich zu Stalins Zeiten, nur auf Erraten und Intuition beschränkt waren, um uns ein Bild von drüben zu entwerfen, ist es in den letzten Jahren möglich geworden, einiges von dem, das sich hinter dem Vorhang — weniger einem eisernen als einem aus Wolken gebildeten, vernebelnden — verbirgt, in vagen Umrissen zu erschauen und anderes aus Reflexen, aus dem Widerschein, zu erahnen.
Gestehen wir vorher ein, daß von den wichtigsten Geschehnissen, im Ostblock, und besonders in der UdSSR, nichts zu uns gedrungen ist, ehe es nicht eine vollendete Tatsache war; daß wir auch darnach lange über Vorbereitung, Verlauf und Wirkung der Ereignisse im dunkeln tappten und daß wir noch heute nur ein wenig fahles Licht empfangen, um in das Allerunheiligste einer geheimnisvollen Welt zu sehen. Ein paar angelsächsische Diplomaten, ein halbes Dutzend Publizisten und Schriftsteller — zu denen wir nicht gewisse, sehr überschätzte Kolumnisten und Reporter oder Professoren zählen, die den Bericht über die kommunistische Welt sozusagen in Monopolpacht genommen haben —, vor allem die ganz wenigen, der großen Öffentlichkeit ungenügend bekannten, doch von Berufenen aufs höchste geachteten Spezialisten: das sind die Männer, die bereits aus dem Material, das durch den Nebelvorhang durchgesickert ist, die Geschehnisse im Ostblock mit dem Feingefühl des Künstlers und mit dem kritischen Verstand des Forschers zu deuten wußten. Sie haben wieder die holden Wunschträume der grimmigen Kommunistenfresser, etwa vom tödlichen Gegensatz zwischen der Sowjetunion und China, von Not und Zersetzung in allen Volksdemokratien, von epischen Kämpfen im Moskauer Führungsgremium, noch die der süßen Welt-umarmer von der Friedfertigkeit der sowjetischen Staatslenker, von der Verbürgerlichung und von der zunehmenden Sanftheit des Bolschewismus und von der schließlichen Begegnung zwischen Ost und West auf einer mittleren Linie geteilt. Diese nüchternen, zumeist durch Mitleiden wissend gewordenen Beobachter haben bis vor nicht allzu langer Zeit nur wenige, oder eigentlich gar keine, Lichtpunkte am Horizont der westöstlichen Beziehungen entdeckt.
Sie, und mit ihnen eine Elite von mindestens auf einen Sektor des großen Welttheaters Einblick Besitzenden, glauben indessen, an eben diesem Horizont ein paar winzige, zögernde Silberstreifen feststellen zu dürfen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir, wiederum seit erst kurzer Frist, Einschau in die „andere Seite des Mondes“ gewonnen haben, dann, weil sich — obzwar sorgsam vor Profanem versteckt, doch einem engen Kreis Eingeweihter vertraut — in unserem westlichen Bereich einiges abgespielt hat und: noch abspielt, das mancherlei Hoffnungen weckt. Allem voran möchten wir die Herstellung eines direkten und guten Kontaktes zwischen Kennedy und Chruschtschow stellen. Kontakt heißt noch nicht Verständigung, nicht einmal deren positiver Beginn. Er ist aber von außerordentlichem Wert, wenn er, wie in diesem Fall, zu einem der Öffentlichkeit und sogar den sogenannten wohlinformierten Kreisen unzugänglichen Meinungsaustausch führt. Der Wechsel auf der amerikanischen Botschaft, wo Foy Kohler einem nicht minder hervorragenden Vorgänger gefolgt ist, der jedoch nicht in demselben Maße wie er als ein mit sämtlichen Gründen, Abgründen und Hintergründen des Weißen Hauses, des Staatsdepartments und des Kapitols vertrautes Alter ego des Präsidenten gelten durfte; die Mission des amerikanischen Innenministers Udall und vornehmlich die des Pressesekretärs des Weißen Hauses, Pierre Salinger, in dem viele einen Teil der „substance grise“ Kennedys vermuten, haben gleich dem Besuch des Schwiegersohnes Chruschtschows, Adschubei, mindestens dazu geführt, daß dem Staatsoberhaupt der USA ein genaueres Bild über die Ansichten und die Absichten des sowjetischen Staatslenkers, über dessen Machtposition innerhalb der Kreml-Oligarchie, über dessen Freunde und Feinde gegeben wurde als je zuvor. Nicht etwa, daß wir Chruschtschow verdächtigen, seine eigenen Pläne offen auszuschütten. Doch aus einer Kombination des Gesagten, des Verschwiegenen, des Angedeuteten, des Gesehenen und des Erspürten hat man an der maßgebenden Stelle in Washington die Überzeugung geschöpft, daß erstens Chruschtschow und seine Gruppe derzeit wirklich den Frieden wollen, daß sie zweitens in ständiger Bedrohung durch Scharfmacher — man nenne sie Stalinisten oder wie sonst immer — die wilden Männer soielen müssen und in nichts Wesentlichem zurückweichen können, daß sie drittens das geringste der Übel seien, die von Osten her den Westen bedrohen, endlich viertens, daß sie in der UdSSR, allen Anstürmen zum Trotz, die Macht solide in den Händen haben. Daraus wurde die doppelte Schlußfolgerung gezogen: man soll, man muß mit dem jetzigen Gebieter des Kreml reden, und angesichts der hüben und drüben sich auftürmenden Hindernisse kann man das nur tun, wenn die Kontakte hinter verschlossenen Türen erfolgen, wenn nach außen hin die USA ihre Entschlossenheit bekunden, keinen Schritt zurückzuweichen, und wenn man sich nicht daran stößt, daß die Sowjetunion ihrerseits fest auf ihren Positionen beharrt. Hinter den besagten verschlossenen Türen dagegen mag man zu manchem Einvernehmen gelangen, und man war, dürfen wir sehr ernstzunehmenden Stimmen glauben, bereits zu einigen Ergebnissen gelangt, die aufs energischeste vor der Öffentlichkeit bestritten werden.
In diese Atmosphäre der Aufheiterung platzte unerwartet ein Ungewit-ter hinein. Kuba war und ist zweifellos das kitzligste Problem, das die sowjetisch-amerikanischen Beziehungen stark belastet. Von Moskau her hat es einen zweifachen Aspekt: einen weniger gefährlichen, nämlich als Tauschobjekt bei einem großen diplomatischen Kuhhandel, und einen ungemein bedenklichen, als Hauptstützpunkt für militärische Unternehmen gegen die USA wie als Herd kommunistischer Infiltration in Lateinamerika. Je nachdem, ob die eine oder die andere Rolle Kubas überwog, konnte das Land Fidel Castros einen längeren oder kürzeren Waffenstillstand im kalten Krieg zwischen USA und UdSSR verhindern, ja ihn brechen oder ihn eher fördern. Obzwar die Entspannung zwischen Washington und Moskau, unbeschadet des Kriegsgeschreis und der Hemmnisse, der sie in beiden Reichen begegnet, eine Tatsache war, die in allen Staatskanzleien registriert und die hier mit Unmut, ja mit Zorn, dort mit einem behutsamen Aufatmen der Erleichterung begrüßt wurde; obgleich es im letzten auf die zwei Übergroßmächte ankommt, verdienen andere Anzeichen eines Näherrückens der beiden gegnerischen Lager ebenfalls starke Beachtung. Das um so mehr, als eben diese Kontakte in manchen Fällen erheblicher fortgeschritten waren als die der Protagonisten. Dabei geziemt es sich, diese Tastversuche als Folgen der amerikanisch-sowjetischen Gespräche zu erkennen. Vordringlich die stärksten Alliierten der USA wollten nicht durch eine über ihre Köpfe hinweg erzielte Regelung der allgemeinen und ihrer eigensten Lebensfragen überrumpelt werden.
Es fehlt uns an Raum, alle die Extratouren, von denen wir irgendwie Kenntnis erhalten haben, aufzuzählen. So sei nur im Flug auf die Bemühun-“ gen der italienischen Diplomatie, die über Paris und Bonn verärgert ist, hingewiesen, direkt mit dem Osten anzuknüpfen, und zwar im Einverständnis mit Großbritannien und zumal mit den USA. Aber auch sogar von einer Seite, von der man es nicht vermuten würde, ist allerlei geschehen. Wenn nicht die Bonner Regierung, so doch das mit hartnäckigem, löblichem Eifer um wahren (und einträglichen) Frieden im europäischen Osten bemühte Haus Krupp hat den Hebel in Warschau und später in Budapest angesetzt. Die „vorgeschobenen Beobachter“ waren dabei der Generalbevollmächtigte, Beitz, und dessen sehr diplomatisch gewandter, ortskundiger Kollege, Professor Hundhausen. Es drehte sich dabei um eine Aufnahme von Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den eben genannten Oststaaten, eventuell auch mit der Tschechoslowakei, Rumänien und Bulgarien. Zwar sollten keine regelrechten Botschaften oder Gesandtschaften errichtet werden, doch Handelsmissionen mit diplomatischem Statut, die faktisch auch politische Angelegenheiten erledigen würden. Um Bedenken zu überwinden, die beim Auftauchen dieser
Gedanken sofort erhoben wurden, war Bonn bereit, den Leitern derartiger Missionen einen hohen Rang zu verleihen beziehungsweise Persönlichkeiten von Format zu schicken. Sachlich sind diese Dinge aber nicht weit gediehen. Man stieß sich zum Beispiel vorläufig an der unabdingbaren polnischen Forderung nach formeller Anerkennung der Öder-Neiße-Grenze und auf einen ausdrücklichen Verzicht, Propaganda gegen diese Grenze zu betreiben. Dennoch sind die Pour-parlers zwischen Westdeutschen und zwischeneuropäischen Volksdemokraten als Symptom zu verzeichnen, daß man selbst am neuralgischsten Punkt unseres Kontinents Heilungsversuche anstellt.
Einen weiteren Test empfingen wir durch die Entwicklung der wiederhergestellten und nun nachdrücklich betonten sowjetisch-jugoslawischen Freundschaft. Das Verhältnis Titos zu den Angelsachsen und zu Italien hat sich dadurch vorläufig nicht verschlimmert, daß Belgrad völlig deutlich auf die weltpolitische Linie der UdSSR eingeschwenkt ist.
Beinahe gute Beziehungen zu Rom, London, selbst zu Washington, das ist soweit in Ordnung, doch mit Paris und besonders mit Bonn steht man in Belgrad recht übel.
. Doch das war und ist nur von sekundärer Bedeutung neben dem Verhältnis zwischen den beiden Hauptantipoden. Dieses aber hat sich bei der Kubakrise im Oktober 1962 aufs gefährlichste zugespitzt. Mitten in die Euphorie, der sich nicht nur die mangelhaft unterrichteten „breiten Kreise“ hingaben, sondern der auch die obersten Stellen in Washington und in Moskau huldigten, fiel ein Funke, der den befürchteten, doch — wie es schien — in späte Ferne gerückten Weltbrand entzünden konnte. Kennedy war ein besserer Psychologe als Chruschtschow. Die Geschichte und das Ergebnis der Kubakrise sind in aller Erinnerung. Nachdem der Abszeß provisorisch geleert worden war, setzten die Entspannungsbestrebungen sofort wieder ein, und sie sind heute weiter gediehen als sie es je zuvor gewesen waren.
Das aber war und ist nur deshalb möglich, weil man in Washington ietzt... die andere Seite des Mondes besser kennt und weil man in Moskau die uns zugewandte Mondseite „kennengelernt“ hat.