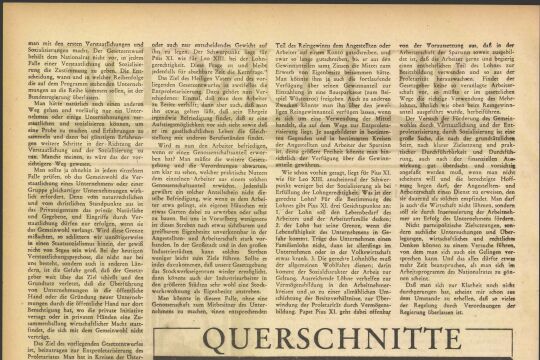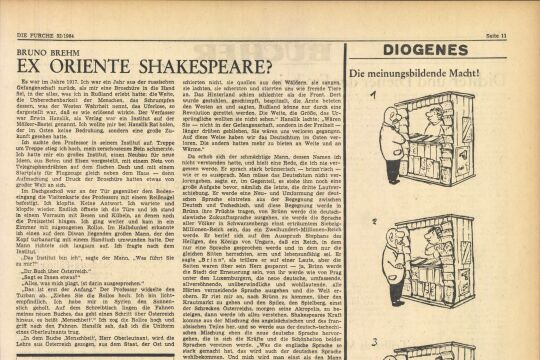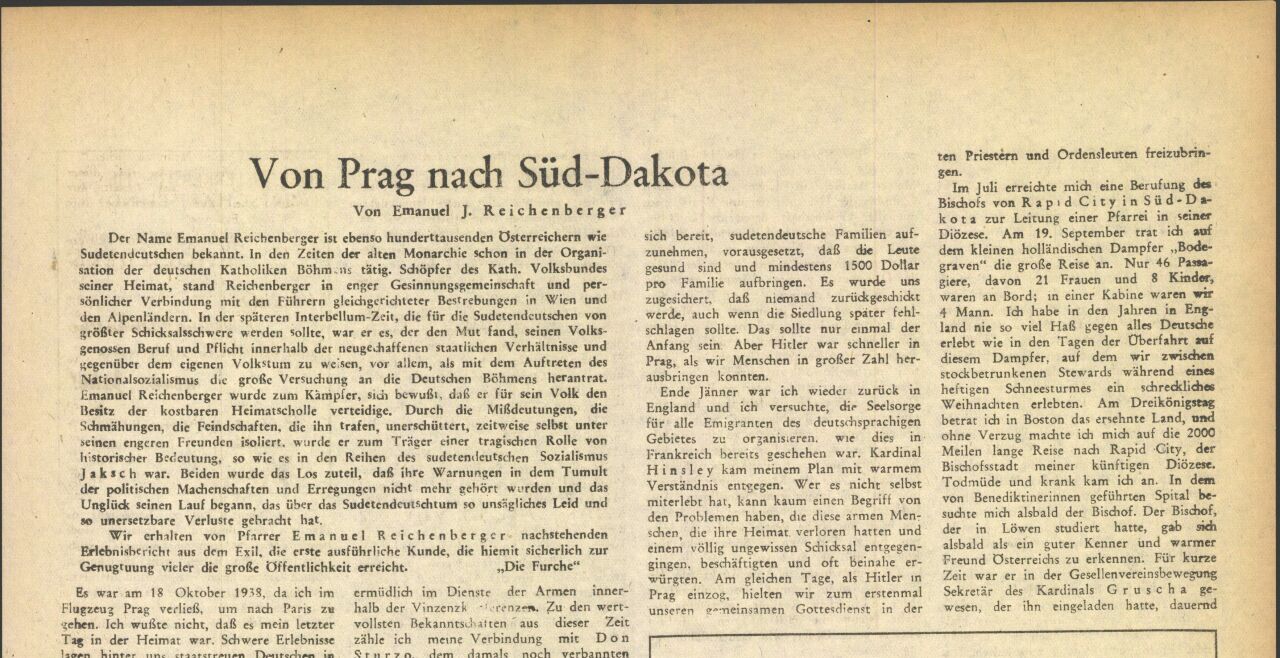
Von Prag nach Süd-Dakota
Der Name Emanuel Reichenberger ist ebenso hunderttausenden Österreichern wie Sudetemicutsdien bekannt. In den Zeiten der alten Monarchie schon in der Organisation der deutschen Katholiken Böhm ns tätig. Schöpfer des Kath. Volksbundes seiner Heimat, stand Reichenberger in enger Gesinnungsgemeinschaft und persönlicher Verbindung mit den Führern gleichgerichteter Bestrebungen in Wien und den Aipenländern. In der späteren Interbellum-Zcit, die für die Sudetendeutschen von größter Schicksalsschwere werden sollte, war er es, der den Mut fand, seinen Volksgenossen Beruf und Pflicht innerhalb der neugediaffenen staatlichen Verhältnisse und gegenüber dem eigenen Volkstum zu weisen, vor allem, als mit dem Auftreten des Nationalsozialismus die große Versuchung an die Deutschen Böhmens herantrat. Emanuel Reichenberger wurde zum Kämpfer, sich bewußt, daß er für sein Volk den Besitz der kostbaren Heimatscholle verteidige. Durch die Mißdeutungen, die Schmähungen, die Feindschaften, die ihn trafen, unerschüttert, zeitweise selbst unter einen engeren Freunden isoliert, wurde er zum Träger einer tragischen Rolle von historischer Bedeutung, so wie es in den Reihen des sudetemleutschen Sozialismus J a k s c h war. Beiden wurde das Los zuteil, daß ihre Warnungen in dem Tumult der politischen Machenschaften und Erregungen nicht mehr gehört werden und das Unglück seinen Lauf begann, das über das Sudetendeutschtum so unsägliches Leid und so unersetzbare Verluste gebracht hat. Wir erhalten von Pfarrer Emanuel Reichenberger nachstehenden Erlebnisbericht aus dem Exil, die erste ausführliche Kunde, die hiemit sicherlich zur Genugtuung vitler die große Öffentlichkeit erreicht. „Die Furche“
Der Name Emanuel Reichenberger ist ebenso hunderttausenden Österreichern wie Sudetemicutsdien bekannt. In den Zeiten der alten Monarchie schon in der Organisation der deutschen Katholiken Böhm ns tätig. Schöpfer des Kath. Volksbundes seiner Heimat, stand Reichenberger in enger Gesinnungsgemeinschaft und persönlicher Verbindung mit den Führern gleichgerichteter Bestrebungen in Wien und den Aipenländern. In der späteren Interbellum-Zcit, die für die Sudetendeutschen von größter Schicksalsschwere werden sollte, war er es, der den Mut fand, seinen Volksgenossen Beruf und Pflicht innerhalb der neugediaffenen staatlichen Verhältnisse und gegenüber dem eigenen Volkstum zu weisen, vor allem, als mit dem Auftreten des Nationalsozialismus die große Versuchung an die Deutschen Böhmens herantrat. Emanuel Reichenberger wurde zum Kämpfer, sich bewußt, daß er für sein Volk den Besitz der kostbaren Heimatscholle verteidige. Durch die Mißdeutungen, die Schmähungen, die Feindschaften, die ihn trafen, unerschüttert, zeitweise selbst unter einen engeren Freunden isoliert, wurde er zum Träger einer tragischen Rolle von historischer Bedeutung, so wie es in den Reihen des sudetemleutschen Sozialismus J a k s c h war. Beiden wurde das Los zuteil, daß ihre Warnungen in dem Tumult der politischen Machenschaften und Erregungen nicht mehr gehört werden und das Unglück seinen Lauf begann, das über das Sudetendeutschtum so unsägliches Leid und so unersetzbare Verluste gebracht hat. Wir erhalten von Pfarrer Emanuel Reichenberger nachstehenden Erlebnisbericht aus dem Exil, die erste ausführliche Kunde, die hiemit sicherlich zur Genugtuung vitler die große Öffentlichkeit erreicht. „Die Furche“
Es war am 18 Oktober 1938, da ich im Flugzeug Prag verließ, um nach Paris zu gehen. Ich wußte nicht, daß es mein letzter Tag in der Heimat war. Schwere Erlebnisse lagen hinter uns staatstreuen Deutsdien in der Tschechoslowakei.
Am 29. September 1938 war in München das feierliche „Abkommen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien, Frankreich und Italien“ abgeschlossen worden, das die deutschen Randgebiete der Tschechoslowakei an Hitler preisgab. Die von Konrad Henlein geleitete Anschlußbewegung war stirk gewesen; stärker noch war der chauvini-stisdie Terror, den sie gegen die ihr Widerstrebenden kehrte. Aber doch war in vielen meiner I.andsleute sowie in mir die Überzeugung nicht zu erschüttern, daß das Schicksal der Deutschen Böhmens, Schlesiens und Mährens nicht losgetrennt werden könne von den klaren geopolitischen Gegebenheiten und den uralten historischen Bindungen, die der tschechische Staat ererbt hatte. Am 1 Oktober hatten die Marschkolonnen Hitlers zwischen Helfenberg und Fiechtenau die Staatsgrenzen Böhmens überschritten, Mit diesem Prolog, der noch von vielen enthusiastisch begrüßt wurde, nahm die Tragödie ihren Anfang. In den letzten Wochen waren Tausende von Deutschen aus den von heftigen politischen Spannungen überlagerten Grenzgebieten nach Prig und ins tschechische Gebiet geströmt. Es mußte diesen Flüchtlingen geholfen werden. Nicht wenige von ihnen galten in den Augen der augenblicklichen Triumphatoren als kompromittiert. Ich hatte die Absicht, für sie Mittel zu sammeln und ging deshalb ins Ausland, um die Möglichkeiten für Siedlungen im Ausland zu erkunden Ich fand in Paris wenig Verständnis Eine seltene Ausnanme war der große Kardinal V e r d i e r. Als er im Einführungsschreiben Kardinal Kaspers las, es sei der Zweck meiner Mission, für ein neues Vaterland jener deutschen Katholiken vorzusorgen, die „durch das neue Diktat Frankreich Italiens und Deutschlands gegen die Tschechoslowakei ihrer Heimat beraubt worden sind“, erklärte er: „Ja, es ist unsere Schul d.“
Erst in Paris erfuhr ich. daß von nationalsozialistischer Seite nun nach der Machtergreifung in Deutschböhmen meine Auslieferung verlangt werde Ich war also Flüchtling, verbannt aus der Heimat, allein in einer fremden Welt Mein ganzes Vermögen war ein Handkoffer mit etwas Wäsche, wenigen Francs und englischen Pfunds. Ich habe in diesen jähren oft erlebt, wie viele der „Refugees“ zusammenbrachen, weil sie sich von der Vorstellung nicht losmachen konnten: Ich war einmal in der und der Stellung ., ich hatte das und das Vermögen, ich führte den und den Titel . . . Diese Art der Denkungsweise lag mir nicht, und das hat mir geholten. Ich war mir klar über meine Lage: ich oin ein Bettler, auf fremde Hilfe angewiesen. Aber ich hatte eine große Mission: ich mußte für meine unglücklichen Landsleute sorgen. So ging ich auf meiner Suche nach Hilfe weiter nach London. Die ersten, die sich in der britischen Hauptstadt um mich, der ich noch kein Wort Englisch konnte, annahmen, waren Quäker und Leute aus der Labour Party und der erste, der mir sein Heim anbot, war ein Canon der West-minster Abbey. Ehe ich zu ihm übersiedelte, erhielt ich nodi eine Einladung zu einer irischen Familie; der Mann ein Konvertit Ingenieur einer chemischen Fabrik, war das Ideal eines katholischen Laienapostels, unermüdlich im Dienste der Armen innerhalb der Vinzenzk •'Vrenzm. Zu den wertvollsten ßekanntsi.n arten aus dieser Zeit zähle ich meine Verbindung mit Don S t u r z o, dem damals noch verbannten Führer der italienisdien Popolari, dem geistvollen Soziologen, der unermüdlich für seine Heimat wirkte. Don Sturzo war ein kranker Mann; er litt unter dem Londoner Nebel. „Der Mond hatte in Neapel mehr Kraft als die Sonne in London“, sagte er. Er wohnte im Heim der Tante von Miß Barbara Barceley Carter, der Übersetzerin seiner vielen im Exil entstandenen Bücher, die die geistige Führerin der von Don Sturzo angeregten demokratischen Gruppe „People and Freedom“ ist. Christliche Demokraten aus allen Ländern fanden sich in dem Kreis von Miß Carter. Hier in London traf ich auch meinen Freund J a k s c h, den Führer der sudetendeutschen Sozialisten. Er bereitete eine Fahrt nach Kanada vor, um dort Siedlungsmöglichkeiten festzustellen, und lud mich ein, an dieser überparteilichen Aktion mich zu beteiligen, für die wir auch das Interesse katholischer Kreise Kanadas erwarteten.
Am 3. Dezember 1938 fuhr ich mit viel Idealismus und wenig Geld — die Überfahrt bezahlte ein englisches Komitee — gemeinsam mit dem Reichenberger Gewerkschaftssekretär Franz Rehwald auf der „Duchess of Richmond“ von Southampton ah und traf nach stürmischer Seefahrt am 10. Dezember in Halifax ein Trotzdem wir von den Vertretern der kanadischen Eisenbahngesellschaften, mit denen das Siedlungswesen zusammenhängt, zuvorkommend aufgenommen wurden, zeigten sich bald die Schwierigkeiten für den Siedlungsplan. Wir verhandelten mit kanadischen Ministern und vielen Persönlichkeiten. Aber die Zulassung ins Land entscheiden nicht irgendwelche humanitäre Gesichtspunkte. Die Frage ist: Können wir den Mann brauchen und welche Mittel stehen zur Verfügung, um die ersten Jahre des Aufenthaltes zu finanzieren. Ohne Geld keine Einwanderungsmöglichkeit. Geschlossene Siedlungen werden nicht zugelassen oder doch sehr ungern gesehen. „Wir wollen nicht Deutsche, Tschechen usw., sondern Kanadier.“ Für nicht landwirtschaftliche Arbeiter ist die Aussicht geradezu hoffnungslos. Wir fuhren wochenlang im Land herum, sprachen ungezählte Farmer. Wir trafen Deutsche, Österreicher, Slowaken, Schweizer, Schweden in dem „Schmelztiegel“ Kanada. Die Auskunft war fast überall dieselbe: es ist ein Glücksspiel; zwei von zehn gewinnen; zwei verlieren aber auch alles, selbst das Leben. Die Mehrzahl hat ein hartes, oftmals sogar armes Leben. Immer wiederholt man das Wort: „Der ersten Generation der Tod, der zweiten die Not, der dritten das Leben.“
Es war eine allgemein bestätigte Erfahrung, daß sich Gemeinschaftssiedlungen nicht bewähren. Der Egoismus ist stärker als der Wille zur Gemeinschaft, wo nicht eine starke Autorität ausgleichend wirken kann Eine Erfahrung, die übrigens auch die sudetentteutschen Siedler, die durch unsere Aktion nach Kanada kamen, bald bestätigen mußten. Eine Ausnahme von dieser Regel bildeten nur die „D oukhobor s“, eine Art Wiedertäufer, die in ihren kleinen Siedlungen christlichen Kommunismus praktizieren Die Leute stammen aus der Nikolsburger Gegend. Ihre Farmen sind sauber und mustergültig verwaltst.
Am 13. Jänner 1939 kamen unsere Verhandlungen mit der Regierung zum Abschluß. Die kanadische Regierung erklärte sich bereit, Sudeten deutsche Familien aufzunehmen, vorausgesetzt, daß che Leute gesund sind und mindestens 1500 Dollar pro Familie aufbringen. Es wurde uns zugesichert, daß niemand zurückgeschickt werde, auch wenn die Siedlung später fehlschlagen sollte. Das sollte nur einmal der Anfang sein Aber Hitler war schneller in Prag, als wir Menschen in großer Zahl herausbringen konnten.
Ende Jänner war ich wieder zurück in England und ich versuchte, die Seelsorge für alle Emigranten des deutschsprachigen Gebietes zu organisieren, wie dies in Frankreich bereits geschehen war. Kardinal H i n s 1 e y kam meinem Plan mit warmem Verständnis entgegen. Wer es nicht selbst miterlebt hat, kann kaum einen Begriff von den Problemen haben, die diese armen Men-sdien, die ihre Heimat verloren hatten und einem völlig ungewissen Schicksal entgegengingen, beschäftigten und oft beinahe erwürgten. Am gleichen Tage, als Hitler in Prag einzog, hielten wir zum erstenmal unseren “-neinsamen Gottesdienst in der
St.-Patrick-Kirche. Ende April wurde mir die Seelsorge in einem Heim für FKicht-lingskinder in Crawly Down Success übertragen, wo ich mit Wohnung, Verpflegung und einem bescheidenen Taschengeld versorgt war. Als ich im November i 1 zu tun hatte, fand ich die Stadt g'nz verändert. Sperrballons hingen rings um die Ränder der verbauten Gebiete, helleuchtend von Aluminium; jedermann auf der Straße trug eine Gasmaske. Von einer Kriegsbegeisterung merkte man nichts, aber auch damals noch nichts von Haß. Bis zum Mai 1940, der Besetzung Hollands und Belgiens, bestanden für deutsche und österreichische Flüchtlinge so gut wie keine Beschränkungen. Erst mit Pfingstsonntag begannen die schlagartigen Internierungen. Ich selbst wurde durch meinen tsdiechischen Paß vor diesem Schicksal bewahrt. Eine wahre Hysterie hatte die Massen erfaßt. Doch es gab rühmenswerte Ausnahmen, die mit einem für die Kriegszeit unerhörten Freimut die Härten geißelten, mit denen Deutschsprechende ohne Unterschied der Gesinnung behandelt wurden. Der Wortführer dieses Freimuts war der anglikanische Bischof von Chichester, einer der wenigen ganz großen Menschen, denen idi im Exil begegnete. Durch seine Intervention gelang es mir, eine Reihe von Freunden, auch eine Reihe von katholischen internierTen Priestern und Ordensleuten freizubringen.
Im Juli erreichte mich eine Berufung des Bischofs von Rapid City in Süd-Dakota zur Leitung einer Pfarrei in seiner Diözese. Am 19. September trat ich auf dem kleinen holländischen Dampfer „Bode-graven“ die große Reise an. Nur 46 Passagiere, davon 21 Frauen und 8 Kind, waren an Bord; in einer Kabine waren wir 4 Mann. Ich habe in den Jahren in England nie so viel Haß gegen alles Deutsche erlebt wie in den Tagen der Überfahrt auf diesem Dampfer, auf dem wir zwischen stockbetrunkenen Stewards während eines heftigen Schneesturmes ein schreckliches Weihnadnen erlebten. Am Dreikönigstag betrat ich in Boston das ersehnte Land, und ohne Verzug machte idi mich auf die 2000 Meilen lange Reise nach Rapid City, der Bischofsstadt meiner künftigen Diözese. Todmüde und krank kam ich an. In dem von Benediktinerinnen geführten Spital besuchte mich alsbald der Bischof. Der Bischof, der in Löwen studiert hatte, gab sieh alsbald als ein guter Kenner und warmer Freund Österreichs zu erkennen. Für kurze Zeit war er in der Gesellenvereinsbewegung Sekretär des Kardinals G r u s c h a gewesen, der ihn eingeladen hatte, dauernd
nach Wien zu kommen. Ein Priester aus der Nachbarschaft führte mich im Auto durch die Black Hills, europäischem Mittelgebirge gleichende Höhenzüge, nach Lead, dem Platz eines der größten Goldbergwerke der Welt, wie überhaupt ganz Süd-Dakota eine einzige Goldgrube ist, gleich interessant für Geologen und Paläontologen, die in diesem Lande gleichsam die Werkstätte des Sdiöpfers betreten. Seltsame Bergformationen schießen fast unvermittelt aus dem Boden, überreich an Versteinerungen vorsintflutlicher Tiere. Der Unionstaat Süd-Dakota erstreckt sich über 76.868 Quadratmeilen, auf denen nur 642.961 Menschen leben. Kirchlich hat der Staat zwei Diözesen: Rapid City und Sioux Falls. Die erste 41.794 Quadratmeilen groß mit 40.000 Katholiken. Der erste Bischof der 1902 errichteten Diözese war Johannes Stariha, ein Österreicher, der 1915 in Laibach starb. Sein Nachfolger war Bischof Josef Buesch, der ebenfalls österreichisdier Herkunft war. Diese Pionierpriester haben Härten ertragen, die in Europa bis zum Kriege kaum verständlich waren. Bis heute gilt die Diözese als Missionsgebiet.
Nach dem günstigen Eindruck der sdiö-nen, sauberen Bischofsstadt war die Ankunft in meiner zukünftigen Pfafrgemeinde Glencross nicht gerade eine freudige Über-. raschung. Die Pfarrei zählt derzeit 35 Familien, davon leben nur acht im Ort, die anderen auf Farmen verstreut, oft voneinander 12 bis 15 Meilen entfernt. Alle meine Leute sind Farmer mit einem Besitz bis zu 2000 Acres, auf denen zumeist Weizen und Mais, hier „Korn“ genannt, gebaut wird. Der Boden ist hier noch so ursprünglich, daß Dünger oder gar Kunstdünger nicht verwendet werden. Der Anbau ist maschinell in wenigen Tagen vollzogen, auch die Ernte, die mit Maschinen eingeholt wird, die das Getreide schneiden, dresdien und das Stroh binden. Man hält keine Ställe, Pferde und Vieh bleiben stets im Freien, Kühe werden nur zum Melken heimgeholt. Der Abstammung nach sind alle meine Pfarrkinder Deutsch- Rußländer. Aus ihnen rekrutieren sich die Hauptkolonisatoren von Nord- und Süd-Dakota. Die ältere Generation spricht unter sich noch ein Deutsch, das elsässischen Grundton bewahrt hat. Es besteht jedoch wenig Aussicht, daß die deutsche Sprache die nädiste Generation überleben wird, eine Folge der vom Weltkr ieg erzeugten Stimmungen und ein „Erfolg“ Hitlers. Es ist ein fleißiger, zäher, schwer arbeitender, konservativ denkender Menschenschlag von schöner religiöser Haltung. So kleinen Gemeinden fällt es mcht leicht, Pfarrer und Priester zu erhalten. Das geht in guten Jahren; sdilimm aber, wenn der Regen ausbleibt, Stürme die Saat wegblasen, Riesenheuschreckenschwärme alles kahl fressen.! Die Pfarrer in dieser Diözese sollen nach einer nicht verbrieften, aber als gültig gehaltenen Regel jährlidi 1000 Dollars erhalten. Aber nur ein Bruchteil der Gemeinden kann soviel aufbringen. Es gibt keinen Rechtsanspruch dafür. Wenn ein Priester nicht mit seinen Leuten auskommt, kann es ihm geschehen, daß er in der Kirche allein steht, daß er nichts hat, wovon er leben könnte. Aber das sind verschwindende Ausnahmen.
Die Vorstellung des Durchschnittseuropäers kennt von Amerika nur die hochindustriellen Großstädte. Von dem anderen Amerika des mittleren Westens weiß man awf dem alten Kontinent wenig.
Als ich 1941 hieher kam, trab es noch kein elektrisdies Licht. Jetzt haben wir ein kleines Elektrizitätswerk mit einem sogenannten „Windcharger“ im Betrieb für Kirche und Pfarrhaus. Das Wasser wurde in den wenigen Regentagen aus Dachrinnen m einer Zisterne gesammelt, jetzt wird es aus einer Nachbargemeinde zugeführt. Es gibt kein Fließwasser und kein Bad. Klosett? Es steht in der Prärie wie in Urgroßvaters Zeiten. Doch haben wir Schule, Bahn und Post im Ort und zwei Kaufläden, wie man sie kaum in mittleren Städten Europas finden wird, die praktisch alles führen von Brot und Fleisch bis zu den Schuhen, Werkzeugen und einfachen Arzneien. — In einer Gemeinde mit acht gesunden Familien im Ort ist beim besten Willen nicht allzuviel seelsorgliche Arbeit. Es fehlt aber nicht an anderer Tätigkeit. So mußte ich wohl oder übel kochen lernen. Zum Glück gibt es die verschiedenen „Tins“, Konserven aller Arten. Viele meiner benachbarten Freunde, die hier groß geworden sind, verstehen sich auf allerlei, spielen Zimmermaler, Zementmischer und Dachdecker Leider fiel einer meiner Freunde beim Anstreichen der Kirche vom Turm herunter.
Ich war erst wenige Monate in Glencross, als mein Nachbar in der Gemeinde Trail-City, ein Benediktiner deutscher Herkunft, an der Schlafkrankheit starb und ich auch diese Gemeinde für kurze Zeit versehen sollte. Es sind daraus indessen fünf Jahre geworden. Da die vorhandene Kirche längst nidit mehr ausreichte, kauften wir eine alte Kirche in der Hauptstadt von Süd-Dakota, rissen sie nieder und führten das Material -nadi Trail-City. Die Farmer hoben das Fundament aus, stellten die Gerüste auf, mauerten und zimmerten dann den Dachstuhl. Die Kirche faßt 400 Personen. Ich weiß nicht, wie die 15.000 Dollars, die wir für das Material brauchten — die Arbeit wurde unentgeltlich geleistet —, zusammenkamen. Aber sie waren da. Natürlich ist es kein Steinbau, sondern der prärieübliche Holzbau. Die, Wände sind aus Preßhohfaserplatten mit Asphaltisolation hergestellt. Das nette, schlichte Gotteshaus wurde am 8. Dezember 1942 geweiht.
Bald fand sich für mich, dem alten Publizisten, reichlich Federarbeit. Als mein Dekan, ein Rheinländer, herausfand, daß ich drüben oft die Feder geführt hatte, hetzte er mir den „Nord Dakota Herold“ auf den Hais, tür den ich rechlich zu tun bekam. Meine Artikel, in denen ich mit allen Gründen der Gerechtigkeit und Logik, auch mit aller Leidenschaft, deren ich fähig bin, für einen gerechten und dauernden Frieden sowie gegen den Nazismus in allen seinen Formen, auch wenn er sich unter der Maske der Demokratie verbirgt, kämpfe, erscheinen jetzt in sieben deutschen Blättern Amerikas und . in einer zu Münster in Kanada herausgegebenen Wodienzei-tung. Es ist eine in England und Amerika weitverbreitete bekannte Gewohnheit, „Letters to the Editor“ zu schreiben, um eine Idee zu unterstreichen oder zu bekämpfen. Dadurch ergibt sich ein lebhafter Ideenaustausch unter der Bevölkerung. So bin auch ich ein Opfer dieser Briefe an den Redakteur geworden. Meine Post reicht heute von New York bis San Franzisko, von Kanada bis Texas, von den Kriegsgefangenenlagern bis zu den internierten feindlichen Ausländern, von vielen ehemaligen Landsleuten, die mich durch die Presse wieder entdeckten, bis zu Freunden in Südamerika und England und der Schweiz.
Wenn man heute in Amerika kräftig den Haß abzubauen beginnt, die Probleme in ihrer nüchternen Realität zu fassen versteht, wenn die Hilfsaktionen auch auf Hitlers erste Opfer, wie Deutsdiland und Österreich, ausgedehnt wurden, wenn die Überzeugung wächst, dah wir uns mit der bisherigen Politik nicht auf dem Wege zum Frieden, sondern auf einem abgekürzten Weg zum nächsten Kriege befinden, so darf ich vielleicht sagen, daß ich zu diesem Umschwung der Stimmung einiges beitragen konnte. Es war mir wohl von Gott bestimmt, daß ich auf diese Weise der alten Heimat dienen konnte.
Diese Zeilen seien nicht geschlossen, ohne einen aus tiefstem Herzensgrunde kommenden Gruß zu senden an die alte Heimat, an die Freunde, die unter so unendlichen Opfern und Schwierigkeiten an ihrem Aufbau arbeiten, die zu ihren eigenen Sorgen und Problemen noch die Sorge für Hunderttausende aus dem Sudetenland mittragen, und nicht zuletzt Gruß auch an „Die Furche“ und ihren Kreis, dessen Geist mir aus den Spalten des Blattes vertraut und teuer geworden ist. Ich will mithelfen, soweit es in meinen Kräften steht, ein Verkünder der Wahrheit und Gerechtigkeit für Österreich zu sein, damit das „Befreite“ frei werde und seine große Mission für das Abendland weiterhin erfüllen könne. So schließe ich mit dem Wort, das mir aus jener Schicksalsstunde im März 1938 heute noch in den Ohren klingt: „Gott schütze Österreich!“.