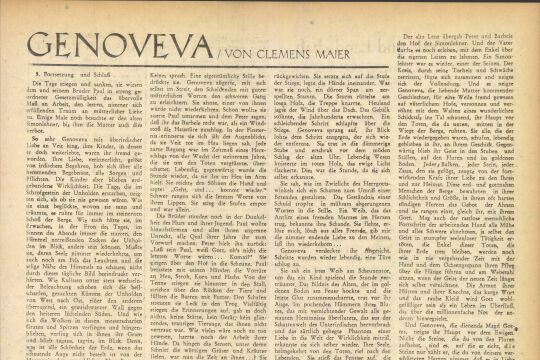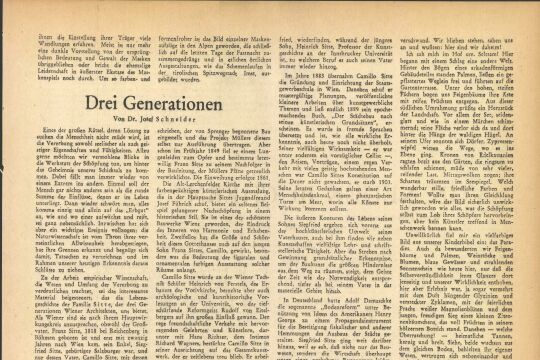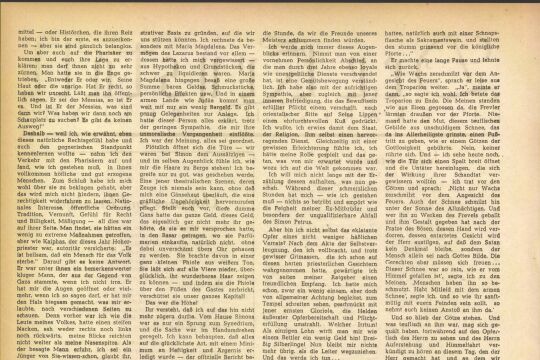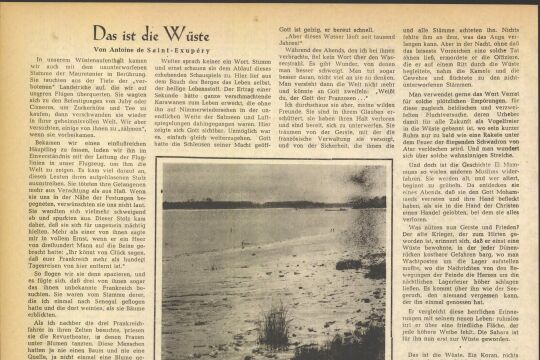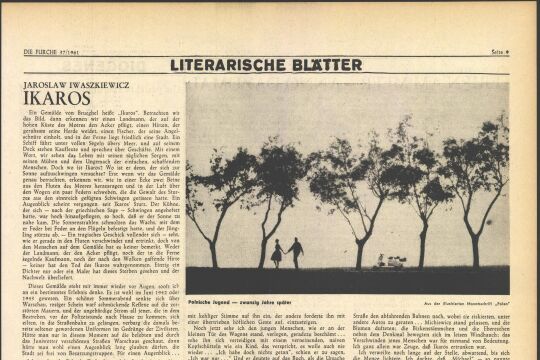Wie bei jeder Forschungsreise in ein unbekanntes Land war auch für uns zwei österreichische Missionäre der Ausgangspunkt ein kleines Städtchen, der Bischofssitz Altamira am Xingu- strom. Hier wurden die weiteren Vorbereitungen getroffen, vor allem die für die Indianer bestimmten Geschenke verpackt. Die Fahrt dauerte dann aber noch wochenkng an der Grenze der bekannten Welt. Wir fuhren auf einem der „Lanchas", den landesüblichen schmutzigen kleinen Motorschiffen, stromaufwärts, in glühender Hitze, durch tropische Regengüsse, die urplötzlich mit elementarer Gewalt wie eine Wand herabstürzen, durch klare Sternennächte, begleitet von dem infernalischen Gekreische tausender Vögel. Schweigend und drohend an beiden Ufern der Urwald, abweisend und tödlich. Manchmal klatschte ein Kaiman vom Ufer ins Wasser, einmal sahen wir eine abscheuliche Gitterschlange träge liegen. Der Forschungsreisende findet nach solchen entbehrungsreichen Fahrten schließlich Erholung in den letzten Siedlungen, nicht aber der Missionär. Denn nun begann die Missionsarbeit. Jahrelang war kein Priester hier gewesen. In den Hütten wurde rasch der Messekoffer hergerichtet. Mit ein paar Schüssen wurden die weit verstreuten Bewohner verständigt. Bald füllten die sonntäglich gekleideten Gläubigen, die mit dem Boot herbeigerudert waren, die Hütte. Nach der Andachtmußte noch lange Beichte gehört 'werden, für viele die" erste eines langen Lebetls. Die Kfhder umringten uns, denen wir mit einer Bilderbibel auf den Knien noch lange erzählen und erklären mußten. Manchmal kam ein junges Paar, da war alles vorzubereiten,' Dokumente zu schreiben, weil nächsten Tag die Hochzeit sein sollte. Frauen erschienen, die am nächsten Morgen ihr Kind taufen lassen wollten. Manch abenteuerlicher Versehgang war zu machen, über schmalem, von Spinnen und Schlangen wimmelndem Urwaldpfad oder in schwankendem Kanu in pechschwarzer Tropennacht, umlauert von Gefahren. Kranke harrten auf geistlichen Zuspruch, denn im Urwald wütet nicht nur die Lepra, sondern auch die Armeleutekrankheit, die Tuberkulose. Erst um Mitternacht konnten wir im kleinen Kreise sitzen und den dampfenden schwarzen Kaffee, Brasiliens Nationalgetränk, schlürfen. Da erfuhren wir über die weiteren Gefahren unseres Weges. Viele Ueberfälle sollten sich ereignet haben, deren Opfer die Kautschuksammler waren. Einen solchen Serringueiro habe man neulich erst gefunden, über dem umgestürzten Eimer erstarrter Gummimilch lag er mit zerschmettertem Kopf. Ueber dem Körper lagen die gekreuzten Keulen seiner Mörder. Leider waren die meisten Berichte wahr, Siedler und Indianer kannten wenig Gnade. Tauchte deshalb irgendwo ein brauner Körper zwischen grünen Bäumen auf. so riß der Serringueiro gleich die Büchse hoch. Eine Schuldfrage zu stellen, ist müßig, es herrscht das Aug um Auge, Zahn um Zahn. Unsere Aufgabe konnte nur darin bestehen, die lähmende Furcht,'die allen im Genick saß, zu bannen und für ein erträgliches Zusammenleben zu sorgen.
Die Gefahren begannen aber erst, nachdem die letzte Hütte der Siedler hinter uns war und wir in die Welt des Unbekannten drangen. Noch nie war ein Weißer hier gewesen. Mit schwerbeladenem Kanu ging es den breiten und unheimlichen Xingustrom hinauf. Die Stromschnellen erforderten alle Wachsamkeit und stellten an die Ruderkunst hohe Anforderungen. Felsstufen im Flußbett und Wasserfälle zwangen zu Umwegen. Manchmal mußten wir die Boote meilenweit durch den Wald tragen. Nachts kampierten wir an Lichtungen am Ufer.
Wir lagen schon in den Hängematten, nur unsere eingeborenen Ruderer saßen erzählend noch um das halberloschene Feuer. Die Waffen lagen griffbereit daneben, man hatte nämlich Fußspuren und eine verlassene Feuerstelle entdeckt. Jetzt waren wir am Ziel und am Beginn unserer Aufgabe: Gehet hin und lehret alle Völker . ..
Wir kamen in ein Dorf der Kayapoindianer — die ersten Priester. Nur eine kleine Expedition war, knapp vor uns, hierher vorgedrungen und hatte freundliche Aufnahme gefunden. Auf
Schritt und Tritt waren wir nun von einer Schar nackter brauner Gestalten umringt, wir sprachen aber nicht ihre Sprache, blieben also Fremde. Vorerst begannen wir die Kinder nach den Namen einzelner Dinge zu fragen, und jedesmal erscholl ein wahres Gebrüll, wenn wir einen Satz richtig aussprachen. Die Sprachlehrer wurden die Kayapokrieger. Wir saßen gewöhnlich mit unserem Schreibblock auf dem Dorfplatz oder im Männerhaus. Unsere Fragen und unsere Aussprache verursachten Gelächter. Es gab allerdings einige, die mit großer Geduld bemüht waren, uns die Stammessprache beizubringen.
Es war ein fremde Welt. Wir saßen oft und oft bei den Männern, wenn sie ihre Bogen und Pfeile schnitzten; kamen sie von der Jagd heim, dann bekamen wir „Waiangari“ (Medizinmänner) stets unser Teil. Natürlich revanchierten wir uns.
Vor allem schlossen wir mit den beiden Häuptlingen Freundschaft, mit denen wir auch bald wegen des Baues einer Kapelle und unseres Missionshauses verhandeln konnten. Später arbeitete das ganze Dorf, jung und alt, Frauen und Männer, wacker mit. Da wir nun die Sprache beherrschten, konnten wir ohne Mühe den Ausführungen des Häuptlings folgen, die er abends auf dem Dorfplatze gab. Oft schwang er dabei die Keule und klagte leidenschaftlich die Fehler seiner Leute an, die dieser Moralpauke eifrig lauschten. Wir waren auch zu den Tanzveranstaltungen gerne eingeladen, die bei Sonnenuntergang begannen und bis spät in die Nacht dauerten.
Einige Male weckte uns herzzerreißendes Schreien, das bedeutete, daß Unheil über eine Familie hereingebrochen war. Wir sprangen sofort aus den Hängematten und eilten in die Richtung der Schreie, ln einer Hütte lag ein Toter, um ihn herum im gespenstischen Schein des Feuers die Verwandten, als ob sie ihn vor bösen Geistern schützen wollten. Die beklemmende Stille unterbrachen schrille Schmerzens- schreie der Frauen, die immer wieder haßerfüllte Worte gegen die vermeintlichen Urheber des Leides enthielten. Daß sich solche heftige Anklagen leicht gegen uns. die Fremden richten, daß sie die besonneneren Männer anstecken konnten, war möglich, wir schwebten tatsächlich in Gefahr.
Wir sahen oft den Zeremonien zu. die die Begräbnisriten einleiteten. Am Grabe eines Verwandten rissen zum Beisniel plötzlich die Frauen eine Keule oder ein Buschmesser an sich und begannen, sich selbst schwere Wunden am Kopf, an den Brüsten und den Beinen zuzufügen, daß das Blut nur so floß. Die Krieger mußten ringen, ehe es ihnen gelang, die Waffen zu entreißen. Das waren Ausbrüche, die uns die ganze Trostlosigkeit und Düsterkeit des Heidentums vor Augen führten. Wer öfter solche Ausbrüche erlebt, der hört bald auf, von den Wilden als „glücklichen Naturkindern“ zu schwärmen, denen das Christentum mit seinen „Gewissensängsten" nur ihr freies, unbeschwertes Leben stehlen könnte. Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie ungeheuer wichtig es ist, wer ihnen als erster die geistigen Grundlagen der Zivilisation bringt. Kommt daher statt des Missionärs zuerst die Maschine und der Alkohol, so würden aus ihnen die ärmsten Sklaven des technischen Zeitalters ...
Unsere beiden Hütten entstanden nach brasilianischer Art. Wände aus Holz und lehm, das Dach aus großen Palmblättern — und doch verriet die Kapelle und das Haus mit verandaartigem Vorraum und dem Holzgeländer österreichischen Geschmack. Die große, spätgotische Holzfigur der Himmelskönigin in rotem und blauem Gewand, mit glänzendem goldenem Mantel, über dem Altar, ist das Werk eines Künstlers aus Oesterreich, der goldene Kelch, die heiligen Gewänder und Paramente stammen auch zum Teil aus der Heimat. Der Eindruck bei den Indianern war stark. Sie hätten sie gerne berührt, aber sie unterließen es, als wir sagten, sie seien „Me- karon" (Geist, Seele, unberührbar, geheimnisvoll, heilig).
Zur Sonntagsmesse durften die Indianer in die Kapelle. Sie war gedrängt voll von braunen Gestalten, vorne die Kinder, hinten die Großen. Wir bemühten uns, das Aeußere des Gottesdienstes der Konzentrationsfähigkeit der Indianer entsprechend zu gestalten. Bei der Predigt in der Kayaposprache, die immer eine der grundlegendsten Wahrheiten unseres Glaubens behandelte, erklärte einer von uns beiden die Bilder, die wir mitgebracht hatten und die gerade dazu paßten: Den Sündenfall, Moses mit den Gesetztafeln, die Geburt in Bethlehem, die Auferstehung usw. In Tonfall Und Redewendung versuchten wir, um die Wirkuns Zu erhöben, den Häuptling am Dorfplatz zu imitieren. Beider inhaltlichen Gestaltung hielten wir uns an die indianische Vorstellungswelt, sprachen also klar und einfach. Dabei klang sicher etwas an die Worte an, in denen uns unsere eigene Mutter seinerzeit von der biblischen Geschichte erzählt hatte.
Unser Grammophon hatten wir mit. Abends legten wir Platten auf mit brasilianischen Volksliedern, Kirchenliedern der Siedler. Dabei erzählten wir über deren Leben und reichten auch Bilder herum. Es gehört ja auch zu unserer Aufgabe, für die geistige Annäherung an das große brasilianische Volk zu wirken, mit dem schließlich die Indianer das gleiche Land teilen. Es war höchst interessant, daß klassische Musik großen Eindruck machte. Das Grammophon stand im offenen Vorraum auf einem Tisch, im rötlichen Schein der Petroleumlampe saßen die herzigen braunen Kinder, Buben und Mädchen, mit pechschwarzem, langem Haar, gedrängt auf dem Fußboden. Im Hintergrund die Männer, das wilde Gesicht rot und schwarz bemalt. Man hätte eine Stecknadel fallen hören, während aus dem „Koit-Ngrere", dem „singenden Eisen“,
Mozarts „Kleine Nachtmusik“ ertönte..Das hat sich Mozart wohl nie träumen lassen!
Als wir ihnen aber das erste Mal die hoffnungsfrohen „G’schichten aus dem Wienerwald“, gesungen von den Wiener Sängerknaben, vorspielten, da erscholl von den Indianern wie aus einem Munde ein langgezogenes, lautes rollendes „R—R—R—R—R“, ihr Ausruf des Entzückens. „Me bogtire waiangäri pukä-kam ngrere“, „Buben in der Heimat der Waiangäri (Missionäre) singen das“, erklärten wir. „Nyära waiangäri pukä?“ „Wo ist die Heimat der Missionäre?“ fragte ein Kayapokrieger. Das gleiche Wort „pukä“ heißt: Heimat, Erde, Vaterland, Land. „Onyia waiangäri pukä“, „dort weit, weit drüben ist die Heimat der Missionäre“, sagten wir und deuteten mit der Hand gegen Osten. Das Wort „onyia“ mit einem langen singenden Ton auf dem „i“, wie man es macht, wenn man sagen will, daß etwas sehr, sehr weit weg ist. Jetzt stellten die Indianer eine Menge Fragen, und auch später wollten sie immer wieder etwas von diesem Land wissen.
„Wenn man dorthin will, dann muß man zuerst dem kleinen Fluß und dann dem Xingufluß folgen (den ja die Indianer von ihren Kriegszügen nur zu gut kannten!), und auf einmal ist man dann bei einem großen, großen Wasser, über das man nur mit einem riesigen, starken Kanu drüber kommt. Dann muß man noch gehen und gehen! Wohl zwei Monde braucht man für den ganzen Weg...“ sagten wir zu ihnen. Wir erzählten auch, daß ės in dem Land viele Berge: „Kraire körnet, Berge viele", schöne Wälder: „Bö mėt, Wälder schöne“, mit viel Wild: „Mrü körnet, Wild vieles",' gibt. Daß dort große Dörfer: „Kriräit, Dörfer große", sind, daß die Leute dort schöne große Pflanzungen haben: „Püru met tl, Pflanzungen schöne, große“, und fleißig arbeiten: „Nipet körnet, arbeiten fleißig, viel“. Auch erzählten wir von unserem Häuptling: „Benyadyöre“, von großen Häusern: „Kikre-ti, Häusern großen“, schönen Kirchen: „Mekaron-nürukwa (wörtlich: des Geistes Wohnung) met, Kirchen schönen“, und daß dort viele Menschen an Gott glauben: „Me-ba-bäm märi, Unsern Vater glauben“.