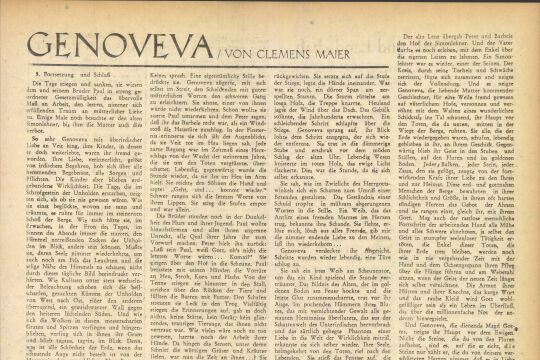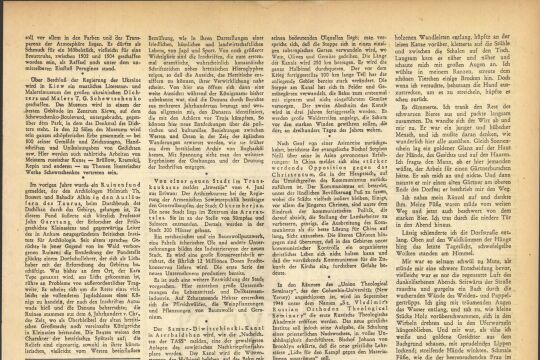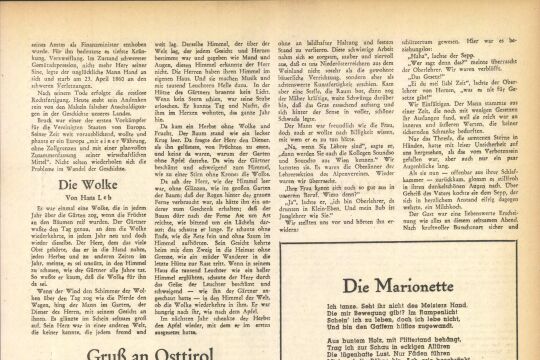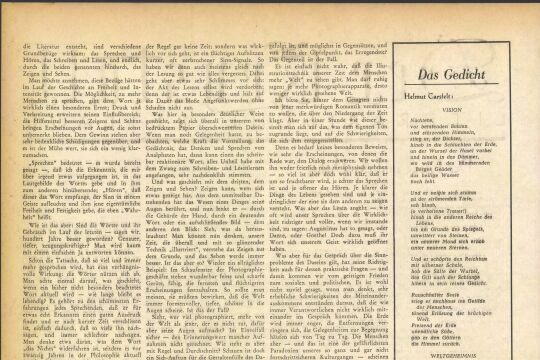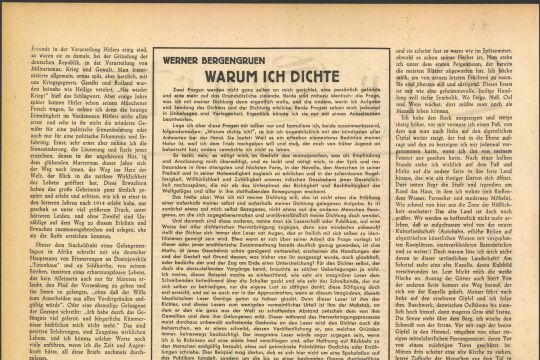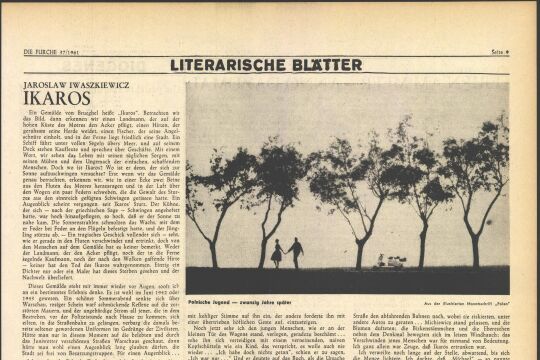Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Stück Paradies
Es war im vorigen Sommer. Über dem St.-Gotthard-Paß regnete es in Strömen wie allerorts, seit unserer Abfahrt aus Wien. Nach dem letzten Tunnel aber — ach und oh! riefen die Mitreisenden vor Entzücken — schien die Sonne und das wellig hingleitende Land entfaltete seine südliche Schönheit. Ein Friede ganz eigener Art war hier ausgegossen, als habe die Hand des Schöpfers selbst über diese Täler und Höhen gestreichelt, Gewiß, ursprünglich war kein einziges Fleckchen der Erde ausgenommen von solchem Segen; hier blieb er aber fühlbar, als strömte er immer noch nach. Sogar das Gemüt des modernen, unsteten. Menschen konnte etwas von der ausgleichenden, milden Kraft dieser Landschaft empfangen.
In den Luganer See war die Bläue des Himmels gesunken. Der Himmel selbst war noch tiefer gefärbt, dunkel wie Enzianglocken. Er wölbte sich über die reich gegliederte Schönheit der Umgebung und einte ihre Vielfalt.
Das Auge ward vom Grün der bewaldeten Vorgebirge wohltätig gefüllt. Hinter ihnen ragten Felsen auf, reihten sich zu mächtigen Ketten und es schien, als hätten sie ihre Größe nur um des väterlichen Schutzes dieser weichen Landschaft willen bekommen. Sogar das bunte Straßenleben Luganos war befriedet davon.
Wir fuhren aber weiter hinein ins Tessin.
Unser Fahrzeug schlängelte sich durch sauber angelegte, aber staubige Straßen. Mitten in die Laubwälder der Berglehnen waren, mehr oder weniger hoch, kleine Ortschaften gebettet. Zusammengedrängt, gleichsam aus einem Baukasten heraus, belebten sich die Hänge. Die einen grüßten burgartig, die anderen nestwarm.
In einem solchen Nestchen, in Neggio, stiegen wir aus. Alles erinnerte an das nahe Italien: die Bauart des Glockenturms, die holperigen, nicht mehr ganz rein gehaltenen Gäßchen und die dunkelhaarigen Frauen, die auf den Bänken vor ihren Häusern saßen. Auf unsere deutsche Frage konnten sie keine Antwort geben, aber sie zeigten uns „Ca del sole“, die Pension, in der wir wohnen sollten.
Wir öffneten das Tor des alten tessini- sdien Gebäudes, Hinter der tiefen Einfahrt silberte der Kies des Hofes. Ein Hortensitn- strauch bot den Willkommgruß, so überaui reich und schwer von Blüten, daß mein Blick auf ihm ruhen blieb. Dann erst sah ich, daß im stillen, heimeligen Hof drinnen ein zweites, sehr freundliches Gebäude stand: unsere Pension. Aus einer der Türen trat eine weiße Schwester, kam auf uns zu, strahlte uns mit sonnigen Augen an, nannte uns mit Namen und bat, nur ein kleines Weilchen zu warten, bis dje Zimmerschwester käme. Si nahm uniere Koffer und verschwand. Wir blieben stehen, sahen uns an und wußten: hier sind wir daheim!
Ich sah mich im Hof um. Seltsam! Hier begann mit einem Schlag eine andere Welt. Hinter den Bögen eines arkadenformigen Gebäudeteiles standen Palmen, ließen ein gepflastertes Weglein frei und führten auf die Gartenterrasse. Unter den hohen, steifen Fächern bogen uns Feigenbäume ihre Äste mit reifen Früchten entgegen. Aus dieser südlichen Umrahmung grüßte ein Herzstück der Landschaft. Vor allem der See, seidenglatt und wie in einem Märchen schimmernd; seine Fläche verlor sich da und dort hinter die Hänge der waldigen Hügel. An seinem Ufer sonnten sich Dörfer. Zypressen wipfel wiesen die Wege, wo es im Ebene ging. Kronen von Edelkastanien ragten breit aus den Gärten, die ringsum zu schlafen schienen, müde von sehr vieler, reifender Last. Mittagswolken zogen; ihre Schatten träumten im Seespiegel. Welch wunderbar stille, friedliche Farben und Formen! Wollte man ihren Gleichklang festhalten, wäre das Bild sicherlich unwirklich geworden wie alles, was die Schöpfung selbst zum Lob ihres Schöpfers hervorbringen, aber kein Künstler treffend in Menschenwerk bannen kann.
Unwillkürlich fiel mir ein vielfarbiges Bild aus unserer Kinderbibel ein: das Paradies. Auch da bewunderten wir Feigenbäume und Palmen, Weinstöcke und Blumen, blaue Gewässer und strahlenden Sonnenschein wie heute hier, nur daß die Selbstverständlichkeit jenes Glanzes dort jenseitig und unserer Wirklidikeit entheben, hier aber Erlebnis war, ja sogar vermehrt mit dem Duft hängender Glyzinien und versteckter Zyklamen, mit der feierlichen Pracht weißer Magnolienblüten und dem jungen, freudigen Sieg eines kleinen Zitronenbäumchens, das voll Früchten in seinem hölzernen Bottich stand. Daneben — welche Überraschung! — heimatliche Tannen, kernig und breit. Siehe, beide wuchsen aus dem gleichen Boden, behielten ihr eigenes Wesen, vertrugen sich nebeneinander und verbanden so Norden und Süden.
Ein ähnlidies, anderes Stück Paradies fand ich drinnen im Haus: das Zusammenleben der weißen Schwestern untereinander und die Atmosphäre, die ihr Da-Sein und Wirken strahlte. Die Art, wie sie sich um eines Höheren willen ins Ganze fügten und ihre Gäste aus dem Norden und Süden Wurzel fassen ließen im Boden ihres eigenen Friedens, war ebenso harmonisdi wie der Garten draußen. Die stets wechselnde, zufällige Tischgemeinschaft wurde in dieser Harmonie ganz von selbst familienhaft. Wer neu dazu kam, ward gut aufgenommen, fühlte sich bald wohl und schifcd nicht ohne Bedauern. Machte es der Spruch, der gleich eingangs beim Stiegenaufgang den Gast empfing? Er hieß: „Freude dem, der kommt, Friede dem, der hier verweilt, Segen dem, der weiterzieht,“ Nein, das war kein Zauberspruch, aber sein Inhalt wurde allemal wahr.
In „Ca del sole" waltet nämlich die Liebe, echt und wirklich, nidit nur zum Schein. Ihre Existenz entfaltet sich ganz selbstverständlich und so lautlos, wie alles, was Sein hat und wächst. Unvermerkt füllt solche Liebe die Räume des umgebenden Lebens, audi nach innen. Niemand kann sich ihrer Wirksamkeit entziehen.
Die Dominikanerinnen, die selbst ihre Gäste bedienen, führen den „Betrieb" ganz ohne Betriebsamkeit. Sie sind bloß da, wenn man etwas braucht, sind zuvorkommend und in ihrer Aufmerksamkeit so schwesterlich, als wäre jeder Gast der einzige, den sie umsorgen wollten. Trotzdem und bei aller Dienstbereitschaft verliert keine der Schwestern auch nur etwas von ihrer persönlichen, aufrechten Menschenwürde. Ihr Dienst ist ja Gottesdienst, also schon deshalb gewissenhaft und herzlich, unermüdlich und niemals abgestanden. Man lernt von den Schwestern und gleicht sich an. Allen geht es so.
Da saßen an einem der längeren Tische einmal zwölf Gäste aus den verschiedensten Ländern. Der eine war Arzt, protestantischen Glaubensbekenntnisses, au der Schweiz; neben ihm saß eine Witwe aus Holland, die Dachau selbst erlebt und dort ihren Mann und auch ihren einzigen Sohn verloren hat; ihr gegenüber saß ein namhafter Bildhauer aus München; dann ein fröhlicher, sehr musikalischer Franziskanerpater aus Belgien; eine estländische Gesanglehrerin, die aus Buenos Airos kam; ein ungarischer Flüditling samt Frau; ein junger Doktor der Philosophie aus England; ein geistig und innerffch sehr regsamer Abbf aus der Bretagne; zwei Baumeis'er
@@@aus Süditalien, ein Professor aus New York und eine stille, vornehme alte Dime mit reicher Lebenserfahrung und starker Herzenskraft. Wie meistens, wurden Zeitfragen erörtert. Erst allgemein, dann aus dem Blickwinkel des einzelnen und schließlich mit Rücksicht auf Schicksale, die sie selbst und ihre Bekannten erlebten. Endlich, meinten sie einmütig: „Die Machthaber sollen uns nur nicht weismachen, daß die Völker sich nicht verständigen könnten! Wir alle sind ähnlicher Meinung und wollen im Grunde dasselbe. Wenn bloß die führenden Köpfe auch den gleichen Nenner finden und sich verständigen wollten wie wir, die der Wind hier zusammentrug!" Einer meinte lächelnd: „Laden wir die Großen nach Neggio!“
Durch die breiten Fenster floß der Abend friede. Die Vorhänge bewegten sich, sie ließen den Luft hauch tessinischer Milde in den Saal. Das Gespräch der Gäste wurde übertönt von den Glocken. Klangvoll metallene, südliche Glocken, vierfach gestuft aufeinander abgestimmt. Ihren vollen, kostbar verschmelzenden Akkord trug die Stille über die Ortschaft hinweg, über die steilen Terrassen der Gärten und den See. Die Schwalben flogen gegen den Himmel. Dieser schien wie offen und senkte sich mählich der schönen, friedlichen Bereitschaft der Erde entgegen. Wir gingen in den Garten, denn das Geheimnis der Himmelsnähe zog uns. Dort sprachen wir weiter und mit zunehmendem Vertrauen über den Frieden, den das Herz der Völker ersehnt.
Von den Weinlauben her kam eine Schwester mit einem Korb früher Trauben, selbst gesetzt und gepflegt. Trauben und Wein- stodk, Arbeit und Ernte — wir dachten des großen, tiefen Symbols. Etwas in uns fragte unüberhörbar: Und eure Reben? Eure
Ernte?
Mit der Dämmerung öffnete der Himmel seinen Zugang: ein Stern nach dem anderen erglomm. Seht, so reich und so licht ist der Friede! Er sinkt in das Herz, wenn es emporblickt und glaubt.
Im See floß ein Strom silbernen Mondscheins; breit, voll lebendigen Rieselns verband er Ufer mit Ufer. Wie nahe die fernen Ufer doch sind!
Wir schwiegen. Wir schauten. Erkannten und öffneten uns. Schauer lebendiger, durchrieselnder Ehrfurcht weckten unsere Geister aus ihrem Schlaf und ein Stück ersehnten Paradieses gewann Boden, mitten in uns.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!