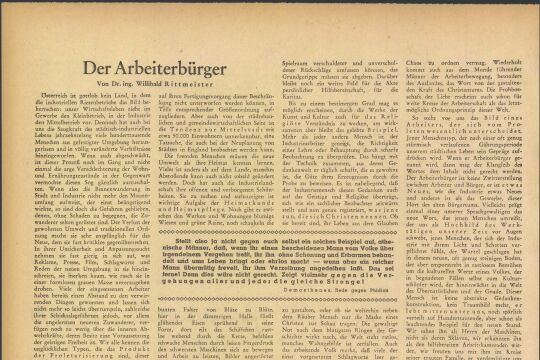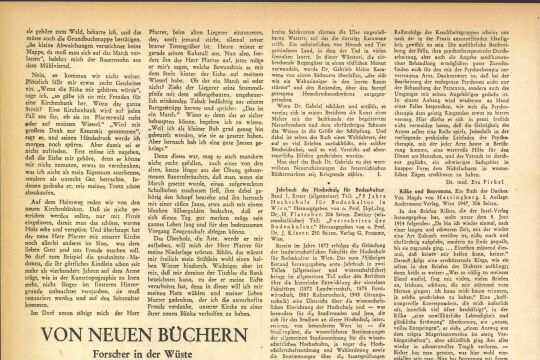Zu der Gesamtausgabe der Gedichte Guido Zernattos Von Helmut A. Fiechtner
Aus dem vielstimmigen Chor, der in der Anthologie .Der ewige Kreis“ aus dem Jahre 1935 versammelt war und der eine neue Blüte der österreichischen Lyrik bezeugte, tönte eine eigenartige, dunkle Stimme — unüberhörbar und lange Zeit nachklingend — hervor. Immer wieder, wenn man von diesem Ton getroffen wurde, las man unter den Gedichten den Namen Guido Zer-n a 11 o, der, bereits sieben Jahre vorher, unter dem Titel Mein Herz im Spiegel“, seinen Freunden Rechenschaft abgelegt hatte über seine Entwicklung und 1930 unter 550 Einsendern mit dem ersten Preis der Kolonne“ in Dresden für seine erste gültige Gedichtsammlung ausgezeichnet worden war. Dieses Buch trug den Titel Gelobt sei alle Kreatur“ und spiegelt bereits in voller Deutlichkeit alle jene Themen, die für das Schaffen Zernattos charakteristisch sind und von ihm immer wieder abgewandelt wurden.
Diese ersten Gedichte waren zunächst durch den kühnen und sichern Griff nach Motiven bemerkenswert, die bisher als „unlyrisch“, vielleicht sogar als „undichterisch“ galten. Denn weder vom „Kälbern“ noch von der „Ersten Schlachtung“, weder von einer Verluderten Wirtschaft“ noch von der harten Arbeit des .Säglers“ hatten die Diohter bisher zu singen gewagt. — Was ferner auffiel, war die Tatsache, daß der Dichter alle diese Dinge genau und bis ins Detail kannte. Ein sehr prosaischer Beruf — als Einkäufer einer Villacher Holzhandelsgesellschaft — hatte Guido Zernatto, der als sechstes von sieben Kindern in Treffen bei Villach geboren wurde und einer aus Friaul eingewanderten Landwirts- und Kaufmannsfamilie entstammt, in die entlegensten Täler und Gräben geführt, wo er tagelang das Leben der Bauern und Holzfäller teilte. Damals schon hielt der Drang zum tätigen Leben dem zur dichterischen Aussage des Erlebten die Waage: 1925 gründete der Zweiundzwanzigjährige die .Kärntner Monatshefte“; als diese nach einem Jahr eingingen, kam Zernatto — unter schwierigen materiellen Bedingungen — nach Wien, wo er die Matura bestand und an der Universität das Jusstudium begann. Das Jahr 1929 wurde entscheidend: er begann, aktiv am politischen Leben teilzunehmen und erkrankte an jenem Leiden, das ihn noch vor seinem 40. Lebensjahr fällen sollte. Dazwischen freilich lag ein überreiches Leben, reich an Tätigkeit, Verantwortung und ehrenvollen Ämtern, reich auch an künstlerischem Schaffen und literarischem Erfolg. Bereits 1931 erschien in einer Wiener Zeitschrift Zernattos erster Roman, Der Weg über den Berg“, 1934 der zweite Roman mit dem bezeichnenden Titel Die sinnlose Stadt“ und die Gedichtsammlung „Die Sonnenuhr“; er wurde zum Präsidenten des Verbandes katholischer deutscher Schriftsteller“ und gleichzeitig zum zweiten Leiter des österreichischen Bundesverlages ernannt; im Mai 1936 holte man ihn — ein wahrhaft symbolischer Vorgangl — aus einer Vorlesung von Gedichten ins Bundeskanzleramt, das er im Morgengrauen als jüngstes Mitglied der neugebildeten Regierung verließ. Die folgenden zwei Jahre bekleidete er das Amt eines Staatssekretärs und zuletzt das des Generalsekretärs der „Vaterländischen Front“ im Range eines Ministers, und nur in diesen letzten beiden Jahren ließen öffentliche Tätigkeit und Verantwortung dem dichterischen Schaffen keinen Raum. Dann kam — in der Nacht des Einmarsches der deutschen Truppen
— die Emigration: über Preßburg, Paris, Lissabon nach New York; es kamen Jahre bitteren Wartens und wissenschaftlicher Tätigkeit, zuletzt an der Fordham-Universityi in den USA, wo er als Research-Professor eine großangelegte Untersuchung über die Nationalitätenfrage begann, deren Manuskript („The Question of Nationalities and the Future of Nations“) nur zum Teil in Zeitschriften amerikanischer Universitäten veröffentlicht ist. Auch in diesen schweren Jahren ist die dichterische Stimme Guido Zernattos nicht völlig verstummt: ein schmales halbes Dutzend ergreifender Gedichte, die den Abschluß der Gesamtausgabe des lyrischen Werkes bilden, legen davon Zeugnis ab *.
Uberaus charakteristisch und eindrucksvoll, wie die Themenexposition einer Symphonie, sind die ersten Verse im Eingangsgedicht („Mondnachtlegende“) von Zernattos erster lyrischer Sammlung:
Sei es, daß nur der Roßknecht den Strick . schlecht verklängte,
Daß sich leichter der Halfter vom Kopf streifen ließ,
Oder war's, daß das Mondlicht den Rappenhengst bedrängte
Und ihn wild durch die Stalltür ins Nächtliche stieß:
Hr bäumte sich frei zwischen Himmel und Erde
Wie ein Sturmwind zum Mond und den Sternen empor ?
Und ein Urtrieb ward wach, als mit dieser Gebärde
Sein Gezähmtsein sich groß an die Wildnis verlor..
Der eigenartige und kühne Vorwurf, die naturmagische Stimmung, die — scheinbar — kunstlosen, sdiwerrollenden Verse und eine jedes lyrischen Flitters entkleidete Sprache — in der nur ab und zu ein Abstraktum stört —: das ist schon der ganze Dichter in seiner unverwechselbaren Eigenart. Und auch die letzte Strophe dieses Gedichts enthält ein wichtiges Motiv von Zernattos Lyrik: das Schwere, Dumpfe, Erdverbundene und zugleich Jenseitige gewisser Stunden und Erlebnisse, in denen man es innerlich schauernd wie einen kalten Luftzug spürt“:
Dann aber erwachte der Knecht durch ein
Stöhnen
Des Viehs, das sich wund an den Stallketten riß.
Er hob sich halb auf und verspürte ein
Föhnen,
Das lau durch die Tür bis zur Liegerstatt
blies.
Als Beispiel für diesen charakteristischen Ton und für die Sphäre von Zernattos Landschafts- und Bauerngedichten 6ei noch die letzte Strophe eines .Herbstgedichtes* angeführt:
Jetzt spielt der Vorknecht Sonntags wieder auf der Zither,
Wenn alle In der dunklen Küche bleiben.
Der Kalmusschnaps im Glas schmeckt stark und bitter,
Und Nebel braut vor angelaufnen Scheiben.
Nur selten graten die Gedichte Zernattos thematisch über die Welt der Bauern und Jäger, der Knechte und Holzfäller hinaus. „Nacht' in der Holzknechthütte“, .Bitte einer gekündigten Magd an den Bauer“, .Hochwasser“, .Stall im Winter“, .Der Drusch“ — so heißen die bezeichnenden Titel einiger Gedichte, welche eine genaue Kenntnis der Menschen und ihrer Lebensumstände zeigen, wie sie nur das auf dem Lande aufgewachsene Kind besitzt; sie künden aber auch von der sozialen Not, von Armut und schwerer, unbedankter Arbeit ... Denn diese Welt wird nicht romantisch idealisiert und lyrisch verschönt. Wir finden bei ihm weder Verniedlichung noch bittere Anklage, sondern jene Nüchternheit, die einzig dieser Welt angemessen ist und zu ihrer Bewältigung taugt; und sie ist angeschaut mit dem Blick der Liebe, der alle Kreatur umfaßt und der aus einer zutiefst christlichen Grundhaltung kommt — die bei Zernatto kaum je mit Worten umschrieben wird. — Dem Dunklen und Fragwürdigen hat sich der Dichter Zernatto keineswegs verschlossen, und es gibt bei ihm Augenblicke der Verdüsterung, die wie ein Vorgefühl seines späteren Schicksals, als eines aus seiner geliebten Heimat Vertriebenen, anmuten. Fast mythischen Charakter haben einige balladenhafte Gedichte, welche die Begegnung des Menschen mit dem Tier in der Urlandschaft schildern: .Der Fisch“, .Der Hirsch“, „Schuß im Dunkel“ und andere. — Stadt und Land stehen in einem Spannungsverhältnis, und dieses Motiv wird in verschiedenen Variationen abgewandelt, am schönsten vielleicht in dem „Liebesbrief an ein Pferd“:
Ich bin, mein lieber Schimmel, In einer großen Stadt, Von jenem blauen Himmel, Der uns geleuchtet hat
Auf vielen, vielen Ritten, Ist hier kein Fleck zu sehn. Und es ist niemals Erde, Worauf die Menschen gehn.
Sie gehn auf harten Steinen Und gehn auf dem Asphalt. Ich möchte manchmal weinen Nach Wiese, Acker, Wald. Ich möchte wieder einmal Mit dir im Freien 6ein Und über die Wiesen traben Bis in den Abend hinein ...
Diese Liebe zu aller Kreatur, die enge Verbundenheit mit der Heimaterde, mit Wiese, Acker und Wald, bildet den sonoren Grundakkord aller Dichtungen Zernattos ... Was mag dieser Mensch, der schon das Leben in der „sinnlosen Stadt“ wie eine Verstoßung empfand, gefühlt haben, als er auch die Heimat verlor und ins Exil gehen mußte? Davon möge eines der letzten Gedichte Zernattos zeugen, das er 1943 in New York schrieb:
Dieser Wind der fremden Kontinente Bläst mir noch die Seele aus dem Leib. Nicht das Eis lähmt mir das frostgewohnte, Und die Schwüle nicht das lang entthronte Herz, das leer ist wie ein ausgeweintes Weib.
Dieser Wind der fremden Kontinente
Hat den Atem einer andern Zeit.
Andre Menschen, einer andern Welt geboren,
Mag's erfrischen, Ich bin hier verloren
Wie ein Waldtier, das in Winternächten schreit.
Macht die Erde wieder fruchtbar!
Von Dipl.-Ing. Walter Schauberger*
Zahlreiche Überlegungen, so auch das Ergebnis der Beobachtungen verschiedenster Naturvorgänge, sowie die Feststellung der schon vielfach in Erscheinung tretenden Verfalls- und Zerfallsprozesse in der gesamten Umwelt, in allen Bereichen des Lebens, auch in uns selbst, führen zu der unwiderlegbaren Erkenntnis, daß die gegenwärtigen mechanistischen Wirtschafts- und Bearbeitungsmethoden, vor allem in der Forst-, Land-, Wasser-und Energiewirtschaft, in einem nicht zu unterschätzendem Ausmaß naturwidrig sind. Sie führen bereits auf
zahlreichen Gebieten des Lebens zu einer progressiven Reduzierung und Degeneration vieler hochorganisierter Formen und zum Zerfall von Teilen der Lebensformen.
Der Mensch hat im Gang durch die Jahrtausende sehr viele Dissonanzen in die Umwelt gesetzt. Er hat das Landschaftsbild Schritt um Schritt und dabei grundlegend und nachhaltig verändert. Auf unübersehbaren Gebieten hat er das Leben total vernichtet. Mehr als ein Sechstel der Erde ist bereits Wüste. Und auf unübersehbaren Flächen hat er die Vielfalt der Lebensformen zerstört und eine monotone, rationelle Landschaft geformt.
Die weitere Versteppung der Erde hat in den letzten Jahrzehnten erschreckend zugenommen. Diese vom Menschen entfesselte Zerstörung der Lebensquellen hat im 20. Jahrhundert durch die Mittel der Technik einen Höhepunkt erreicht. Die gesamte zivilisierte Menschheit ist In einen Grad von Tätigkeit geraten, unter dem die Erde bebt.
Aliein der progressive Rückgang der Bodenfruchtbarkeit und die nun drohende Versteppung ganzer Kontinente, die noch vor weniger als 150 Jahren zu den fruchtbarsten Gebieten unserer Erde gehörten, zeigen eindeutig die Ursachen des Verfalls. Sie stehen in direktem Zusammenhäng zu den mechanistischen Bodenbewirtschaftungsmethoden, vor allem zu den naturwidrigen Monokulturen.
Wir müssen, ob wir wollen oder nicht,schon die Erkenntnis entgegennehmen, daß die Wüsten und Steppen ein Werk des Menschen sind.
Das historische Denken hat sich bisher die Aufgabe gestellt, die einzelnen
Lebensläufe der Völker, deren Aufstieg und Untergang chronologisch zu registrieren. Alles in allem können wir daraus die Geschichte der Menschheit weniger Jahrtausende am Rand erfahren.
Es fehlt aber an einer Geschichte der Landschaft.
Der Mensch steht nun einmal in einem unlösbaren Zusammenhang zu seiner Umwelt. Mensch und Landschaft bilden daher erst die Ganzheit, die Einheit. Ohne die Landschaft kann das Leben und das Denken eines Volkes nicht verstanden werden.
In der Folge der ägyptischen, antiken, arabischen und abendländischen Kultur hat sich zum Beispiel Schritt um Schritt um das Mittelalter herum eine stetige Wandlung des Klimas vollzogen. Die Sahara lag zur Zeit Hannibals weit im Süden von Karthago. Heute dringt sie bereits in das südliche Spanien und Italien ein. Wo war sie aber zur Zeit der ägyptischen Pyramidenbauer mit den Wald- und Jagdbildern auf ihren Reliefs? In dem jetzt kahlen, von der Sonne völlig ausgebrannten Fessan lebte nach Herödot noch vor 2000 Jahren das gewaltige große Volk der Garamanten. Durch Tibet und im Norden von Tibet führten im Altertum die berühmten Seidenstraßen nach dem Westen durch weite, volkreiche Gebiete. Es ist jedenfalls auffallend, daß alle verfallenen Kulturen Wüsten, Öden und Karste hinterlassen haben. Ich stelle daher die Behauptung auf, daß alle diese Völker im Zuge der fortschreitenden Zivilisation durch rationalistische Bodenbewirtschaftungsmethoden ihr Land zur Wüste geformt und unter anderem d a-durch sich selbst ein Ende bereitet haben.
Wir müssen aus dem Schicksal vergangener Epochen lernen und dem weiteren Verfall unserer Landschaft Einhalt gebieten. Die Entblößung der Erde von Baum- und Graswuchs war und bleibt der Ausgangspunkt für den Klimawechsel. Hier allein liegen die Ursachen für den Ubergang zum Wüstenklima. Die Menschen haben bisher noch nicht darauf geachtet, daß sie sich selbst das Klima g e s t a 1 t-e n.
Wir müssen uns vor allem darüber klar werden, wozu in der Natur die Vegetation dient. Nicht nur allein, um uns zu ernähren oder uns zu erfreuen! Die Vegetationsdecke hat auch für den Gesamtorganismus Erde eine, wenn auch bisher kaum beachtete, ungeheure Bedeutung.
Zwischen der Hydrosphäre (vor allem dem Grundwasser), der Vegetationsdecke und der darüber pulsierenden Lichtsphäre besteht eine ganz eindeutige Wechselbeziehung. Die Vegetation ist der große Mittler im energetischen Wechselspiel zwischen der Hydrosphäre und Lichtsphäre. In der Natur ist alles sehr einfach, wenn auch unendlich nuanciert und differenziert. Was für den Grashalm gilt, gilt auch für die Wiese, für die Landschaft und so auch für den großen Organismus Erde.
Leben ist der Eindruck eines Äußeren und der Ausdruck eines Inneren.
Im rhythmischen Ausgleich von innen nach außen und von außen nach innen geschieht das Leben, und je stärker die polaren Gegensätze sind, desto mehr Lebenskraft äußert die Form, die in Wechselgeschehen in Erscheinung tritt. Im Grashalm, im Baum, an uns und so auch am Erdkörper sehen wir ein gleiches System:
Im Innern die Säfte und außen das Licht!
Und zwischen diesen beiden polaren Gegensätzen ist ein trennender, isolierender Mantelj und nur ganz bestimmte, energische Wertigkeiten vermögen diesen Mantel in beiden Richtungen zu durchdringen.
Die Vegetation, die mit ihren bunten, harmonisch dosierten Oberflächenformen in die Lichtsphäre hinausragt und mit ihren ebenso vielfältigen Wurzelsystemen in die Hydrosphäre hinabstößt, ist der große Mittler im rhythmisch-energetischen Wechselspiel dieser beiden gegen-
sätzlichen Sphären. Je vielfältiger, bunter und höherentwickelter die Pflanzen mit ihrem unendlich differenzierten Kronen-und Wurzelsystem die Erde bedecken, desto höher ist die Polarität zwischen innen und außen. Daß die Geosphäre negativ geladen ist und die darüber pulsierende Atmosphäre hingegen positiv, ist ja eine bereits längst festgestellte Tatsache.
Dieses Prinzip der Bipolarität finden wir überall; wir können dieses Prinzip auch „männlich-weiblich“, oder „elektrisch-magnetisch“ nennen. So ist ja auch zum Beispiel das Licht in seinen zahllosen Lichtarten eine elektromagnetische Wesensform. Die Stärke der Polarität steht nun in direktem Zusammenhang zur Güte, zur Wertigkeit der isolierenden Schicht.
Auf einer Fläche von mehr als 2500 Millionen Hektar Grund und Boden wurde der Erde buchstäblich die „Haut abgezogen“, und auf weiteren ungeheuren Flächen wurde der isolierende Mantel durch Monokulturen durchlöchert. Wir sind auf dem besten Wege, die atmende Haut der Erde zu einem Drittel zu zerstören. Der Mensch muß sterben, wenn an ihm ein Drittel seiner Haut zerstört ist. Der Erde, und damit allem Leben, droht die gleiche Gefahr. Die Krankheitssymptome, die beim Menschen bei Verlust von mehr als einem Sechstel der Haut in Erscheinung treten, gleichen vollkommen den Erscheinungen, die wir zur Zeit erleben. Der total gestörte Wasserhaushalt in der gesamten Natur, der Verfall der Wasserqualität, die völlig destruktiven klimatischen Verhältnisse (analog Fieber) usw., usw. sind einige Anzeichen.
Das, was wir heute erleben — geistig und körperlich —, möchte ich als den „Krebsgang der Natur“ bezeichnen. Hochwertiges verfällt... niederorganisiertes wuchert. (Analog Krebs beim Menschen, Zunahme der pathogenen Lebenswelt, der Schädlinge usw.)
Alles in allem ist unsere Lage katastrophal; es nützt auch gar nichts, wenn wir uns darüber hinwegtäuschen wollen. Jeden einzelnen geht es an, denn nur in einem gemeinschaftlichen Einsatz werden wir die Katastrophe verhindern und aufhalten können. Kennen wir den Weg des Unheils, so wissen wir auch den Weg des Heils. Die Parole lautet:
Es gilt vor allem, die Erde wieder fruchtbar zu machen!
Wir haben das Siechtum der Erde selbst verschuldet, und so müssen wir in erster Linie trachten, die Natur wieder zu heilen, die entblößten Stellen der Erde mit blühendem Leben bedecken und das Wasser, das Blut der Erde, wieder gesund machen, in dem wir die seinem Gerinne von der Natur vorgeschriebenen Mäander nicht zwecks Geradlegung durchstechen. Durch Bepflanzung der Ufer müssen wir dem Wasser so viel Sonnenschutz als möglich geben, damit es frisch und tragfähig bleibt und sein Geschiebe als Wegzehrung mitnehmen kann. Außerdem gibt das frische Wasser, also das hochwertige, seiner Umgebung durch Strahlung Kräfte ab, während schales, warmes Wasser Kräfte aus seiner Umwelt nimmt, um sich wieder aufzuwerten.
Ein ebenso dringendes Gebot ist die Schonung des Waldes, denn der Wald ist die Wiege des Wassers. Wir dürfen keine Kahlschläge machen und müssen vor allem die jungen Bäume im Schatten der alten aufwachsen lassen.
Die Forschungen meines Vaters Viktor Schauberger und eigene Arbeiten haben unter anderem zu grundlegenden Erkenntnissen über das Wasser geführt. Diese neuen biologischen Zusammenhänge zwischen Wasser, Vegetation und Lichtsphäre fordern kategorisch die Bedeckung der Erde mit einer reichhaltigen, vielfältigen und harmonisch gemischten Pflanzenwelt.