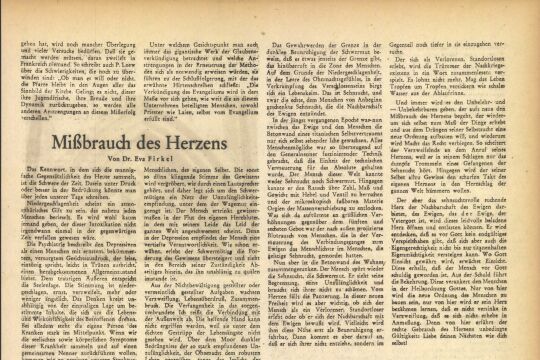Moderne Malerei und zeitgenössisches Schrifttum zeigen in namhaften Vertretern eine merkwürdige Gegensätzlichkeit. Während die bildende Kunst die Ansicht eines Dinges durch die Innenwelt des Malers filtert und den greifbaren Gegenstand so weitgehend umbildet, drückt »ich der Schriftsteller oft geradezu verblüffend „dinglich ' aus, um die innere Situation zu beschreiben. Die Bilder sind darum so eindrucksvoll, weil sie vom Schreiber wirklich gesehen und vom Leser eindeutig erkannt werden. Zwar könnten beide Kunstformen immer noch das gleiche aussagen, wenn sie die gleiche Innenansicht wiedergeben wollten. Man gewinnt aber den Eindrude, daß sich die Innenwelt der Maler mit einer anderen Schicht der menschlichen Wirklichkeit deckt und sie abbildet als die bestimmter, vielgelesener Schriftsteller. Die „Surrealisten“ scheinen vorwiegend in dem Netz des technisdien Weltbildes gefangen zu sein. Die gemalten Motive muten oft als eine Metamorphose des Entsetzens an, als der gezeichnete Test für das zwangsneurotische Verfallensein an die Maschine, die Zivilisation. Hier läuft der „Mechanismus" der Angst, der völligen Hoffnungslosigkeit, der Leugnung des Lebenssinnes noch auf voller Tourenzahl, das Gespenst der Technik als Maß aller Dinge rast durch die Lande, beziehungsweise die Kunstausstellungen.
Lassen wir jetzt einmal Proben aus den Werken gegenwärtig arbeitender Schriftsteller auf uns wirken. Wir wählen zunächst folgende Stelle:
„L’heure macabre. Tiefseestation.
Wenn es Abend wird in den großen Städten, sinkt unsere Wohnung wie eine Taucherglocke. Die Luft ist Grundwasser, dämmertrüb. Glutäugige Fische schwimmen langsam vorbei. Ihr läppischer Flossenschlag wischt über die Fenster. Weiche Mäuler schlucken unsere Augäpfel und lassen sie mit schaumigen Blasen hinaufwirbeln, ins Ungewisse. Unser Gesicht ist blind geworden, man sieht mit den Fingerspitzen, hört mit der Zunge, riecht mit dem Rückenmark und atmet mit dem Hirn. Dann erwacht der heimliche Sinn. Der Ur-Sinn. Der all» Sinne umschließt und keine Grenzen hat. Der Suaheli-Sinn. Ganz nah am Wahn-Sinn." (Carl Zuckmayer, „Des Teufels General", Bermann-Fisdier, 1947, Seite 129.)
Das ist freilich kein heiteres Bild, paßt nicht in die Träumerei des Spießers von der „Blauen Stunde“, es ist nüchtern trotz dichterischer Phantastik oder durch sie hindurch, nüchtern in der Handhabung der Dinge, wie der Mensch es wurde, der „mit allem Komfort der Neuzeit“ aufgewachsen ist; und doch ist er zugleich nachlässig im Gebrauch dieser Dinge, weil er trotz erworbenen Komforts das bequeme Leben verloren hat und irgendwo weiß, daß er es verlieren mußte: denn er ist seiner Bestimmung als Mensch untreu geworden.
Begeben wir uns weiter und hören wir einen anderen Autor. Er bringt ein Bild für die zum ersten Male bewußt gehörte eigene Stimme:
— lernte er seine Stimme kennen, die vollere Figur seines Atems, »ein Teil an der tönenden Welt.“ (Rudolf Brunngnaber, „Die Engel in Atlantis“, „Neues Österreich", 1947, Seite 32.)
Über die Freude aller Freuden, die am Geiste:
„Ein Glanz durchschoß ihn, bis in die letzten Falten dtr Seele hinab, eine so grelle und erschöpfende Verzückung, daß ihm war, als empfände er sie noch in den Gelenken und sähe sie vorm Aug’ flirren. Die Brandung eines übersinnlichen Rausches trug ihn hin, hin durch das persönliche Weltereignis: das Erlebnis des Geistes.“ (Ebenda Seite 50.) Die Ahnung davon, daß der Mensch nicht das Maß aller Dinge sei, wird auf einer unreifen Stufe so erlebt:
— — und diese jenseitige Harmonie rief wieder di» Vision einer Ur-Zahl herauf, die Annahme einer — Zentralgewalt. Hier aber brachen in Atlan» Brust die schlagenden Wetter auf. Die Vorstellung eines Meisters über der Welt floh er wie den Erstickungstod.“ (Ebenda Seite 122.)
Brunngrabers Sprache ist eigenwillig. In diesem Roman, der von dem sagenhaften Reich Atlantis berichtet, breitet der Verfasser seine unerschöpfliche Phantasie über Länder, Meere und Völker hin. Im Rahmen der vorgeschichtlich spielenden Handlung wird zutiefst Menschliches ausgesagt. Die tönende und plastische Sprache, das leuchtende, ja bisweilen grelle Kolorit zeichnen wirksam die Arena ab, in der der Massenmensch seine wilden Spiele treibt. Aber alle Maßlosigkeit bricht zusammen. Gott richtet, Gott rettet. Großartig ist die Gesamtschau, gültig sind die Einzelbilder. Gewiß liegt hier kein klassisches Ebenmaß vor, kein ruhiger Fluß sänf- tigt den Leser. Aber wessen Ohren die Alarmsirenen und den Bombenkrach überdauerten, wer gräßliche Bilder der Verwüstung schauen mußte, dessen Nerven sind auf stärkere Reize ansprechbar als die von Bürgern friedlicherer Zeiten. Hier ist das Leben ohne Retusche, aber doch ganz ge- zeichet. Die echt menschliche Sehnsucht nach Erlösung schlägt durch.
„Auf dem Turm aber stand über alle Maßen groß der strahlende Engel, und -wie seine gehobenen Schwingen an den Scheitel der herandonnernden Finsternis rührten, brach über ihm der Himmel auf.“ (Brunngraber, Seite 570.)
War im vorhergehenden gleichsam die große Seelenlandschaft ins Zeitbild verwoben, sehen wir im folgenden die psychologische Kleinmalerei. Jetzt wird die Innenschau beim einzelnen Menschen die Hauptsache, freilich ergeben sich auch hier mitunter allgemeine Bilder, doch mehr als Szenenbild für das Einzelschicksal.
Einer besonderen Form seelischen Lebens sind in jüngster Zeit meisterhafte Beschreibungen gewidmet worden. Wir meinen die Darstellung religiösen Lebens als Biographie, Roman oder' — was heute sehr beliebt ist — als weltanschauliches Gespräch.
Aus einer Studie über Therese von Lisieux greifen wir zwei Bilder heraus, die die Kunst einer Schriftstellerin von Rang dartun. Gerade an ihnen erweist sich, daß es mit dem künstlerischen Bild wie mit dem Witz ist, wie mit dem Geist überhaupt: Bild und Witz werden geschenkt, entspringen ungerufen und ungewollt dem Gegenstände, drängen sich auf. Dem Suchenden verfliegt das Bild, dem Geistreichelnden verschiebt es sich zum Zerrbild. Einem Talent wie dem der Ida Friederike Görres, von der Proben folgen werden, fließen die Bilder aus dem Heute zu. In ihrem Theresienbuche will si sagen, daß schon im Kinde keimhaft die ungewöhnliche Reinheit des Charakters zu erkennen war, und bringt dafür folgendes Bild:
„In der Kindheit wie im ganzen Leben dieses Mädchens prägt sich ein christlicher Grundbegriff nach dem anderen in der reinen Genauigkeit einer Schneeflocke unter der Lupe aus.“ (Ida Friederike Görres, „Das verborgene Antlitz“, Herder, Freiburg 1946, 2. Auflage, Seite 64.)
Die Schneeflocke unter der Lupe! Könnte man für die innere, ganz verborgene Schönheit des zarten kleinen Mädchens ein sinnfälligeres Bild wählen? Am Schlüsse, als Thereses besondere Berufung schon offenbar geworden, wenn sie sich auch von der üblichen „Leistung“ einer Nonne schwer abheben läßt, eben weil sie „nur" in der poesielosen Treue im kleinen liegt, „nur“ in der völligen Hingabe an Gott und „nur“ in der Preisgabe an die innere Verlassenheit, faßt I. F. Görres das mit abstrakten Begriffen nicht zu Erklärende in dieses Bild:
„Von Kindheit an hatte Therese von der ,Wüste' geträumt, in die Gott sie dereinst führen würde. Nun war sie in die Wüste eingegangen, und es ist das Gesetz der Wüste, das sie von jetzt an ergreift, prägt und schließlich verzehrt. Denn ihr wurde gewährt, was den Lieblingen Gottes geschenkt wird: dem erwählten Beruf ohne Rest und Vorbehalt zu verfallen, rein in ihm aufzugehen. Es ist schwer, ihren Weg durch das geheimnisreiche Land nachzuzeichnen, schwer wie das Unterfangen, den Schein einer Kerze im Mittagsglanze mit Stift und Farbe festzuhalten, so sehr löst sich der Umriß der wandernden Gestalt in der flimmernden Feme auf, im brennenden leeren Licht." (Ebenda Seite 206.)
Wir begnügen uns mit diesen Proben und wenden uns der eigentümlich dichten Bildsprache Elisabeth Langässer zu, die vielleicht einigen Lesern aus Lyriken bekannt ist. Wir entnehmen die Beispiele ihrem Bekehrungsroman, der den Kampf göttlicher und widergöttlicher Mächte unserer Tage, ja unserer eigenen Stunde, hinreißend schildert. Bild reiht sich an Bild, eine Überfülle, die der Leser kaum zu fassen vermag, aber von welcher Gestaltungskraft und Lebendigkeit!
„…vorher, als er von Jahr zu Jahr wie über verschränkte Hände von Engeln gegangen war; über Winde, die trugen, und Feuerflammen, die ihn brannten und doch nicht verbrannten." (Elisabeth Langässer, „Das unauslöschliche Siegel“, Claasen und Goverts, Hamburg 1946, Seite 36.)
„Die Trauer der beiden verstand »ich, wie regentragende Wirbelwinde in dem leeren, riesigen Raum der Nacht sich schon von weitem verstehen und nur darauf warten, einander zu finden, sich zu vermischen, herabzustürzen und den Boden, worüber sie lagerten, mit peitschenden Schlägen hinwegzuschwemmen. “ (Ebenda Seite 64.)
„Ihr Haupt war von den Schleiern der Mitschuld wie von zischenden Wolken bedeckt.“ (Ebenda Seit 101.)
„Gichtbrüchige, Lahme und Krüppel, die gleicherweise in ihren Krücken wie in den stählernen Fäden der Hoffnung und festen Zuversicht hingen. “ (Ebenda Seite 130.)
„Denn die Großen überschreiten ihr Blut wie Cäsar den Rubikon (Ebenda
Seite 345.)
Die letzten Proben stammen aus dem Religionsgespräch eines Künstlers, der mit dem expressionistischen Roman begonnen, sich am Geiste der Zeit gerieben und mit ihm gerungen hat, bis er den Geist in der Zeit wirklich gefunden und von ihm zu künden gedrängt wurde.
„Die Ewigkeit ist Zeitgenosse jeder Zeit und hält mit jeder Schritt.“ (Alfred Döblin, „Der unsterbliche Mensch“, Alber, Freiburg 1946, Seite 101.)
„Der Mensch steht an der Scheide zwischen Einzelwesen und Allwescn. Er bildet da» Gelenk zwischen Schöpfer und Schöpfung.“ (Ebenda Seite 121.)
„Wir bilden ein Scharnier zwischen Schöpfer und Schöpfung, aber das Scharnier ist rostig geworden.“ (Ebenda Seite 122.)
„Wir handeln natürlich nicht aus dem luftleeren Raum, wir haben unsere Konstitution und unsere Motive. Aber wir haben eine Waage, welche kein anderes Geschöpf besitzt. Die Motive sind Gewichte, die in unsere Waage fallen.
Wer oder was ist die Waage?
Ich bin es, ich, der die Motive in die Hand nimmt und ihre Schwere bestimmt." (Ebenda Seite 134.)
Die Sprache ist der Bildabglanz des Lebens. Wie weit dieser Abglanz wieder zumeigenen Sprachbild wird, hängt wohl von der Begabung des Dichters ab, aber auch davon, wieviel zu gestaltende Kraft im Leben selbst liegt. Es gibt gewiß oft verlogene Sprachbilderei. Allein, das Gefühl des Lesers erkennt sie sofort und verwirft sie, sofern er selbst unverbogen ist. Die angeführten Bilder wirken durch ihre Echtheit. Im Gegensatz zu den Surrealisten verschieben die Schriftsteller nicht bloß die Kulisse, wandeln die Konstruktion ab und ironisieren sich schließlich selbst, sondern sie schöpfen aus der Fülle des Lebendigen. Ihre letzte Weisheit heißt nicht Entsetzen oder ausweglose Angst; die Unzulänglichkeit und Brüchigkeit des Menschen erfüllen sie mit Trauer, führen zur Bescheidung, aber münden nicht in den Starrkrampf des Hoffnungslosen. Die Quelle alles Lebendigen ist schöpferischer Geist, der nicht nur das Gute will, sondern auch das Gute schafft. Die Hellsichtigkeit, mit der die Schreiber den Begriff aus dem Bilde treten sehen, und die Sicherheit der Zeichengebung weisen darauf hin, daß sie aus den Quellen der Lebenskraft schöpfen — und wir mit ihnen.
Die Bildsprache unserer bedeutenden Schriftsteller ist zweifello» ein sicheres Lebenszeichen der Gegenwart. Hier ist seichter Rationalismus überwunden, dann aber auch gedankenarme Rührseligkeit. Nicht die Zergliederung ist die Grundleistung dieser Werke, nicht die müde Auffaserung des Lebendigen, sondern gediegener Neubau. Die treffenden Bilder, die nahezu Unbeschreibliches blitzhaft erkennen lassen, können nur aus dem Glauben an Ordnung, Sinn, letztes Ziel erwachsen. Die Synthese wird nicht konstruiert, sondern aus der gelebten Synthese formt sich der Ausdruck. Hier herrschen rückhaltlose Weltoffenheit und Hingabe an Natur wie Geist. Die Ausdrucksgewalt gerade in den religiös fundierten Werken zeugt davon, wie stark die gläubige Persönlichkeit zu wirken vermag, die nicht nur „Weltanschauung vertritt", sondern die Torheit wagt, das Kapital an Glauben, Hoffnung und Liebe anscheinend nutzlos in die Welt zu verschwenden.
Auch wo die Bilder die Nachtseite des Lebens zeichnen, sind sie doch — als Bild — harmonisch. Sie weisen aus menschlicher Verworfenheit und Gemeinheit heraus, wenngleich sie Düsterkeit und Grauen ausstrahlen, auf das außermenschliche Wertganze hin. So steht das Böse niemals in sich als Macht über allen Mächten, sondern das Sinn-Bild veranschaulicht deutlich den Wertabfall.
„— — — ein schmerzlich wildes Gesicht. Er »chaute es an, und die arme Natur grüßte medusisch zurück.
Ihr Haupt, ein Spiegelbild jene» anderen, das den Leib der Vernunft regierte, war von den Schleiern der Mitschuld — —• — (Langässer, Seit 101.)
Man darf wohl annehmen, daß die Existenzphilosophie mit ihrer starken Herausstellung der wirklichen Probleme des Menschen die dichterische Form beeinflußt hat. Der Gedanke, das Dasein für etwa» Unfertige» zu halten, liegt in der Luft, seit die Existentialisten am Werke, beziehungsweise am Worte sind. Alle ist „Entwurf" und weist fortgesetzt über sich hinaus. Das Fließende, das keine feste Lebensvorlage zuläßt, begünstigt das Persönliche, das Subjektive. Für den Einfall, das Wirken der schöpferischen Phantasie, ist der Existentialismus zweifellos ein tüchtiger Schrittmacher. Das „Meinen“ ist keine Spielerei, sondern etwas Grundsätzliches geworden. Je „exi- stentialer“ nun die Meinung ist, um so plastischer wird das Bild. Ist im Bilde des Malers zwar der Entwurf „fertig" geworden, so bleibt das Bild des Dichters, ist es auch noch so bezeichnend, eben als Ausdruck einer inneren Beschaffenheit — Entwurf. Das Bild ist etwas „Hinausgeworfenes“. Hier aber scheiden sich Weg und Irrweg. Bei den Dichtern wirft der Glaube an den Sinn de Lebens da Bild aus und dieses wieder „wirft“ auf Grund seiner Überzeugungskraft den Betrachter „hinein“ in den Glauben an Zukunft und Ewigkeit. Damit übersteigt die Dichtung weit das Gegenwartsdenken. Die Wendigkeit, psychologische Sachverhalte auszudrücken, darf als Erbe des Existentialismus gelten. Doch ist der Blick de» Dichters anders gewendet als der des Philosophen. Möge es nicht zu kühn sein, wenn wir hoffen, daß die Sprachgewalt der Dichter, die von des Lebens Tiefe und Sinnerfülltheit beredt zu künden verstehen, stark genug sei, um den Menschen der Gegenwart aus der Erschöpfung herauszuführen, aus dem Ozean des Scheiterns und der „Daseinsangst“, damit er „wie ein Korken, den man unter Wasser gedrückt hat, an die Oberfläche komme und jeder neue Tag ihm zeige, in welcher Betäubung er gelebt hat“. (Döblin, „Unsterblicher Mensch", Schlußsatz.)