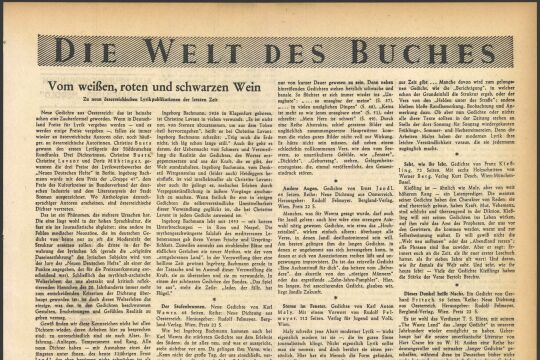„Die gestundete Zeit“ ist der Titel von Ingebong Bachmanns erstem Gedichtband, welcher sie im Jahre seines Erscheinens 1953 mit einem Schlag berühmt gemacht hatte. „Mit einer lässigen Selbstverständlichkeit“, schrieb damals Günter Blöcker, „hat diese junge Frau fleißige Epigonen und emsige Interessengemeinschaften überrundet.“ Geboren in Klagenfurt, studierte sie in Innsbruck, Graz und Wien zunächst Rechtswissenschaften, wandte sich aber dann ausschließlich der Philosophie zu. Vor allem interessierte sie der Wiener Kreis und Wittgenstein, ihre Dissertation schrieb sie über Martin Heidegger. Im Jahre 1952 stieß sie zu der bekannten Gruppe 47, deren Preis sie auch für ihren ersten Gedicbtiband erhielt. 1956 kam dann ihr zweiter heraus „Anrufung des Großen Bären“ und 1961 ihre gesammelte Prosa unter dem Titel eines dieser Prosastücke „Das dreißigste Jahr“. Daneben entstanden Texte, vor allem zu Musik von Hans Werner Henze, und Hörspiele, deren berühmtestes wohl „Der gute Gott von Manhattan“ geworden ist und, typisch österreichisch, in Österreich noch nirgends aufgeführt wurde. Reisen führten sie nach Amerika, wohin sie einer Einladung auf die Havard-Universität gefolgt war, nach der Schweiz und vor allem nach Italien, wo sie heute noch, nämlich in Rom, lebt. Daß sie schon durch eine Reihe namhafter Preise ausgezeichnet wurde, wundert niemanden mehr, der ihr Werk kennt. Im vergangenen November 1968 erhielt sie den österreichischen Staatspreis für Literatur. Bemerkenswert ist noch, daß sie als erste Dozentin auf dem neugeschaffenen Lehrstuhl für Poetik an der Universität Frankfurt am Main eine Vorlesungsreihe über Literatur und Dichtung hielt, in der sie Rechenschaft über die Möglichkeit dichterischer Existenz in der heutigen Zeit ablegt.
Vielleicht gelingt uns im Anschluß an diese Frankfurter Vorlesungen am ehesten der Einstieg in die Welt ihrer eigenen Dichtung. Fast alle Kritiker sprechen von der verhaltenen Nüchternheit, von der „hämmernden Eindringlichkeit“ und „zarten Unerbittlichkeit“ ihrer Verse. Trotz einer echt lyrisch empfundenen Bilderwelt und trotz der tiefen Melancholie, die alles durchdringt, ist der Klang eher hart, „getragen von einer radikalen Illusionslosigkeit“. Selten sind liedhafte Töne oder Strophen anzutreffen, meist sind es freie Rhythmen und freie Strophen, gemäß dem inneren Duktus oder Hiatus der Sprache. Dabei macht sie keinerlei Konzessionen an typisch moderne Zeiterscheinungen wie modisch vorgetragener, sich selbst beispielgebender Verzweiflung und Verfremdung, oder augenblicklich aktueller Techniken im Experimentieren mit der Sprache; sondern durchaus eigenständig, philosophisch geschult am Wort, gepaart mit hoher lyrischer Reizempfindlichkeit, „bin ich zu schreiben gewillt“, wie sie selbst unter dem bezeichnenden Titel
„Holz und Späne“ gesteht, „mit der Galle, solange sie noch bitter ist“. Ihre Verse entspringen daher auch nicht wort- und einfallsreichen Ampliflkationen, sondern bestehen auf einem auf Sparsamkeit und Treffsicherheit bedachten Reduktionsvorgang. „Poesie wie Brot?“ fragt sie in jenen Frankfurter Vorlesungen und antwortet: „Dieses Brot müßte zwischen den Zähnen knirschen und den Hunger wiedererwecken, ehe es ihn stellt Und diese Poesie wird scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht sein müssen, um an den Schlaf der Menschen rühren zu können.“
„Scharf von Erkenntnis“ und „bitter von Sehnsucht“. Versuchen wir einmal an Hand dieser beiden Charakteristiken ihre Welt aufzuschlüsseln, ohne damit den Anspruch zu erheben, auf eine letzte Klarheit hin alles beleuchten zu wollen, eher nur eine Tür aufzustoßen, in Räume, die es für jeden selbst zu durchforschen gilt.
Wir sind Schläfer, meint Bachmann, um unsere Welt nicht wahrnehmen zu müssen. Widersprüchlichste Werte halten sie besetzt, von denen wir uns fromm oder unfromm einschläfern lassen. Inniges Familienglück und hemmungslose Liber-tinage, Denken in politischen, sozialen, wissenschaftlichen und noch in ein paar anderen Kategorien, Glauben und Aberglauben, ein Spiel mit vorgefundenen Spielregeln, so lautet die GewissenseTforschung im „dreißigsten Jahr“. Und in den Frankfurter Vorlesungen zitiert sie Hofmannsthal zu ähnlichen Überlegungen:
„Es wurden mir im familiären und hausbackenen Gespräche alle die Urteile, die leichthin und mit schlafwandlerischer Sicherheit abgegeben zu werden pflegen, so bedenklich, daß ich aufhören mußte, an solchen Gesprächen irgend teilzunehmen... es wurde mir allmählich unmöglich, jene Worte in den Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen pflegen. Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte Geist, Seele oder Körper nur auszusprechen ... sie zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze.“
Alles zerfällt bei genauerem Hinsehen, wird verwischt und gestaltlos. „Nebelland hab' ich gesehen, Nebelherz hab' ich gegessen.“ Niemand hat den Mut zum eigenen Gesicht, zum eigenen Wort. Die Menschen „rotieren in einer funktionellen Nützlichkeitswelt, die ihre eigenen Ideen über ihre Existenz hat“, sie reden in einer „Gaunersprache“, in der alle Begriffe ihre lauwarme mittlere Temperatur besitzen. Die Erzählung „Ein Wildermuth“ weiß davon ein Lied zu singen. Auf mittlere Temperaturen muß die Wahrheit eingestellt sein, auf das mittlere Wort, „ein fortgesetztes billiges Übereinstimmen von Gegenstand und Wort, Gefühl und Wort, Tat und Wort, behäbiges, stumpfes Wort zum Übereinstimmen für jeden Gebrauch“. Sie aber träumt von einer Wahrheit, von der keiner träumt, ja, die keiner will, und ist mit dem Helden der Erzählung „Alles“ entsetzt, da er beobachten muß, wie schon von klein auf die Kinder gezwungen werden, diese Gaunersprache mitzureden.
Die Menschen, all die Freunde namens „Moll“, lassen keine Freiheit, jeden haben sie sich zurechtgelegt nach eigenem Gutdünken, binden ihn in eine Gestalt wie in eine Zwangsjacke und wollen, daß man ihren Jargon mitgebrauche. „Alles Leben ist abgewandert in Baukästen“, die „Reklame“ hämmert ständig: sei ohne Sorge, trag alles in die Traumwäscherei. Und rundherum dieser Moll, der Moll, der schmiert, Moll, der sich auskennt, Moll, der das Leben nimmt wie es ist, der sich kein X für ein U vormachen läßt, der die Weiber kennt, für den die Politik alles ist und dem die Politik gestohlen werden kann, der immer die passenden Sprichworte und Redensarten parat hat. „Wie vermeidet man Moll? Welchen Sinn hat es, dieser Hydra ein Haupt abzuschlagen, wenn ihr an Stelle eines jeden wieder zehn neue nachwachsen.“
Eines Tages, an dem man in sich „die Fähigkeit, sich zu erinnern entdeckt“, wird einem das alles entsetzlich klar, und die Konsequenz: „Der Tod im Gefolge des Lärms ist beschlossen von jeher.“ Und darauf gemünzt die Frage, die das Gedicht „Reklame“ abschließt: „Was aber geschieht, wenn Totenstille eintritt.“
Die Fähigkeit, sich zu erinnern, meint keinesfalls das sentimentale Wiederkäuen („schön war die Jugend, sie kommt nicht mehr“), meint nicht den „Weißt-dünoch-Moll“, sondern ein Innewerdein, ein auf den Grund hinabtauchen. Sie entdeckt im ersten Aitern amih alten, daß wir allp im dpr Falle sitzen, die uns das Leben — „so ist nun einmal das Leben“ — gestellt hat und versucht dann in einem leidenschaftlich anhebenden Zorn auszubrechen: „Dann spring noch einmal auf und reiß die alte schimpfliche Ordnung ein ... damit die Welt die Richtung ändert, endlich! Das Absolute lieben und den Aufbruch dahin.“ Doch — „keine neue Welt ohne neue Sprache“.
,,Scharf von Erkenntnis.“ Das ist das eine, was die Sprache verlangt. In den Frankfurter Vorlesungen gesteht Ingeborg Bachmann: daß keine neue Dichtung entsteht, wo keine wirkliche Problematik in dem Produzieren selbst vorliegt. Nur, wo vor jeder Erkenntnis ein neues Denken wie ein Sprengstoff den Anstoß gibt, wo ein „erkenntnishafter Ruck“ geschieht, entsteht mit der neuen Sprache erst eine neue dichterische Welt. Die Sprache selber, das Durchexperimentieren ihrer alten oder neuen Stilmittel, das Mitdiskutieren bei Problemen, die man uns aufschwätzen will, können .keine Erfahrung eintreiben, die man nie gehabt hat“. Sich auf „bloß formale Entdeckungen und Abenteuer“ einlassen, verurteilt dazu Epigonenhaftes zu schreiben, nur davon zu leben, was Joyce, Proust, Kafka oder Musü vorgelebt haben. „Weder zuerst noch zuletzt ästhetische Befriedigung, . sondern neue Fassungskraft.“ Unter Nichtachtung jeglichen Befehls oder Beifalls, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn nichts mehr geschieht von dem, was bloß geschieht, dann erst wird die Auszeichnung eines neuen glaubwürdigen Wortes verliehen. Ausbrechend aus dem Lärm der Gaunersprache, aus der funktionellen Nützlichkeitswelt, einmündend in die Stille der Erinnerung, getrieben vom Verlangen nach Absolutem, findet sich die Sprache, wie Rilke einmal sagt, die senkrecht steht auf der Richtung vergehender Herzen.
„In die Mulde meiner Stummheit leg ein Wort“, heißt es im Psalm 4. Wenn Bachmann die vier Gedachte Psalmen nennt, wird angedeutet, in welche Richtung das Wort zielt. Überhaupt finden sich viele Anspielungen an Worte und Bilder aus der Bibel. Doch man darf daraus keine vorschnellen Schlüsse ziehen. „Holz und Späne“ fliegen gerade und leider dort, wo solide Glaubhaftigkeit Pflicht wäre. Doch das funktionelle Nüteldchkeitsdenken, behäbiges Wort, verständlich für jeden Gebrauch, hat auch dort seinen foroiert zeitgemäßen Einzug gehalten: „Blätterverschleiß und Spruchbänder... bei Tag und bei Nacht bebt, unter diesen und jenen Sternen, die Maschine des Glaubens.“ „Gerettet ist keiner, getroffen sind viele, das öl will nicht brennen... — wo bleibt dein ewiges Licht?“ „Alles war gerichtet für die letzte Ölung. Das Sakrament kann nicht vollzogen werden.“ Die Bitterkeit der Galle steigt bis zum Herzen, das das Absolute sucht und eben dort in seinem ureigensten Bereich nicht finden kann, „Es ist unmöglich, hier nochmals zu leben“, schreibt sie von Rom. Die Drohung des Schicksalgerichtes, das in der „Anrufung des Großen Bären“ beschworen wird, könnte gerade über die Gläubigen hereinbrechen, ihr Kuhhandel mit Gott nichts helfen: „Zahlt in den Klingelbeutel und gebt dem blinden Mann ein gutes Wort, daß er den Bären an der Leine hält... s' könnt' sein, daß dieser Bär sich losreißt, nicht mehr droht und alle Zapfen jagt.“
„Seht zu, daß ihr wachbleibt!“ fordert das Gedicht „Holz und Späne“. Es gilt keine Zeit mehr zu verlieren, sie ist nur gestundet, „es kommen härtere Tage“. Fort also mit allen Mätzchen und dem opportunistischen Jargon aktueller Zeitgemäßheit, wenn es um das Wort geht, in der Sprache der Dichtung wie der Religion. Besser verstummen als unglaubwürdiges Geschwätz. Doch „wenn ich dann in diesem meinem Schweigen“, bekennt ein Vers aus ihren Übersetzungen der Gedichte Ungarettis, „ein Wort finde, ist es in mein Leben gegraben wie ein Abgrund“. Das ist glaubwürdiger, wenn man will auch christlicher, als die Pastorale Redseligkeit überhandnehmender Funktionäre, überzeugender als modernistische Fließen-legerpoesie.
„Komm, Gunst aus Laut und Hauch,
befestig diesen Mund,
wenn seine Schwachheit uns
entsetzt und hemmt.“
„Und bitter von Sehnsucht.“ Das Ist das andere, das, wie die Frankfurter Vorlesungen es nennen, einem moralischen Trieb nach Gesetzgebung der Sprache entspringt. „Die Stürze ins Schweigen“, die unser Jahrhundert kennzeichnen, dort, wo es die Fähigkeit der Er-dnnerung noch nicht verloren hat, sind daher von großer Wichtigkeit und wichtig vor allem „für die Wiederkehr aus dem Schweigen“, für die Möglichkeit einer neuen Sprache. „Das Vertrauensverhältnis zwischen Ich und Sprache und Ding ist schwer erschüttert.“ So wie die Wirklichkeit ständig einer neuen Definition harrt, weil sie gänzlich verformelt ist, so harrt sie auch einer neuen sittlichen Möglichkeit. „Wo, vor jeder formu* lierenden Moral, ein moralischer Trieb groß genug ist, eine neue sittliche Möglichkeit zu begreifen und zu entwerfen“, sich zu versuchen an einer neuen „Gesetzgebung“.
„Es streift die liebe unseres Herzens vergessene Sprache.“ Diese Vergeßlichkeit gebiert die bittere Sehnsucht. Das Hörspiel „Der gute Gott von Manhattan“ schreit diese Sehnsucht des moralischen Triebes der Liebe mit einer Bitterkeit hinaus, vor der man nicht gleichgültig bleiben kann, die erschüttert. Es gibt in dieser Dichtung Stellen, wo die Wörter den Atem anhalten, schrieb ein Kritiker. „Es wird mich das Schluchzen, das deinen Atemweg heraufkommt, bestürzen wie nichts sonst.“ Die Liebe ist das „fiebernde Ferment“, das Welt, Menschheit und Leben, „blühen gemacht vom Wort“,in ein neues Wunder taucht — tauchen könnte. Sie möchte auf den Grund des Abgrunds kommen, an ein Ende ohne Ende, in eine Gegenzeit ohne Zeit „Lieb mich, damit ich nacht schlafen und aufhören muß, dich zu lieben. Lieb mich, damit Einsehen ist.“ Und selbst im Tod will ich „dein verwestes Herz und die Handvoll Staub, die du später sein wirst, in meinen zerfallenen Mund nehmen und ersticken daran“, damit, selbst wenn das Nichts droht, die Liebe es teilt. Aber: „Reißen wir unsere Herzen aus für ein Nichts und um mit dieser jämmerlichen Klage die Leere zu füllen, und stirbst du dafür!... Wer hat geschrien, daß Gott tot ist?“ Deutlicher kann der Aufbruch aus Systemen und Gewohnheiten, aus Verbots- und Gebotstafeln, aus Staaten, Kirchen, Organisationen* Machtmitteln, Gaunersprachen, die die Wirklichkeit verfonmeln und verdinglichen, um sie verfügbar zu machen, alle errichtet „aus Furcht vor der Freiheit“, nicht geschildert werden; es geht um „die Kündigung der Geschichte, nicht zugunsten der Anarchie, sondern zugunsten einer Neugründung“.
Auch die Liebe wurde und wird leider unterrichtet durch zehntausend Bücher“, aufklärende, erotische und religiöse Literatur, doch nur wo ihre glühende Lava auf uns herabfährt, leuchten wir das Dunkel aus bis in die Fingerspitzen, dort werden die Augen Fenster in ein Land der Klarheiit, die Brust ein Meer, das auf den Grund zieht, die Hüften zu Landungsstegen für heimkommende Schiffe, und „innen sind Deine Knochen helle Flöten, aus denen ich Töne zaubern kann, die auch den Tod bestricken werden“, tönt es „Aus den Liedern auf der Flucht“. In dem unveröffentlichten Gedicht „Eine Art Verlust“ wird eine in der Liebe begründete Welt beschrieben, in ihr wird alles „für unsterblich erklärt“, das Alltäglichste wie Heiligste wird zum „Alarm für meine Freunde“. Doch der tragische Schluß: „nicht dich hab' ich verloren, sondern die Welt.“ Und wie Jennifer im „Guten Gott von Manhatten“ allein sterben muß, weil ihr.Jan de*.Verjauchung,, das Schiff dieser Zeit zu besteigen, nicht widerstanden und sie zurückgelassen hat, so schließt an jenes Hohelied der Liebe die entsetzliche Strophe: „und die mich schleiften, die Augen! Mund, der das Urteil sprach, Hand, die mich hinrichtete!“ Wir sitzen in der Falle eines Lebens, das eine „ungeheuerliche Kränkung“ ist. Darauf können nur noch Verse folgen, wie sie das univeröffentlichte Gedicht „Enigma“ in einer auf die Verzweiflung folgenden tödlichen Lethargie ausspricht: „Nichts mehr wird kommen.“ „Unsere Gottheit, die Geschichte, hat uns ein Grab bestellt, aus dem es keine Auferstehung gibt“, lautet die „Botschaft“ angesichts eines von Welt und Kirche verf ormelten Evangeliums. Soll das das Ende sein? Oder übertönt der Schrei „Reißen wir unsere Herzen aus für ein Nichts?“ nicht doch noch das Verstummen der an den Menschen gescheiterten „Undine“: „Beinahe verstummt, beinahe noch den Ruf hörend. Komm. Nur einmal. Komm.“ Die Fähigkeit, sich zu erinnern, gilt es jedenfalls zu entdecken, im „dreißigsten Jahr“, ganz gleich, wann es für das einzelne Leben schlägt, die gezählten Jahre sind nicht entscheidend. Das gelingt nur, wenn man die bislang nutelos verbrachten Stunden „zu sdch herbiegt, an ihnen riecht“. „Er kam in den Genuß der Zeit; ihr Geschmack war rein und gut. Er wollte sich ganz auf sich selbst zurückziehen.“ Er erkennt die Zeit als gestundet, wenn das Trommelfeuer zum Verstummen gebracht wird, das Trommelfeuer, das aus allen Rohren demokratisch nivellierender Institutionen weltlicher und geistlicher Provenienz auf die Menschen niederbrasselt. Dieser Beschuß ist unmenschlich! Menschlichkeit jedoch tönt anders. „Menschlichkeit: den Abstand wahren können. Haltet Abstand von mir, oder ich sterbe, oder ich morde, oder ich morde mich selber. Abstand, um Gottes wiHlen!“
Was alle hellsichtigen Geister, von der Jahrhundertwende bis in die Gegenwart, immer wieder verkündet halben, allerdings ohne ein Echo zu finden, hier steht es abermals, eindringlich, unzeitgemäß, undemokra-fftsch, unsozial, unchristllich, und wie man es sonst noch heißen mag, dafür aber menschlich: Menschlichkeit, den Abstand wahren können! Gerade und eben um Gottes willen.
Ingeborg Bachmann hat in den letzten Jahren diesen Abstand gehalten. Menschen und Worten gegenüber, auch in bezug auf ihre Dichtung. Man mag von einer Pause, von einer Krise, menschlich oder dichterisch oder sonst was sprechen, diese Kategorien treffen hier nicht zu. Jedenfalls entstand, neben den bereits zitierten unveröffentlichten Gedichten, ein Gedicht, das auch nur aus Vorlesungen der Dichterin bekannt wurde: „Böhmen liegt am Meer.“ Wie mit dem dreißigsten Jahr kein Datum gemeint war, so hier keine Geographie. Das Gedicht ist von einer Gelöstheit, ja Heiterkeit, die genauso und eigentlich „keryg-matisch“ ist wie der Vers von dem aus dem Schweigen aufsteigenden Wort. „Ich will zugrunde gehen, Zu-grund — das heißt zum Meer. Dort finde ich Böhmen wieder. Zugrundgerichtet, wach ich ruhig auf. Von Grund auf weiß ich jetzt und ich bin univerloren...
Ich grenz noch an ein Wort und an
ein andres Land, Ich grenz, wie wenig auch, an alles
immer mehr.
Ein Böhme, ein Vagant, der nichts
hat, den nichts hält,
begabt nur noch vom Meer...“
Im Verlag Piper Co., München (Bücher der Neunzehn), ist ein das gesamte Werk von Ingeborg Bachmann umreißender Band erschienen. Er enthält ausgewählte Gedichte, vier Erzählungen, das Hörspiel „Der gute Gott von Manhattan“ sowie bisher noch nicht veröffentlichte oder schwer zugängliche Texte, u. o. auch zwei Abschnitte aus der Vorlesung, die Ingeborg Bachmann als Gastdozentin auf dem Frankfurter Lehrstuhl für Poetik gehalten hat.