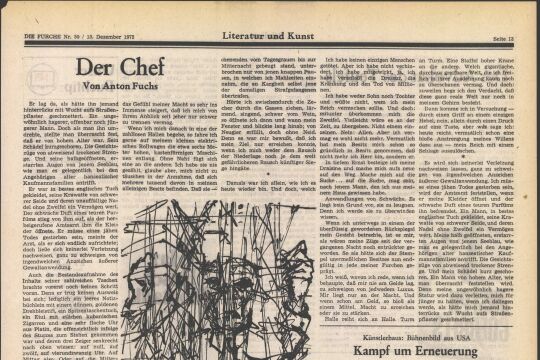Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Begegnung
Ich bin ihr vor nicht allzulanger Zeit begegnet — es könnte gestern gewesen sein, so sehr hielt die Betroffenheit an. Wir saßen, allein im Wohnraum, einander gegenüber, aber ich war nur einer von Tausenden, die ihr Gesicht auf dem Bildschirm wahrnahmen und ihre Stimme aus dem Lautsprecher hörten. Auf die „scheue Poetin“ gefaßt — der grausame Bericht über ihre Poetikvorlesung damals in Frankfurt vor einer enttäuschten, weil auf flinke Rhetorik und handfestes Wissen eingestellten Studentenschaft war noch in Erinnerung —, wirkte sie doch ganz anders, bestimmter, selbstbewußter. Vielleicht fühlte sie sich so wenig gehemmt, weil sie in ihren vier Wänden zu einem unsichtbaren Publikum sprechen konnte. Ihr Gesicht ist nicht charmant in dem hierorts so geläufigen Sinn; diese schale, abgegriffene Vokabel für „unverbindlich liebenswürdig“ zahlt schon zur „Gaunersprache“, wie Ingeborg Bachmann die vorgeprägte leere Gewohnheitasprache benennt. Das Gesicht ist eher streng und ernst, ein zarter Ernst, der nur selten einem Lächeln weicht. Das Erlebnis war, Ingeborg Bachmann zwischen den Wänden der Sprache und des Sprechens denken, nachdenken zu sehen, diese Mischung von Intellekt und Sensibilität auf dem Gesicht einer Frau, von der Kamera in der Großaufnahme überdeutlich sichtbar gemacht. Dazu Kam die Verfertigung der Gedanken, dieses mühsame Heraufholen von Wörtern wie aus einem tiefen Schacht, dieses Ringen mit jedem Wort, als bestünden Zweifel an seiner Tragfähigkeit, seiner Aussagekraft, unterbrochen von langen Pausen zwischen Worten, Sätzen — und wieder fielen einem die unduldsamen Studenten von Frankfurt ein.
Über die Aufgabe des Schriftstellers befragt, stand sie zurückhaltend, fast widerwillig Antwort. Sie wisse nichts über ihre „Aufgabe“. Über Dichtung zu sprechen sei ihr sogar unheimlich. Vielleicht gibt es da nur die zwei, drei alten Forderungen: Intellektuelle Redlichkeit. Nicht mehr zu sehen, als man zu sagen hat. Sich nicht übernehmen mit Scheinproblemen, die man sich nur äußerlich angeeignet hat. Echte Probleme sind indiskutabel, die einzige Antwort darauf ist das Werk.
So wurden denn auch in dem „Porträt“ die Überlegungen der Dichterin von Bilderfolgen und Rezitationen aus ihrer Lyrik, Dramatik, Prosa umrahmt. Sie sollten auf ihr sprachliches Gewissen verweisen, auf ihre scharfe Intelligenz, der das Übersetzen des Sprachlosen in Sprache gelingt, auf ihre Empfindsamkeit des Schreibens, in deren Zeichen die Beschreibung der Welt, der Wirklichkeit um so präziser ausfällt, je dichterischer das Wort ist. Ausgespart blieben dabei (für die Hinhörenden, voran in den Schulen, sinnfälliger, faßlicher) alles Dunkle, Mythische aus ihrer Bilder- und Zeichensprache, ihre oft bittere, fast vernichtende Schwermut über die Gefährdung des Menschendaseins in jedem Augenblick, ihre grüblerischen Zweifel an der „Wißbarkeit“ der Welt.
Selbst der leise Humor in den Erinnerungen an Kindheit und Jugend in der Heimatstadt Klagenfurt wirkt zuweilen leicht bitter:
In dem Mietshaus in der Durchlaßstraße müssen die Kinder die Schuhe ausziehen und in Strümpfen spielen, weil sie über dem Hausherrn wohnen. Sie dürfen nur flüstern und werden sich das Flüstern nicht mehr abgewöhnen in diesem Leben. —i Zwischen dem Vorwurf, zu laut zu sein, und dem Vorwurf, zu leise zu sein, richten sie sich schweigend ein.
So geht ihre Jugend hin mit Armut, Spielen, Krieg. Und wenn sie eines Tages, groß geworden, aufgefordert werden, „ins Leben zu treten“, dann gehen sie fort, die Hände in ausgefransten Tascher und mit einem Pfiff, der sie selbet warnen soll.
Einmal nach Jahren besucht sie die Stadt ihrer Jugend und weiß arr Ende im Erinnern, vor der Abreise, daß alles war, wie es war, daß allei ist, wie es ist, und verzichtet, einer Grund zu suchen für alles... Nichti rührt dir ans Herz. Kein Gefällt früher Zeiten, kein erstandene: Haus. — Dos Wenigste ist da, um um einzuleuchten, und die Jugend gehört nicht dazu, auch die Stadt nicht, ir, der sie stattgehabt hat.
Was bleibt, ist das rührende Gedicht „Das Spiel ist aus“ mit der Anfangszeile
Mein lieber Bruder, wann bauen wir uns ein Floß und fahren den Himmel hinunter? und der elegischen Endstrophe Wir müssen schlafen gehen, Liebster, das Spiel ist aus. Auf Zehenspitzen. Die weißen
Hemden bauschen. Vater und Mutter sagen, es geistert im Haus, WCnfl wir den Atem tauschen.
Von nun an heißt es absagen, aufbrechen, fortgehen, den Weg erkunden zum andern, denn das hieße: sich selber finden. Nun heißt es: ausbrechen aus dem Halb-Geordneten, Halb-Wahren, aus der „ungeheuerlichen Kränkung, die das Leben ist“, ausbrechen und unterwegs sein zum Absoluten, zum Unbedingten, zum Äußersten, wo das wieder glaubwürdige Wort so träfe, daß es retten, daß in reiner Kunst eine neue (bewältigte) Wirklichkeit entstehen würde. Wagen, auch wenn niemandem der Ausbruch gelingt und keinem die Verwandlung. Sieh dich nicht um. Schnür deinen Schuh. Jag die Hunde zurück. Wirf die Fische ins Meer. Lösch die Lupinen! heißt es in einem der frühesten Gedichte („Die gestundete Zeit“), das mit dem wuchtig-verkündenden Es kommen härtere Tage beginnt und endet.
Seit Jahren lebt Ingeborg Bachmann in Rom („eine selbstverständliche Stadt, kein Italien-Erlebnis'). In ihrem römischen Arbeitszimmer aufgesucht, sagte sie:
Ich bin besser in Wien, weil ich in Rom bin. Manchmal komme ich nach
Wien, um nachzusehen, wieweit sich Wien verändert hat und wieweit es nicht mehr übereinstimmt.
Unmöglich, diese Sätze zu hören, ohne die Gedankenverbindung zu jenem ungeheuerlichen Kurzkapitel aus der Erzählung „Das dreißigste Jahr“ des gleichnamigen Bandes herzustellen, in dem eine kaum zu übertreffende, schonungslose Szenerie Wiens aufgebaut wird. Daraus zitiert:
Stadt ohne Gewähr!
Hofrätüches und Abgetretenes in Kanzleien. Nie ein hartes Wort in den Vorzimmern, immer ein kränkendes. (Hinhalten, nicht abweisen.)
Die üble Nachrede ist mit dem weichen Herzen im Vertrag. — Aber einige hatten ein Herz mit einem wilden, flachsigen Muskel und eine Rede, die in Rom gegolten hätte. Sie waren feindselig, verhaßt und einsam. Sie dachten genau, hielten sich rein und ließen die Quallen unter sich.
Komödiantenstadt! — Stadt der Witzmacher, der Speichellecker, der Spießgesellen. (Für eine Pointe wird eine Wahrheit geopfert, und gut gesagt ist halb gelogen.)
Oder noch unbarmherziger in dem (doch) autobiographischen Roman „Malina“, Worte, die von dem österreichischen Weltverneiner Thomas Berhard herrühren könnten:
... weil hier keine verschonte Insel ist, sondern an jeder Stelle Untergang ist, es ist alles Untergang, mit dem Untergang der heutigen und morgigen Imperien vor Augen.
Erst in diesem Zusammenhang erhält ihr Satz über Rom und Wier seine rechte Bedeutung.
Irrig die Meinung, sie scheue di Auseinandersetzung mit der Zeil und sperre sich gegen das Aktuelle Nur, daß sie auch das Vordergründige nie ohne das Hintergründig seilen kann. Wenn sie schildert, wai sie in ihrer Lieblingsstadt Rom gesehen und gehört hat, dann findet sie ihren ureigenen Ton:
Ich sah auf dem Campo de Fiori daß Giordano Bruno noch immer verbrannt wird. Jeden Sonnabend wenn um ihn herum die Buden abgerissen werden und nur noch die Blumenfrauen zurückbleiben, wem der Gestank von Fisch, Chlor unc verfaultem Obst auf dem Platz verebbt, tragen die Männer den Abfall der geblieben ist, nachdem alles verfeilscht wurde, vor seinen Augen zusammen und zünden den Haufen an Wieder steigt Rauch auf, und du Flammen drehen sich in der Luft Eine Frau schreit, und die anderer schreien mit. Weil die Flammer farblos sind in dem starken Licht sieht man nicht, wie weit sie reicher, und wonach sie schlagen. Aber dei Mann auf dem Sockel weiß es unc widerruft dennoch nicht.
In Rom freilich habe ich gehört daß mancher das Brot hat, aber nicht die Zähne, und daß die Fliegen au] die mageren Pferde gehen. Daß den einen viel und dem anderen nichti geschenkt ist; daß wer zuviel zieht zerreißt und nur eine feste Säule dat Haus hundert Jahre aufrecht hält Ich hörte, daß es in der Welt mehi Zeit als Verstand gibt, aber daß um die Augen zum Sehen gegeben sind
Man glaubte, der Dichterin die Distanz „zu allem Politischen, Weltverändernden, Soziologischen“ vorhalten zu müssen, und übersah, daß die vor ihr verkündeten moralisch-politischen Botschaften von ganz änderet Art sein müsssn als die herkömmlichen, einem befristeten Stück Aktualität zugewandten. Wenn sie einen „Peldherrn“ zur Abkehr vor seinem Beruf (jenem „Geschäft im Namen der Ehre“) bewegen will wenn sie dem Krie? den Kampf ansagt, dann stiftet sie einen Orden im Namen der Hoffnung und der Rebellion der Herzen, einen Orden, der verliehen wird für die Flucht vor den Fahnen I für die Tapferkeit vor dem Freund I für den Verrat unwürdiger Geheimnisst I und für die Nichtachtung I jeglichen Befehls.
Und mit einem Male sind alle Kriegsschauplätze und alle Revolter dieser Erde in dem Gedicht, das sich doch über dem endlosen Staub des Wirklichen zu erheben schien. Solche ihre Worte seien anarchisch? Anläßlich der Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden sagte sie einmal: Alles, was wir tun, denken unc fühlen, sei Grenzfall, wenn wir bis zum äußersten gingen. Aber: Wii müssen in der Ordnung bleiben Einen Austritt aus der Gesellschaft gibt es nicht. Doch die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.
Dankbar sei erkannt, wie sehr sich aus der Begegnung mit dem Werk und der Persönlichkeit Ingeborg Bachmanns Einverständnis und Bezauberung einstellten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!