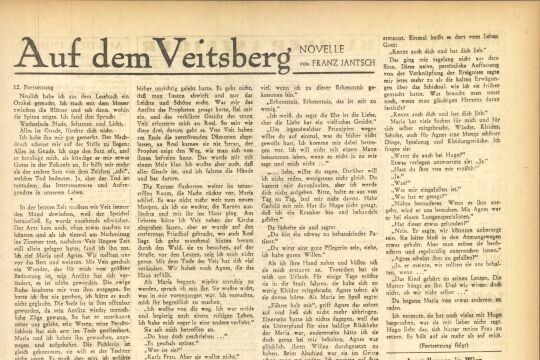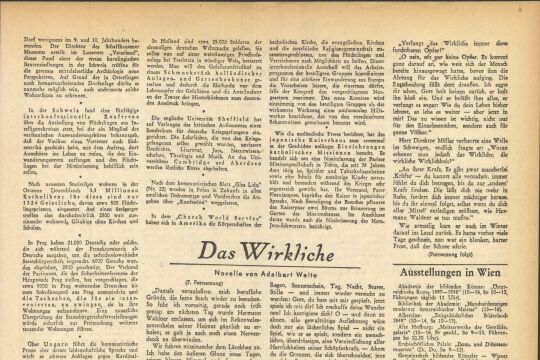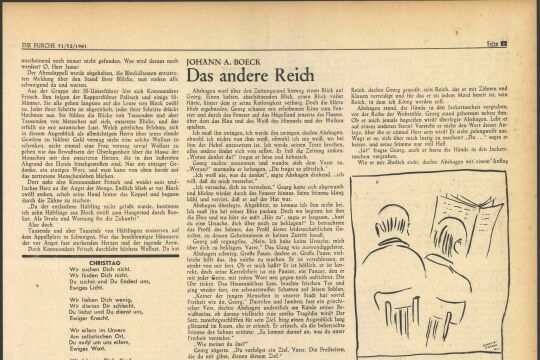Als Major Scobie nadi dem Besuch beim Arzt wieder in seinem Wagen saß und das winzige Päckchen mit den Pillen auf dem Sitz neben sich liegen hatte, dachte er: „Jetzt brauche ich nur mehr den Zeitpunkt meines Selbstmordes zu wählen.“ Es dauerte noch eine geraume Weile, ehe er den Motor anließ. Ein Gefühl der Ehrfurcht war über ihn gekommen, so als ob der Arzt tatsächlich sein Todesurteil gesprochen hätte. Seine Augen waren auf das saubere, runde Stückchen Siegellack geheftet, mit dem das Päckchen verschlossen war, und er betrachtete es wie eine frisch verheilte Wunde. Er überlegte: „Ich muß immer noch vorsichtig sein, unerhört vorsichtig. Wenn möglich, soll kein Mensch auch nur den leisesten Verdacht schöpfen.“ Es handelte sich nicht nur um seine Lebensversicherung; auch das künftige Glück anderer Menschen mußte er in Erwägung ziehen. Einen Selbstmord vergessen sie nicht so leicht wie den Tod eines alternden Mannes durch Angina pectoris.
Er erbrach die Packung und las sorgfältig die Gebrauchsanweisung. Er hatte keine Ahnung, wie groß die tödliche Dosis war, aber wenn er das Zehnfache der angegebenen Dosierung nahm, dann würde er sicher den gewünschten Erfolg kaben. Das bedeutete also, daß er an neun Abenden jedesmal eine Tablette entfernen und sie heimlich aufbewahren mußte, um sie für den zehnten Abend bereit zu haben. Weitere Hinweise auf sein Leiden mußten in sein Tagebuch eingestreut werden, das er bis zum letzten Tag, dem 12. November, fortsetzen mußte. Für die darauffolgende Woche würde er Verabredungen treffen müssen. Nicht die leiseste Andeutung einer Abschiedsstimmung durfte seinem Gehaben anzumerken sein. Dies war das schlimmste Verbrechen, das ein Katholik begehen konnte — es mußte ein schlechthin vollendetes Verbrechen sein.
Zuerst der Kommandant... Auf dem Wege zur Polizeidirektion hielt er an der Kirche. Der feierliche Ernst seines Verbrechens legte sich fast wie eine Glücksstimmung auf seine Sinne; endlich galt es zu handeln; schon allzu lange hatte er unentschlossen geschwankt und ungeschickt umhergetappt. Er barg das Päckchen, das seinen Tod enthielt, sorgfältig in seiner Tasche und trat in das Gotteshaus. Eine uralte Negerin entzündete gerade vor der Marienstatue eine Kerze; eine zweite saß in einer Bank, ihre Einkaufstasche neben sich, und starrte mit gefalteten Händen zum Altar empor; sonst war die Kirche menschenleer. Scobie ließ sich im hintersten Kirchenstuhl nieder; er fühlte kein Verlangen, zu beten — was hätte es für einen Sinn gehabt? Als Katholik wußte er, woran er war: solange er sich im Zustand der Todsünde befand, war jedes Gebet wirkungslos, und so betrachtete er die beiden andern mit wehmütigem Neid. Sie waren noch Bürger jenes Landes, das er verlassen hatte. Die Liebe zu den Menschen hatte ihm dies angetan: sie hatte ihm die Liebe zur Ewigkeit geraubt. Es hatte keinen Zweck, sich einreden zu wollen — wie man das als junger Mann vielleicht tun würde —, daß sich der Preis lohne.
• Wenn er schon nicht beten könne, so könne er zumindest sprechen, überlegte er an seinem Platz ganz hinten, möglichst weit vom Gekreuzigten. Er sagte: „O Gott, ich allein trage alle Schuld, weil ich von allem Anfang an wußte, was auf dem Spiele stand. Ich habe lieber Dir Schmerz bereitet als diesem Mädchen Helen, zu dem ich in unerlaubte Beziehungen trat, oder meiner Frau, weil ich nicht sehen, sondern mir nur vorstellen kann, wie Du leidest. Aber es gibt Grenzen für das, was ich Dir antun kann — oder ihnen. Ich kann keine von beiden verlassen, solange ich lebe, aber ich kann sterben und mich aus ihrem Lebensweg forträumen. Sie kranken an mir, und ich kann ihnen Heilung verschaffen. Und auch Du, o Herr, auch Du krankst an mir. Ich kann Dich nicht Monat für Monat weiter beleidigen. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, daß ich zu Weihnachten, an Deinem Geburtsfeste, vor den Altar hintreten und Deinen Leib und Dein Blut um einer Lüge willen in mich aufnehmen soll. Das kann ich nicht. Für Dich wird es besser sein, mich ein für allemal zu verlieren. Ich weiß, was ich tue. Ich flehe nicht um Barmherzigkeit. Ich gehe daran, .mich selbst der Verdammnis zu übergeben, was immer das heißen mag. Ich habe Sehnsucht nach Frieden gehabt, und ich werde niemals mehr Frieden kennen. Du aber wirst Frieden haben, wenn ich aus Deinem Angesicht entfernt sein werde. Dann wird es zwecklos sein, den Boden aufzufegen, um mich zu finden oder über den Bergen nach mir zu suchen. Du, o Herr, wirst mich für alle Ewigkeit vergessen können.“ Seine Hand schloß sich fest um die kleine Schachtel in seiner Tasche; es war wie ein Gelöbnis.
Niemand kann auf die Dauer einen Monolog führen, immer wird sich alsbald eine zweite Stimme erheben und aus dem Monolog ein Zwiegespräch machen. So kam es, daß auch er jetzt die andere Stimme nicht unterdrücken konnte; sie kam aus der Tiefe seines Leibes, als ob das Sakrament, das dort zu seinem Untergang Einkehr gehalten hatte, zu sprechen anhebe: „Du behauptest, mich zu lieben, und doch willst du mir dies antun — mich deiner in alle Ewigkeit berauben. Ich erschuf dich mit Liebe. Ich weinte deine Tränen. Ich bewahrte dich vor mehr Unheil, als du jemals erfahren wirst. Ich pflanzte diese Sehnsucht nach Frieden nur deshalb in dein Herz, damit ich eines Tages diesen deinen Wunsch erfüllen und dein Glück erleben könne. Und jetzt stößt du mich von dir, entfernst du dich aus meiner Reichweite. Wenn wir uns miteinander unterhalten, dann gibt es keine Großbuchstaben, die uns trennen. Wenn du zu mir sprichst, bin ich nicht ,Du' für dich, sondern schlicht und einfach ,du“. Ich bin demütig wie irgendein Bettler. Kannst du mir nicht vertrauen, wie du einem treuen Hund vertrauen würdest? Zweitausend Jahre habe ich dir die Treue gehalten. Du brauchst nichts weiter zu tun, als an der Sakristeiglocke zu ziehen, in den Beichtstuhl zu treten und zu beichten... Die Reue ist ja schon da; sie zerrt mit Macht an deinem Herzen. Es gebricht dir nicht an Reue, nur an ein paar einfachen Taten, zur Baracke hinaufzugehen und für immer Lebewohl zu sagen. Oder, wenn du schon mußt, dann verschließe dich mir auch weiterhin, aber ohne jede Falschheit. Dann geh nach Hause, sag Lebewohl zu deiner Frau und lebe mit deiner Geliebten. Wenn du das tust, dann wirst du früher oder später zu mir zurückfinden. Eine von beiden wird zu leiden haben, aber traust du mir nicht zu, daß ich allzu großes Leid ersparen werde?“
Die Stimme in seinem Innern verstummte, und seine eigene antwortete voll Verzweiflung: „Nein. Ich traue es Dir nicht zu. Ich liebe Dich, aber Vertrauen habe ich nie zu Dir gehabt. Wenn Du mich erschaffen hast, dann hast Du auch dieses Verantwortungsgefühl erschaffen, das ich zeitlebens gleich einem Sack voll Steinen mit mir herumgeschleppt habe. Ich bin nicht umsonst Polizist —, verantwortlich für Ordnung und Gerechtigkeit. Für einen Menschen meines Schlages gab es keinen andern Beruf. Ich kann meine Verantwortung nicht auf Dich abwälzen. Denn könnte ich das, dann wäre ich ein anderer Mensch. Ich kann nicht eine der beiden Frauen leiden lassen, um mich selbst zu retten. Ich bin verantwortlich für beide, und ich werde mit diesem Problem auf die einzig mögliche Art fertig werden. Der Tod eines kranken Menschen wird für sie nur eine kurze Zeit des Schmerzes bedeuten! denn jeder muß einmal sterben. Mit dem Tod finden wir uns alle ab; womit wir uns nicht abfinden, das ist das Leben.“
Die Stimme antwortete ihm: „Solange du lebst, gebe ich die Hoffnung nicht auf. Der Mensch kennt nicht die verzweifelte Hoffnung Gottes. Kannst du nicht so weiterleben, wie du es jetzt tust?“ flehte die Stimme, die gleich einem Händler auf dem Markt mit jedem Mal einen geringeren Preis forderte. ,,Es gjbt viel schlimmere Taten“, erklärte sie.
„Nein, nein“, war seine Antwort, „das ist unmöglich. Ich liebe Dich und ich kann Dich nicht länger an deinem eigenen Altar beleidigen. Herrgott, verstehst Du nicht, daß es da keinen Ausweg gibt?“ fragte er, während er das Päckchen in seiner Tasche fest umklammerte. Er erhob sich, wandte dem Altar den Rücken zu und trat ins Freie. Erst als er im Rückblickspiegel sein Gesicht sah, merkte er, daß in seinen Augen die unterdrückten Tränen brannten. Er fuhr weiter zur Polizeidirektion und zu seinem Vorgesetzten.
Der Tag, den Major Scobie als seinen letzten festgesetzt hatte, ging zur Neige. Es kam die Zeit zum Schlafengehen, und es kostete ihn große Überwindung, seine Frau gehen zu lassen; denn wenn sie einmal gegangen war, blieb ihm nichts mehr zu tun, als zu sterben. Er wußte nicht, wie er sie noch länger festhalten könnte; sie hatten alle Gesprächsthemen, an denen sie beide interessiert waren, bereits erschöpft. Er sagte: „Ich bleibe noch eine Weile sitzen. Vielleicht kommt mir der Schlaf, wenn ich noch eine halbe Stunde aufbleibe. Ich nehme die Pillen nicht gern, wenn es sich irgendwie vermeiden läßt.“
„Ich bin aber vom Baden sehr müde. Ieh muß schlafen gehen.“
Wenn sie gegangen ist, überlegte er, werde ich für immer allein sein. Sein Herz pochte heftig, und plötzliche Übelkeit packte ihn, als ihm die grausige Unwirklichkeit seiner Lage zum Bewußtsein kam. „Ich kann nicht glauben, daß ich es tun werde“, sagte er sich. „Gleich werde ich aufstehen und zu Bett gehen, und das Leben wird von neuem beginnen. Nichts, niemand kann mich zwingen, zu sterben.“ Obgleich diß Stimme aus seinem Innern nicht mehr sprach, war es ihm, als ob Finger, flehentliche Finger ihn berührten, ihm ihre stumme Botschaft einer quälenden Angst übermittelten und ihn zurückzuhalten suchten ...
„Was ist denn, Ticki? Du siehst leidend aus. Komm, geh ins Bett.“
„Ich könnte ja nicht schlafen“, erwiderte er starrsinnig.
„Kann ich dir nicht helfen?“ fragte seine Frau. „Mein Lieber, ich würde alles tun...“ Ihre Liebe war wie ein Todesurteil. Er sprach unhörbar zu den unruhig, verzweifelt nach ihm tastenden Fingern: „O Gott, es wäre besser, wenn ein Mühlstein. .. Ich kann ihr nicht weh tun oder der andern weh tun, und ich kann auch dir nicht mehr länger wehtun. O Gott, wenn du mich so liebst, wie ich weiß, daß du mich liebst, dann hilf mir doch dabei, Dich zu verlassen. Lieber Gott, vergiß mich!“ Aber die zarten Finger ließen in ihrem schwachen Druck nicht nach. Nie zuvor hatte er die Kraftlosigkeit Gottes so klar erkannt.
„Nichts kannst du für mich tun“, sagte er zu seiner Frau. „Ich darf dich nicht so lange wachhalten.“
„Bleib nicht zu lange auf“, sagte sie. „Vielleicht brauchst du deine Pillen heute gar nicht.“
Er blickte ihr nach, während sie nach oben ging; eine Eidechse saß regungslos auf der Wand. Ehe Louise die Stiege erreicht hatte, rief er sie zurück: „Sag mir gute Nacht, Louise, bevor du gehst, später schläfst du vielleicht schon.“
Sie küßte ihn flüchtig auf die Stirn, und er liebkoste scheinbar gedankenlos ihre Hand. An diesem letzten Abend durfte nichts Auffallendes geschehen, und nichts, woran sie sich mit Bedauern erinnern würde. „Gute Nacht, Louise, du weißt, ich hab dich lieb“, sagte er mit gesuchter Leichtigkeit.
„Natürlich, und ich habe dich lieb.“
„Ja. Gute Nacht, Louise.“
„Gute Nacht, Ticki.“ Mehr brachte er nicht über die Lippen, wenn er sich nicht verraten wollte.
Sobald er hörte, wie sich die Schlafzimmertür schloß, holte er die Zigarettenschachtel hervor, in der er die zehn Tabletten aufbewahrt hatte. Um ganz sicher zu gehen, fügte er noch zwei hinzu — eine Überschreitung der vor? geschriebenen Dosierung um ganze zwej Tabletten in zehn Tagen würde wohl kaum Verdacht erregen. Hierauf trank er ein großes Glas Whisky aus und saß ganz still und wartete, bis ihm der Mut zum letzten Schritt kommen würde; die Tabletten lagen wie Samenkörner in seiner hohlen Hand. Jetzt bin ich ganz allein, dachte er, das ist der Gefrierpunkt.
Aber das war eine Täuschung. Auch die Einsamkeit hat eine Stimme. Sie sprach zu ihm: „Wirf diese Tabletten weg! Nie wieder wird es dir gelingen, genug davon zusammenzubringen. Du bist gerettet! Gib das Theaterspielen auf! Geh hinauf ins Schlafzimmer und schlafe dich gründlich aus. Am Morgen wird dich dein Boy wecken, du wirst zur Polizeidirektion fahren und dort deiner gewohnten Arbeit nachgehen.“ Die Stimme verweilte bei dem Wort „gewohnt“, wie sie bei den Worten „glücklich“ oder „friedlich“ hätte verweilen können.
„Nein, nein!“ rief Scobie mit lauter Stimme. Er schob die Tabletten in den Mund, je sechs auf einmal, und spülte sie mit zwei Zügen aus dem Wasserglas hinunter. Dann öffnete er sein Tagebuch und schrieb: „12. November. Sprach bei H. R. vor; war nicht zu Hause. Tempera tur um 14 Uhr...' Damit brach er jäh ab, als ob er in diesem Augenblick vom letzten Schmerzanfall gepackt worden wäre. Danach saß er geraume Zeit kerzengerade am Tisch und wartete, wie es ihm schien, sehr lange auf irgendein Anzeichen des nahenden Todes; er halte keine klare Vorstellung, in welcher Gestalt er kommen werde. Er versuchte zu beten, aber das „Gegrüßt seist du, Maria“ war seinem Gedächtnis ent schwunden; nur das dumpfe Pochen seines Herzens verspürte er gleich einer Turmuhr, die schwer die Stunde schlägt. Dann versuchte er es mit dem Reuegebet, aber als er zu den Worten kam, mit denen er Gott um Verzeihung bitten sollte, da bildete sich plötzlich über der Tür eine Wolke, die herabgeschwebt kam und das ganze Zimmer einhüllte, und er konnte sich nicht mehr entsinnen, wofür er um Verzeihung zu bitten hätte. Mit beiden Händen mußte er sich stützen, um sich aufrechtzuhalten. Irgend-wo in weiter Ferne vermeinte er plötzlich Schmerzensschreie zu hören. „Ein Gewitter!“ rief er, während die Wolke wuchs,- er wollte sich erheben und das Fenster schließen. „Ali“, rief er, „Ali!“ Er hatte das Empfinden, daß draußen jemand nach ihm suche, ihn rufe, und machte eine letzte Anstrengung, dem andern zu sagen, wo er sei. Er raffte sich wieder auf und lauschte, vernahm aber nur das Hämmern seines Herzens. Er hatte eine Botschaft zu übergeben, doch die Finsternis und das Gewitter jagten ihn in seine Brust zurück; und draußen vor dem Haus, außerhalb der Welt, die wie Hammerschläge in seinen Ohren dröhnte, irrte jemand umher, der den Weg zu ihm herein finden wollte, jemand, der seine Hilfe erheischte, der seiner dringend bedurfte. Bei diesem Notschrei, diesem Hilferuf eines Wesens in Gefahr, ermannte sich Scobie wie von selbst zur Tat. Aus unendlicher Tiefe holte er mühsam sein Bewußtsein empor, um irgendeine Antwort zu geben. Mit lauter Stimme rief er: „Lieber Gott, ich liebe ...“, aber die Anstrengung war zu gewaltig; er fühlte nicht mehr, wie sein Körper auf dem Boden aufschlug, und hörte nicht mehr, wie mit leisem Klingeln ein Medaillon gleich einer Münze unter den Eisschrank wirbelte — eine Heilige, an deren Namen sich niemand mehr erinnern konnte.
„Ich hätte es nie bemerkt, Mrs. Scobie“, sagte Pater Rank.
„Mr. Wilson fiel es auf.“
„Irgendwie ist mir ein Mensch unsympathisch, der gar so achtsam ist!“
„Das ist sein Beruf.“
Der Priester warf ihr einen schnellen Blick zu. „Als Buchhalter?“ fragte er. „Oder ist er doch, wie man flüstert, beim Geheimdienst?“
In tiefer Niedergeschlagenheit wandte sich Louise an ihn: „Hochwürden, wissen Sie keinen Trost für mich?“ Er dachte bei diesen Worten: Die Gespräche, die nach einem Todesfall in einem Haus geführt werden, das ewige Herumreden, die endlosen Debatten, die Fragen, die Forderungen — so viel Lärm am Rande des Schweigens!
„Ihnen ist zeit Ihres Lebens sehr viel Trost zuteil geworden, Mrs. Scobie. Wenn Wilsons Vermutung richtig Ist, dann ist es Ihr Gatte, der Trost braucht.“
„Wissen Sie auch alles, was ich über ihn weiß?“
„Natürlich nicht, Mrs. Scobie. Sie waren ja fünfzehn Jahre mit ihm verheiratet, nicht? Ein Priester weiß immer nur von den unwesentlichen Dingen.“
„Von den unwesentlichen?“
„Ich meine, von den Sünden“, sagte er ungehalten. „Kein Mensch kommt zu uns, um uns seine Tugenden zu beichten.“
„Ich nehme an, Sie wissen von Mrs. Rolt. Die meisten Bekannten wußten von der Sache.“
„Die Arme!“
„Wieso arm?“
„Ich habe Mitleid mit jedem glücklichen und unwissenden Menschen, der mit einem von uns in eine solche Situation verstrickt wird.“
„Er war ein schlechter Katholik.“
„Das ist wohl das albernste Urteil, das man hören kann“, verwahrte sich Pater Rank.
„Und zum Schluß — diese entsetzliche
Tat! Er muß gewußt haben, daß er sich“ damit in die ewige Verdammnis stürzte.“
„Ja, das wußte er nur zu genau. Er hielt nie etwas von Erbarmen — außer für die andern.“
„Es hat nicht einmal Sinn, für ihn zu beten...“
Da schlug der Priester mit der Hand auf den Tisch und rief zornig: „Ich bitte Sie, Mrs. Scobie, bilden Sie sich nur j nicht ein, daß Sie — oder ich — etwas von Gottes Barmherzigkeit wissen.“
„Aber die Kirche lehrt doch...“
„Ich weiß, was die Kirche lehrt. Die Kirche kennt alle Gesetze. Aber sie weiß nicht, was im Herzen auch nur eines einzigen Menschen vorgeht.“
„Sie meinen also, daß doch noch Hoffnung besteht?“ fragte sie mit müder Stimme.
„Sind Sie so bitterbös auf ihn?“
„In mir ist keine Bitterkeit mehr.“
„Und glauben Sie, daß Gott bitterer zürnt als eine Frau?“ forschte er mit schroffer Eindringlichkeit. Sie aber wich vor den Argumenten zurück, mit denen er ihr Hoffnung machen wollte.
„Warum, warum mußte er uns alles so verderben?“ fragte sie.
Pater Rank antwortete: „Es mag vielleicht sonderbar klingen — wenn ein Mensch so sehr im Unrecht war wie er —, aber ich glaube ernstlich, nach allem, was ich über ihn weiß, daß er Gott wahrhaft liebte.“
Sie hatte eben erst bestritten, daß in ihr noch Groll wohne; dennoch sickerten jetzt — gleich Tränen aus müde geweinten Augen — noch ein paar Tropfen bitteren Gefühls aus ihrem Herzen, als sie die Worte sprach: „Er hat gewiß nur Gott geliebt, sonst niemand.“
„Mit dieser Ansicht haben Sie wohl das Richtige getroffen“, erwiderte darauf der Priester.
(Aus dem Roman „Das Herz aller Dinge“, mit Bewilligung des Paul-Zsolnay-Verlages, Wien)