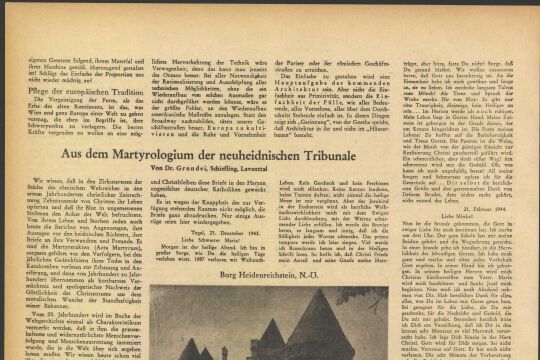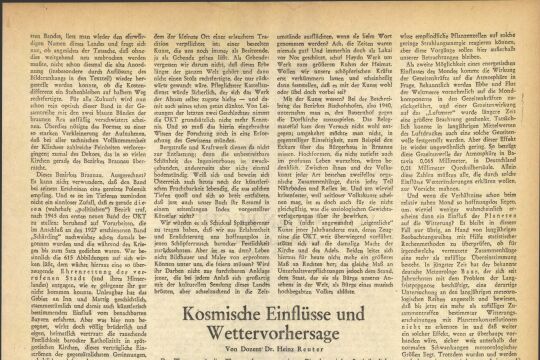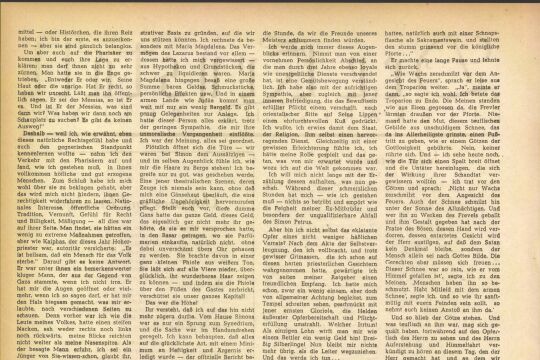Von dem Bischof einer amerikanischen Kirchenprovinz erhielt die Verfasserin den Auftrag, festzustellen, wie die amerikanische Jugend — die Arbeiterjugend und die Militärjugend — über Gott denkt, die Kirche, und wie sie sich zum Kommunismus und zur Demokratie stellt. Sie arbeitete monatelang als Fabrikarbeiterin und Kellnerin und führte bei armseiigem Verdienst ein richtiges „Hundeleben". Was sie während dieser Zeit durchmachte, erinnerte sie an die ersten Jahre in Amerika, während deren sie schwer arbeiten mußte, nicht um soziale Strömungen zu studieren, sondern sich vor dem Hunger zu schützen. Beide Erfahrungen verschmolzen zu einer und daraus erwuchs das Buch „Dear bishop", deutsch unter dem Titel „Lieber Bischof" im Paulus-Verlag, Recklinghausen, erschienen. Die Schreiberin dieser Briefe, Katzie, existiert nicht, man kann sie als erdacht bezeichnen, aber es ist das einzige, was in diesem Buche erdacht ist. Im folgenden drucken wir den neunten der zehn Briefe ab.
Lieber Bischof,
unlängst las ich im Evangelium, wie Christus in die Wüste ging, um vierzig Tage zu beten und zu fasten. Ich hatte die Geschichte schon oft gehört und gelesen. Aber erst jetzt begriff ich, Katzie aus dem Armenviertel, klar und deutlich, was „Wüste" heißt. Ich sah die Wüste lebendig vor mir und bekam einen Schock, ich wurde schwach und rang nach Atem. Ich lebe selbst in einer Wüste. Und alle um mich leben fortwährend in ihr. Eine Wüste? Ja, ich wußte plötzlich nur zu gut, was das war!!! Ein grauenhafter, einsamer Fleck Erde … riesig groß … ohne Brot und Wasser … tödlich für Seele, Geist, Herz und Körper … Menschen zu Tieren herabwürdigend. Sie versuchen herauszukommen, laufen nach links oder rechts, stürzen schließlich nieder, erschöpft von dem endlosen Greuel der Wüste.
Schmutzige, verfallene Straßen … quer durch Amerika … dürre Wüsten. Fuchsbauten, in denen Männer, Frauen und Kinder hausen. In Schmutz, Kälte und Dunkelheit oder in Staub und Hitze. Zu Tausenden. Vergessen, unbekannt, namenlos. Einsam, arm, hungernd nach Licht, Luft, Sonne und Liebe. Saharas unserer modernen verfeinerten Zivilisation.
Ja, plötzlich begriff ich. Christus litt Durst. Wir auch. Durst nach Ihm, nach den ewigen Wassern der Wahrheit. Er litt Hunger. Wir auch. Nach dem Brot des ewigen Lebens. Er wurde von Luzifer versucht. Wir auch, und zwar fortwährend. Er wußte alles von uns, wie wir mit blutigen Fäusten gegen die unsichtbare Mauer hämmern, die uns von unserem kostbarsten Erbgut trennt, von Seiner Wahrheit. Ich sah das alles in einem Augenblick und wußte, daß Sein Leiden unseren Schmerz umfaßt, unsere Einsamkeit und unsere Hoffnungslosigkeit. Er ist „wir" … die Männer und Frauen und Kinder all dieser vergessenen Straßen. Und ich wußte noch mehr. Er ist noch immer hier, aber unsere Augen sind von Tränen, Hunger und Durst geblendet, und darum verirren wir uns immer wieder.
Ach, Christus der Verzweifelten, habe doch Mitleid mit uns! Komm und sprich Selbst zu uns, wie damals zur Ehebrecherin. Komm, Herr der Heerscharen, Sohn des Zimmermanns, komm und laß uns nochmals Deine Bergpredigt hören. Wo wir wohnen, gibt es zwar keinen Berg, außer dem Misthaufen Großstadt. Auch gibt es kein Gras, nur hartes, schmutziges Pflaster. Aber wir, die Armen, die „Kleinen" von heute, werden die Worte des Lebens genau so wie die in früheren Zeiten hören und verstehen. Und wenn wir sie verstehen, werden Hunger, Armut und Durst uns nicht länger quälen. Wir werden diese Heimsuchungen nicht einmal mehr fühlen, denn unsere Seele wird für immer die Glorie Deines Antlitzes widerspiegeln und unser Herz das Echo Deiner Stimme hören. Komm, Christus der Arbeiter. Komm Selbst, denn wir sind verirrt in der Wüste voller Dornen. Komm, Jesus, komm …
So rief meine Seele zum Herrn, Bischof, inmeinem finsteren Zimmer, und ich schäme midi nicht, es Ihnen zu gestehen, denn ich bin fast am Ende. In der letzten Zeit fühle ich mich so unendlich müde … meine Seele, mein Geist, mein Herz. Der Wille, weiterzuleben, ebbt langsam in mir ab. Ich mußte wohl zum Herrn rufen, denn ich bin ja nur ein Geschöpf und kann „Seine Wüste" nicht ertragen wie Er. Glaube und Hoffnung, die Kardinaltugenden, scheinen langsam in meiner Seele abzusterben, wie Blumen.
So wütend war ich noch nie, ich zittere wie in einem Fieberanfall. Nur Liebe und Mitleid gegenüber denen, die all dies mit mir teilen, hält mich noch auf den Beinen. Heftiges, trok- kenes Schluchzen steigt aus meiner Brust auf. Ich möchte ihnen so gern alles sein, wonach sie verlangen. Aber Sterbliche brauchen das Sakrament der Priesterweihe, um allen alles werden zu können, nicht wahr? In der Falle. Ich sitze in der Falle. In der Falle wie eine Ratte. Von allen Seiten von Legionen belagert, Tag und Nacht, Nacht und Tag rufend: Wie steht es um die Gerechtigkeit ? Um Gottes Gerechtigkeit? Wie steht es um die Liebe? Um Gottes Liebe? Wie steht es um Seine Lehre? Um die menschliche Würde? Um das Recht, zu leben, zu arbeiten, zu heiraten, nach dem Glück zu streben? ,Wie steht es um die Speisung der Hungrigen, um das Kleiden der Nackten, um das Laben der Durstigen? Wie steht es um … wie steht es um … wie steht es um …? Ihr Mund schreit es mir zu. Ihre Augen schreien es mir zu. Ich höre sogar den vergeblichen Schrei ihrer hilflosen, gefesselten Seele …
Ja, ich trabe noch täglich hin und zurück zwischen meiner Bar und meinem Fuchsbau. Vergangenen Dienstag war ich in der Bar. Sie war halbleer. Sieben Soldaten saßen am Büfett bei einem Glas Bier. Ihr Gespräch wollte zuerst nicht recht in Fluß kommen, war zusammenhanglos, bis einer von ihnen den Begriff Demokratie zu definieren begann. Das, wofür sie kämpfen müßten! In weniger als einem Augenblick waren sie sich in einem Punkt einig: Für die Demokratie könnten sie unmöglich kämpfen, einfach weil es in den Vereinigten Staaten keine gebe. Aber sie meinten, daß sie etwas dafür tun könnten, wenn sie zurückkämen, wenn sie erst den Krieg gewonnen hätten, was ihre erste und wichtigste Aufgabe sei. Sie würden dann ihre Gewehre behalten, ja, das würden sie tun. Und dann würde eine neue politische Partei gegründet werden, die „Partei der Soldaten". Die Armee habe nach dem letzten Krieg viel zu sagen gehabt, was aber Kinderspiel zu dem sei, was sie alsdann zu sagen haben werde. Kinderspiel. Denn sie seien bereit, für das Recht auf ein anständiges Leben zu kämpfen. Straße für Straße zu kämpfen, Haus für Haus. Draußen, wie hier zu Hause!
So redeten sie, und sie blickten grimmig und entschlossen drein, so wie es nur die Jugend kann. Der Barmixer, ein Veteran, schüttelte traurig den Kopf und sagte, das sei wohl alles gut und schön, aber die hohen Herren, die in diesem Land Geld und Macht in ihren Händen hätten, seien auch keine dummen Jungen. Und sie träfen jetzt schon Vorbereitungen.
Zuerst würde die Demobilisierung langsam durchgeführt werden. Sie würden in kleinen Gruppen, tropfenweise heimkehren. Ehe sie sich versähen, würden ihnen die Gewehre schon abgenommen sein. Nein, antworteten die Burschen, dieses Mal nicht, denn sie stellten diese Forderungen ja nicht allein. Es gehe hier um etwas, das alle Soldaten auf der ganzen Weit und alle Arbeiter auf der ganzen Weit verlangten. Das sei der Unterschied zum vergangenen Mal. Wenn die hohen Herren nicht das Menetekel an der Wand sähen, würden sie eine Weltrevolution erleben, die wirklich eine Weltrevolution sei.
Am Ende des Büfetts saß ein Soldat ganz allein. Lang, mager, jung. Er hatte die ganze Zeit über geschwiegen. Als es plötzlich unbe-täglich still um uns geworden war, sogar bei den „B"-Girls, begann er zu sprechen. Er sprach mit leiser, kultivierter Stimme. Langsam, als wählte er die rechten Worte aus. Er sagte, daß Gewalt gerade das Verkehrte sei. Die Ursache des heutigen Zustandes sei, daß wir Gott und Seine Gebote vergessen hätten. Wir müßten den Papst unterstützen und seine Programme für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Er Zitierte die sozialen Enzykliken. Wie ein Prophet aus dem Alten Bunde forderte er Säuberung der Fierzen und Seelen.
Aber die Worte des Soldaten fielen auf steinigen Boden. Die anderen hörten höflich zu Das tun sie immer untereinander. Dann antworteten sie. Sie hätten sie hören müssen. Ein Junge sprach über das Elendsviertel, aus dem er kam. Beschrieb die Mietskaserne, in der er aufgewachsen war. Er sagte, daß sie Eigentum frommer Katholiken sei.
Dann setzte ein anderer die Erzählung fort. Lebendig, saftig und gotteslästerlich schilderte et die „Folterungen" (so nannte er es), die er und die Seinen von seifen katholischer Sozialbüros erlitten hätten. Er selbst sei in der Zeit der Arbeitslosigkeit von vierzehn Büros „behandelt" worden. Haß glühte in jedem Blick, den er warf. Sein mageres Gestell, das auch während der Militärzeit noch nicht dik- ker geworden war, bebte vor Haß. Dann kam sein Nachbar zu Worte. Er war vom Lande, irgendwoher aus den fernen regenarmen Staaten. Ein geborener Katholik. Seine Worte waren pures Gift. Seit seinem zehnten Lebensjahr hatten er und die Seinen keine Kirche mehr betreten. Der Papst? Der ist reich. Was weiß der schon von Armut, Verfall, Unsicherheit? Und die Priester predigten das sechste Gebot nur vor den Leuten, die entweder nicht die Kraft haben, dagegen zu sündigen, oder die nur den fleischlichen Genuß haben, um die Schrecken des täglichen Lebens vergessen zu können.
Von dem, was die Kirche ihren Kindern auf geistigem Gebiet zu schenken vermag, hatte der Junge keinen blassen Schimmer.
Der schlanke Soldat mit der ruhigen Stimme — ein Katholik, der an der Universität von Villanova, im Osten des Landes, studiert hatte, wie ich später erfuhr — versuchte -ihm das beizubringen. Aber die Gruppe wandte sich gegen ihn, mit Worten, die wie Maschinengewehrkugeln prasselten. Er kämpfte tapfer — aber vergebens. Die 'Erinnerung an hochgestellte Katholiken, die sie nicht hatten ausstehen können, hatte offensichtlich für immer ihren Blick für den Frieden Christi voll Mitleid, Verstehen und Liebe zu den Menschen verdunkelt. Sie konnten daher das Antlitz eines Gottes nicht mehr sehen, der aus Liebe zu ihnen gestorben war.
Tränen traten in die Augen des Jungen aus Villanova. Er stand auf, lehnte sich mit dem Rücken gegen das Büfett, reckte sich in ganzer Größe auf und sagte mit lauter Stimme, so daß alles im Augenblick schwieg: „Gut, ihr sagt, daß die Bischöfe und die Priester uns im Stich gelassen hätten. Vielleicht taten einige von ihnen das auch. Judas und Petrus haben den Herrn ja auch im Stich gelassen. Deshalb wollen wir Christus aber nicht aus unserem Leben ausschließen. Wollen wir doch an Ihm festhalten. Für Ihn sterben, wenn es sein muß. Für das, wofür Er gestorben ist: Gerechtigkeit für alle, Bruderschaft aller Menschen unter der Vaterschaft Gottes. Tun wir das nicht, ist unser Sterben umsonst …" Er setzte sich erschöpft nieder.
Die Stille dauerte an. Fühlbar. Ein lebendes Wesen. Keiner rührte sich. In diesem Augenblick muß die Flamme des Heiligen Geistes auf meine Bar hėrabgekommen sein. Man konnte Seinen Flügelschlag deutlich hören. Wieder brachen Worte diese Stille, wie ein Geräusch ein Glas Zum Brechen bringen kann. „Beruhige dich, Mann. Gott ist für uns o. k. Warte nur, wir sind keine Atheisten, aber wenn wir zurückkommen, werden wir die Kerle im schwarzen Rock mit den verkehrten Kragen an die Arbeit setzen, und wenn sie nicht wollen, werden wir sie Mores lehren."
Der Junge aus Villanova nahm seine Mütze und ging. Mit schwankendem Schritt. Er hatte sich tapfer gewehrt. Er dachte, daß er nichts erreicht habe. Aber es war nicht so. Denn als er fort war, debattierten sie weiter. Und sie kamen zu dem Schluß, daß es einen Gott gebe, und daß sie beim Kämpfen wie auch beim Pläneschmieden mit Ihm rechnen müßten. Daß Er ihren Standpunkt verstehen werde … Revolution, Kampf für das wenige, worauf ein Mensch ihrer Ansicht nach Anspruch erheben kann. Ich wollte, ich träfe den Soldaten aus Villanova noch einmal und könnte ihm das erzählen.
„When I go to a ball … I have no trouble at all . . The chicks that I pick are all tender, slender and tall …"Das Negerorchester spielte einen Song und übertönte die Worte und Stimmen der Jugend.
„Gott … Kirche … Gerechtigkeit … Rechte … Priester … Krieg …" Begriffe, die sich mit Saxophon, Schlagzeug und Klavier seltsam vermischten, aber nicht lange.
Gute Nacht, Bischof.