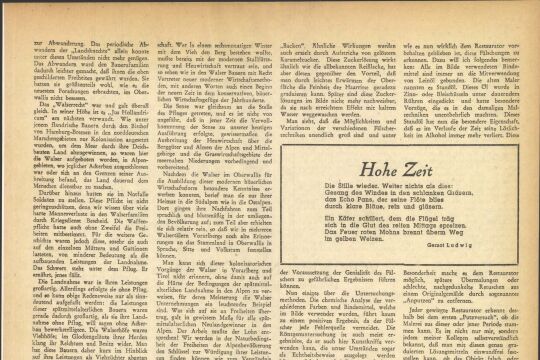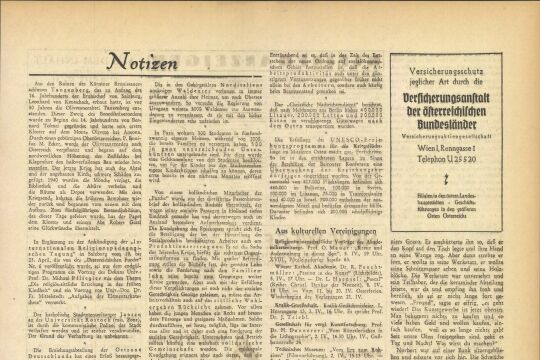Ich war wegen eines alten Magenleidens im Spital: nur auf zehn Tage, zur Uberprüfung und Probebehandlung. Ich war einige Tage dort, als eines Vormittags ein neuer Patient eintraf, der die Aufmerksamkeit aller im Saale erregte. Er war ein Riese von einem Mann, ein wandelnder Turm. Das Bett, das ihm die Saalschwester zugewiesen und in das er ich hineingelegt hatte, war zu kurz für ihn, seine Füße ragten weit durch das Gitterende heraus.
Niemand jedoch lachte oder lächelte darüber, so gern das die Insassen eines Spitalsaals bei solchem Anlaß zu tun bereit sind; dieser Mann sah nicht so aus, als ob er jemals Heiterkeit oder Freude erweckt hätte. Starr und klotzig war er, wie eine überlebensgroße archaische Statue, die man von ihrem Standort entfernt und nun hier obszönerweise in ein Spitalsbett gelegt hatte. Sein enormer kantiger Schädel war völlig unbehaart und glatt wie aus poliertem, grau-gelblichem Sandstein; wie aus Stein gehauen war auch sein Gesicht, der Mund darin nur eine haardünne Linie.
In all seiner Sonderheit war der Mann mir nicht fremd, obwohl es schon lange her sein mußte, daß ich ihn irgendwo gesehen hatte. Es war, als ob er nie anders als jetzt ausgesehen hätte und sein Gesicht nie jung und weich gewesen wäre. Ich - selber damals um vieles jünger - schätzte ihn auf ungefähr fünfundsechzig Jahre. Die junge Zimmerärztin, die sich an sein Bett gesetzt hatte, um seine Krankheitsgeschichte aufzunehmen, kam damit nicht weiter: er war so gut wie völlig taub.
Aus seinen Papieren gelang ihr, festzustellen, daß er bereits 85 Jahre alt war, daß er kaum je ernstlich krank gewesen und, von Beruf Polizist, schon Anfang der dreißiger Jahre in Pension gegangen war. Während eines Jahres - von Februar 1934 bis Februar 1935 - war er wieder für den Staatsdienst reaktiviert worden. Danach war er in den Ruhestand zurückgekehrt, nun näher bei Wien, am Stadtrand, aber immer noch in fast ländlicher Umgebung.
Als ich den Februar 1934 erwähnen hörte, wirkte das auf meine Erinnerung wie ein Signal. Ich begann mich zu entsinnen, woher ich ihn kannte -aber es machte mir keine Freude. Dunkel erinnerte ich mich, daß meine Begegnungen mit diesem Mann nicht gut verlaufen waren. Ja, zweimal war ich ihm im (Jahre 1934 begegnet, und beide Male unter wenig erfreulichen Umständen.
Das erste Mal: Am Morgen des 13. Februar 1934, in einem Personenzug auf der Nordbahn, auf der Fahrt von Lundenburg nach Wien. Ich kam aus der Tschechoslowakei, wo ich in den letzten Monaten mit Gretka in Brünn gelebt hatte. Vorher, in Österreich, war ich infolge der Krise postenlos gewesen - ich war es auch nachher, in Brünn. Dort jedoch hatte Gretka, die tschechoslowakische Staatsbürgerin war, eine Anstellung als Kindergärtnerin gefunden und erhielt uns beide während jener Zeit.
Am späten Nachmittag des 12. Februar also wurden in den Straßen Extra-Ausgaben der Zeitungen ausgerufen. In ihnen wurde berichtet, daß in Österreich bewaffnete Kämpfe zwischen den sozialdemokratischen Schutzbündlern und den Organen der Regierung ausgebrochen seien. Als wir in unser Untermietzimmer heimgekehrt waren, beim Nachtmahl saßen und aus dem Radio weitere Berichte über die Kämpfe in Österreich hörten, sagte ich: „Morgen früh fahre ich nach Wien“. Gretka sagte: „Das habe ich mir gedacht“.
Auf der Fahrt im österreichischen Zug durch das vom eisigen Februarwind vom Schnee und auch von Menschen leergefegte Marchfeld war nichts von einem Bürgerkrieg zu bemerken. Es war nicht die Jahreszeit für so etwas. In den Stationen stiegen nur wenige Leute zu. Es waren meist ältere Männer, die einander alle zu kennen schienen: die pensionierten Polizisten und Gendarmen, die wegen des Alarmzustandes von der Regierung einberufen worden waren.
Sie lebten in den kleinen Orten Niederösterreichs und auch jenseits der Grenze, weil das Leben dort billiger kam. Nun, im Zug, sprachen sie von den Kaninchen, die sie züchte-
ten, und vom Gemüse, das sie anbauten, nicht vom Bürgerkrieg. Nur einmal sagte einer unvermittelt: „Wird eh' nix los sein.“
Einer von ihnen hielt sich abseits mit streng-verschlossenem Gesicht und nahm nicht an den Gesprächen teil. Dabei war er bestimmt einer von ihnen; sogar sitzend überragte er die anderen um zwei Kopf und sah wie der Inbegriff einer Stütze herrschender Macht aus: hart, argwöhnisch, unzugänglich selbst noch für die eigenen Kollegen.
Denen schien auch nichts an ihm zu liegen, sie überließen ihn sich selbst. In mir weckte er mit seinem massiven Schädel, seinen tellergro- ' ßen Pratzen ein Gefühl von Furcht und Ohnmacht. Ich empfand das um so stärker, da ich wußte, daß er und ich uns sehr wohl nach dieser Bahnfahrt wieder begegnen konnten - und zwar nicht mehr als Mitpassagiere, sondern als offene Feinde.
Die Gegend, durch welche der Zug schließlich fuhr, begann weniger ländlich auszusehen; an der rechten Seite der Bahnstrecke zeigten sich immer mehr Häuser, wenn auch kaum mehr als einstöckige; wir fuh-
ren langsam in die erste Wiener Vorortstation ein: Stadlau. Als wir sie wieder verließen, beschleunigte der Zug jedoch nicht das Tempo, sondern kroch nur langsam voran, als wäre der Lokomotivführer dessen, was vor uns lag, nicht mehr so sicher wie vorher. Und plötzlich wurden wir auch schon gewahr, daß wir mitten durch den Bürgerkrieg fuhren.
An der linken, überhöhten Böschung des Bahndamms lagen Soldaten des Bundesheeres in feldgrauen Uniformmänteln, mit Stahlhelmen auf den Köpfen und Gewehren in den Händen. Drei von ihnen kauerten hinter einem Maschinengewehr; neben ihnen kniete ein junger Offizier und hatte einen Feldstecher in der Hand. Mit dem konnte er freilich jetzt nicht hinunter, auf die andere Seite des Bahnstrangs sehen, da ihm unser vorübergleitender Zug die Sicht benahm. Dort unten mußten irgendwo die Gegner der Soldaten stehen, waren doch deren Waffen dorthin gerichtet.
Ich eilte deshalb auf die rechte Fensterseite des Waggons und schaute hinaus. Dort unten, entlang der Bahnstrecke, verlief eine schmale Straße, die von einigen kleinen Häusern flankiert wurde. Und hinter der Ecke eines dieser Häuser standen sie, gleichfalls mit Gewehren bewaffnet, doch in Zivilkleidung. Zwei hatten nicht einmal Mäntel, in dem bitterkalten, schneidenden Februarwind. Einer hielt den von einem Wasserkühler umgebenen Lauf eines Ma-
schinengewehrs wie ein Baby an die Brust gepreßt.
Sie mußten eben erst dort angekommen sein, wie sie hinter der Ecke an die Hausmauer gedrängt standen, ohne irgendeine Position von Vorteil. Eine solche war die Stellung an der erhöhten linken Böschung, und die war bereits vom Bundesheer besetzt. Sie waren einfach zu spät hingekommen, die Schutzbündler, wer weiß warum, und waren nun dem Beschuß von Seiten der Bundesheer-gruppe in dem Augenblick ausgesetzt, in dem unser Zug zwischen den beiden Parteien vorbeigeglitten sein würde.
Wenn der Zug jetzt stehen blieb, mochten sie noch Zeit finden, etwas zu tun, wenn nichts anderes, so sich zurückzuziehen und in Sicherheit zu bringen. Doch wer vermochte den Zug noch zum Stehen zu bringen, außer der Lokomotivführer, der kaum ein Interesse daran haben konnte, sonst wäre er an diesem Tag der Generalstreikparole gefolgt und nicht zur Arbeit gegangen.
Da war noch die Notbremse über dem Fenster, ich brauchte sie nur herunterzuziehen. Aber das war nur
ein flüchtig vorübergehender Gedanke. Wer war ich schon, um hier einzugreifen? Jetzt erst, hier, im Spital, wurde mir bewußt, daß das nur eine Ausrede gewesen war, und daß ich es aus Angst vor dem mir gegenübersitzenden Riesen nicht getan hatte.
So war der Zug damals weitergefahren, zuerst noch langsam, doch dann plötzlich sehr schnell, als wollte der Lokomotivführer die Menschen dort so schnell wie möglich hinter sich bringen. Welche Angst vor welchem Riesen hatte sein Versagen bewirkt?
Als ich zu Hause ankam, sagte meine Schwester, während sie mir die Wohnungstür öffnete: „Als ob ich nicht gewußt hätte, daß du jetzt nach Wien kommen wirst“ Mein Vater sagte zu ihr: „Mach ihm einen Tee mit Schmalzbrot“ und zu mir: „Ich bitt' dich, laß dich auf nichts ein, es hat keinen Sinn. Was können sie denn tun? Die ganze Staatsmacht ist gegen sie!“
Draußen war Nacht, die Straße war wie eine finstere Schlucht, die Bogenlampen brannten nicht, der Strom war noch immer abgeschaltet. Von unten auf der Straße riefen Patrouillierende zu den Häusern empor: „Fenster zu, sonst wird geschossen!“ Von weit weg, aber doch noch im Stadtgebiet, hörte man Kanonen schießen. „Hörst ja“, sagte mein Vater, „die Regierung schießt mit Kanonen, es hat keinen Sinn mehr.“ Ich
wußte, daß er aus Angst um mich so sprach.
Am nächsten Morgen ging ich zu Roman, nach Mariahilf. Roman war mein Vorgesetzter in^der Partei gewesen, bis ich in die CSR gegangen war. „Wie steht's?“ fragte ich. „Nicht gut“, sagte Roman, „der Aufstand ist im Abflauen, aber für uns beginnt jetzt die eigentliche Arbeit: Einsammeln der verlorenen Schafe“.
Neun Monate später war ich „eingesammelt“. Ich war in der Wohnung Ludwig Bartas, eines kommunistischen Schriftstellers, angetroffen worden, als er mir aus einem ziemlich schlechten Versuch zu einem Roman über den Februar 1934 vorlas. Die Polizei hatte daraufhin auch in meiner Wohnung Nachschau gehalten und illegale Flugblätter gefunden. Ich wurde zu einer mehrmonatigen Arreststrafe verurteilt, die ich in einer Reihe von Polizeigefängnissen absaß.
Im Augenblick befand ich mich im größten auf der Elisabeth-Promenade - nicht ohne Gefühlsbezug von den Insassen „Liesl“ genannt. Der riesige Bau war vom Kel-
ler bis zum Dach voll mit Gefangenen aller drei verbotenen politischen Parteien. Ich war mit gut hundertfünfzig anderen in einem großen Saal. Und da geschah es, daß - wie immer zu Mittag - die massive Saaltür zur Essensausgabe aufgesperrt und geöffnet wurde.
Da stand der riesige Schließer mit Schlüsselbund in der Hand, begleitet von zwei Häftlingen. Diese hielten eine hölzerne Trage, auf der sich verbeulte Menageschalen aus Zinkblech befanden, in denen eine graue Suppe trüb hin- und herschwankte. Worauf „die Aktion“ startete.
Sie war von der den meisten Häftlingen unbekannten illegalen Saalleitung bis ins kleinste Detail abgesprochen worden. In dem Augenblick, in dem die Essenträger begannen, uns die Menageschalen zu reichen, rief die „Initiativ-Gruppe“ im Chor: „Wir verweigern die Annahme von dem Fraß!“
Es war schwer, sich in diesem Satz nicht zu verhaspeln, zumal wir nicht wenig aufgeregt waren. Der Augenblick war dramatisch und erinnerte an die klassische Szene in dem russischen Film „Panzerkreuzer Potjom-kin“, dessen Matrosen ebenfalls die Essensannahme verweigert hatten und deshalb füseliert werden sollten.
Nur, daß bei uns hier nichts dergleichen geschah. Der Schließer würdigte uns nicht einmal eines Blickes. Er gab den Essensträgern ein stummes Zeichen, worauf sie die Menageschalen innerhalb des Saales
auf dem Estrich abstellten. Nachdem sie den Saal verlassen hatten, schlug der Schließer die schwere Tür von draußen krachend ins Schloß. Es war, als hätte man sie uns direkt an den Kopf geschmissen.
Da standen wir nun, etwas be-lämmert, vor den Menageschalen, und wußten nicht recht, was weiter zu tun. Kein wutentbrannter Kommandant kam und las uns die Kriegsartikel vor, kein Kommando Bewaffneter versuchte, uns mit vorgehaltenen Gewehrläufen zum Essen der Suppe zu zwingen. Als am Abend das übliche kalte Mahl ausgegeben wurde - eine Knackwurst, eine Ecke Schmelzkäse, ein Stück Brot und ein Blechhäferl Him-beerblättertee -, nahmen wir es widerspruchslos entgegen. Bei dieser Gelegenheit verschwanden auch die Menageschalen mit der Suppe, die von den Kalfaktern in eine fahrbare Tonne geschüttet wurde.
Nicht ausgesprochen, aber nichtsdestoweniger vorhanden, war das Gefühl, daß wir uns angesichts der Unerschütterlichkeit des Schließers lächerlich gemacht hatten. Und so war's immer zwischen ihm und uns. Die anderen Wächter vermochten wir auf die eine oder andere Weise anzusprechen. Die auf den Gängen außerhalb der Gefangenensäle postierten Hilfspolizisten der „Heimwehr“ und der „Ostmärkischen Sturmscharen“ waren schon aus Langeweile froh, wenn wir mit ihnen zu diskutieren versuchten. Sogar der Leiter des Gefangenenhauses, der ironisch-überlegene Major Kristen, ging nicht ungern auf ein philosophisches Streitgespräch unter vier Augen in seiner Kanzlei ein.
Nur den „steinernen Gast“ vermochte nichts zu berühren: nicht gutes Zureden noch Ironie noch Versuche zum Streit. Wenn einen etwas demoralisierte und die Ohnmacht des Eingesperrtseines fühlen ließ, so dieser undurchdringliche, wandelnde Wachturm in seiner verblichenen flaschengrünen Uniform.
Jetzt, dreißig Jahre später, als er in dem Spitalsbett, wenige Meter von dem meinigen entfernt, hilflos dalag, und nun auch ein zweiter Arzt vergebens versuchte, mit dem stocktauben Menschen zu einem Gespräch zu gelangen, wurde mir auch wie mit einem Schlag klar, worin seine ganze Undurchdringlichkeit und Unerschütterlichkeit bestanden hatte: in seiner Taubheit.
Sie hatte ihn schon damals im Februar 1934 von seinen eigenen Kollegen ferngehalten, und an ihr waren unsere lauten Proteste im Gefangenenhaus wie vielleicht ein entferntes Säuseln überhaupt nicht an sein Bewußtsein herangekommen. All seine übermächtige Stärke war in Wirklichkeit nur ein armseliges menschliches Gebrechen und machte ihn zum Gegenstand von Mitleid. Und gleich hier, in den nächsten Stunden, wurde ich Zeuge, wie sich das Verhängnis dieses Defektes an ihm erfüllte.
Es war riicht so sehr, daß er nicht angesprochen werden konnte. Es war vielmehr die Starre, welche ihn infolge Mangels an menschlichem Kontakt wie eine immer härtere Kruste umfangen hatte. Vielleicht hatte sie ihn zuweilen auch vor Zweifeln und Anfechtungen bewahrt. Noch mehr jedoch war sie ihm zur Isolierzelle seiner selbst geworden. Darin gefangen, verklammerte er sich nun in panischer Angst vor allem, das ihm hier im Spital entgegenkam, was immer es auch sein mochte.
Als zwei Krankenwärter kamen und ihn auf eine Rollbahre heben wollten, um ihn zum Röntgen zu bringen, wehrte er sich wie ein wildes Tier dagegen. Kopfschüttelnd ließen sie von ihm ab, der in keuchender Panik verblieb. Und so keuchte sich sein mächtiger Körper mit immer rasenderen Atemstößen in die Agonie, ins Ende. Bis er wieder starr und bewegungslos dalag wie ein vom Bildhauer unvollendeter und im Stich gelassener Steinblock, und tot war: nur zwanzig Stunden nach seiner Ankunft im Spital.
Der Arzt sagte mir, daß Menschen dieser Art oft viel jäher zusammenbrechen als andere, die immer schwach und anfällig waren oder sonst viel im Leben durchgemacht haben.