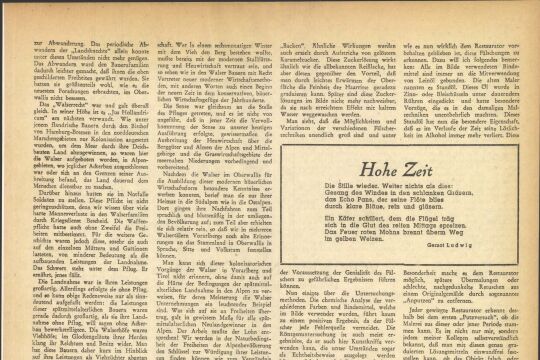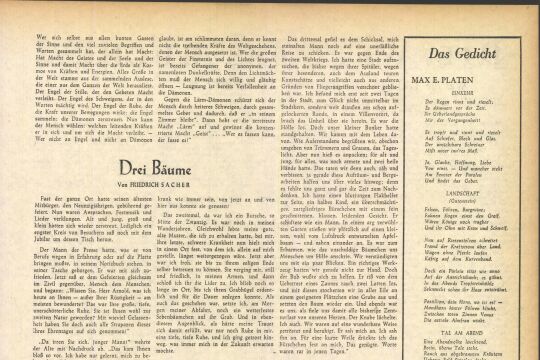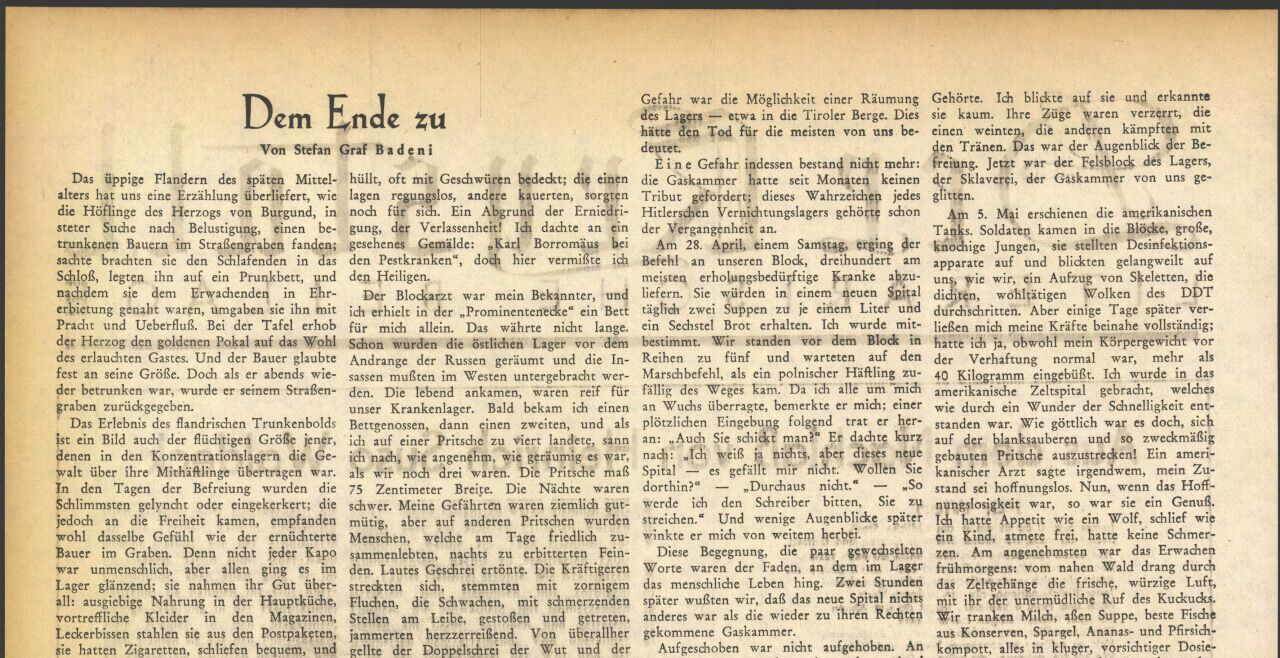
Das üppige Flandern des späten Mittelalters hat uns eine Erzählung überliefert, wie die Höflinge des Herzogs von Burgund, in steter Suche nach Belustigung, einen betrunkenen Bauern im Straßengraben fanden; sachte brachten sie den Schlafenden in das Schloß, legten ihn auf ein Prunkbett, und nachdem sie dem Erwachenden in Ehrerbietung genaht waren, umgaben sie ihn mit Pracht und Ueberfluß. Bei der Tafel erhob der Herzog den goldenen Pokal auf das Wohl des erlauchten Gastes. Und der Bauer glaubte fest an seine Größe. Doch als er abends wieder betrunken war, wurde er seinem Straßengraben zurückgegeben.
Das Erlebnis des flandrischen Trunkenbolds ist ein Bild auch der flüchtigen Größe jener, denen in den Konzentrationslagern die Gewalt über ihre Mithäftlinge übertragen war. In den Tagen der Befreiung wurden die Schlimmsten gelyncht oder eingekerkert; die jedoch an die Freiheit kamen, empfanden wohl dasselbe Gefühl wie der ernüchterte Bauer im Graben. Denn nicht jeder Kapo war unmenschlich, aber allen ging es im Lager glänzend; sie nahmen ihr Gut überall: ausgiebige Nahrung in der Hauptküche, vortreffliche Kleider in den Magazinen, Leckerbissen stahlen sie aus den Postpaketen, sie hatten Zigaretten, schliefen bequem, und für ein Stück Brot wurden sie eifriger bedient als ein Prinz in seinem Palast. Die Mächtigsten versahen Funktionen in den Zentralstellen des Lagers, ihre Namen waren allen geläufig, wie etwa die Namen von Filmstars oder Sportgrößen. „Ich bin der Erste hier, ich vermag alles“, prahlte einer zu mir. Auf uns Lagerpöbel sahen sie ungern herab. Doch die Peiniger waren unter den Blockkapos und den Arbeitsaufsehern. Ihre Vergangenheit schon war kriminell, der böse, irre Blick zeugte von Entartung. Eine Folgeerscheinung ihrer Launen und ungehemmten Gelüste waren jene jüngsten Häftlinge im Block, die immer zierlich und gepflegt waren, auch mit kosmetischen Mitteln nachhalfen und stets, ausnahmslos, eine Uhr am zarten Handgelenk trugen. Diese jungen Prominenten — welch ein Abschnitt, welch ein Merkmal in der Gesc'iichte aller Konzentrationslager des Dritten Reiches!
Die letzten Monate 1944 hatte ich im Revier“ verbracht, also, gemessen an sonstigen Möglichke:ten, in einem Schlaraffen-dasein. Zu Neujahr hieß es zurück in die rauhe Wirklichkeit des Blocks. Dort sollte ich auch wieder Kleider erhalten. Aber alles Warme war längst vergeben, ich mußte mich mit einem Anzug ohne Unterfutter begnügen. Das Stehen im Jänner auf dem Appellplatz erheischte Geduld; schlimmer war es, wenn es schneite oder regnete: Kleiderwechsel, Austrocknen waren unbekannte Begriffe, und wie ein Baum im Walde empfing ich die Nässe, fror dann gelegentlich ein und taute wieder auf. Meine Gesundheit vertrug diese Lebensweise trotz meiner 59 Jahre sehr gut, nicht der kleinste Schnupfen stellte sich ein, es schien, daß der Organismus alle Krankheitsgefahren beiseite geschoben hätte, um sich gegen den grimmigsten Feind zu wappnen: gegen die Erschöpfung. Diese war unausbleiblich, ich war schon aus den Budapester Gefängnissen geschwächt angekommen, die Kost wurde immer spärlicher, vor allem aber ermüdete der Mangel an jeglicher Ruhe. Unser Block war überfüllr, ich verbrachte mit der Mehrzahl die Nächte auf dem Fußboden in unvorstellbarem Gedränge. So kam es, daß ich an einem Februarmoreen beim Appell ohnmächtig wurde; ich fiel unweit vom Lagerführer Bachmeier, ohne indes seine gefährliche Neugier zu erregen. Auf den Schultern ungarischer Kameraden kam ich zu mir, sie trugen mich gerne — ich wog nicht viel — und waren fröhlich ob der Abwechslung. Einige Stunden später wurde ich in das allgemeine Krankenlager ?eschickt, es hieß auch Russenlager und umfaßte zehn Blöcke; ich kannte es nur vom Hörensagen.
Als ich die Schwelle des mir zugewiesenen Blocks überschritten hatte, zauderte ich und blieb stehen. Vor meinen Augen war ein erschreckendes, aber auch — ich möchte sagen — in seiner Art grandioses Bild menschlichen Elends: im Riesensaal waren die übereinandergeschichteten zahllosen Pritschen in unglaubliche Enge gedrängt, auf jeder sah ich drei oder vier Gestalten, die wohl einst normale Menschen gewesen, die skelettartigen Körper waren beinahe unverhüllt, oft mit Geschwüren bedeckt; die einen lagen regungslos, andere kauerten, sorgten noch für sich. Ein Abgrund der Erniedrigung, der Verlassenheit! Ich dachte an ein gesehenes Gemälde: „Karl Borromäus bei den Pestkranken“, doch hier vermißte ich den Heiligen.
Der Blockarzt war mein Bekannter, und ich erhielt in der „Prominentenecke“ ein Bett für mich allein. Das währte nicht lange. Schon wurden die östlichen Lager vor dem Andränge der Russen geräumt und die Insassen mußten im Westen untergebracht werden. Die lebend ankamen, waren reif für unser Krankenlager. Bald bekam ich einen Bettgenossen, dann einen zweiten, und als ich auf einer Pritsche zu viert landete, sann ich nach, wie angenehm, wie geräumig es war, als wir noch drei waren. Die Pritsche maß 75 Zentimeter Breite. Die Nächte waren schwer. Meine Gefährten waren ziemlich gutmütig, aber auf anderen Pritschen wurden Menschen, welche am Tage friedlich zusammenlebten, nachts zu erbitterten Feinden. Lautes Geschrei ertönte. Die Kräftigeren streckten sich, stemmten mit zornigem Fluchen, die Schwachen, mit schmerzenden Stellen am Leibe, gestoßen und getreten, jammerten herzzerreißend. Von überallher gellte der Doppelschret der Wut und der Klage, einmal schien es mir, der ganze Block habe nur einen einzigen Mund, dem ein mächtiger Ruf der Verzweiflung entsteigt. Die Aufseher schlichen sich in der Dunkelheit heran und hieben mit ihren Peitschen auf die lautesten Schreier. Manchmal hörte man ein Aufschlagen auf dem Fußboden und ersterbendes Stöhnen: jemand war von seiner hochgelegenen Pritsche gefallen und stand nicht wieder auf.
Wochen vergingen, immer mehr „Zugänge“ schleppten sich herbei, die hohe Sterblichkeit in den Blöcken schuf ihnen Raum. Wir lauschten den Frontberichten, die unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut wurden. Sie lauteten nicht immer erfreulich, und langjährige Häftlinge sagten noch Jahre des Krieges voraus. Doch ich war Optimist.
Im März wurde die Nahrung viel knapper; was wir noch vor Wochen erhalten hatten, erschien uns jetzt das Mahl eines Gargantua. Und im April mußte auch ich an den bevorstehenden Hungertod glauben. Es gab Tage, da man nicht einmal das Achtel Brot austeilte, nur einige Löffel bitteren Kaffeeersatzes am Morgen und einen halben oder dreiviertel Liter Rübensuppe zu Mittag. Die Sterblichkeit wuchs; in unserem Block, der tausend Kranke beherbergte, verstarben vierzig bis sechzig täglich. Dumpf bohrte sich der Hunger in unser Inneres, doch das psychische Leiden war größer. Ununterbrochen mußte ich an die kräftigsten, sattesten Gerichte denken, der Gaumen schmachtete nach ihrem Geschmack. Schloß man die Augen, sah man sie; siegte in der Nacht die Erschöpfung, dann luden Traumgebilde zu reichgedeckten Tischen. Unsere Suppenschüsseln gaben wir natürlich sorgfältig abgekratzt ab, und doch sah ich einmal einen jungen Häftling, der in einer Ecke eine nach der anderen an den Mund preßte und am Metall saugte. Er kämpfte um sein Leben — ein ergreifendes Bild des Hungers in Mauthausens letzten und schrecklichsten Tagen. Schließlich kam es zu Kannibalismus. Man erzählte von vier Fällen im Lager. Ein Häftling hatte mit scharfgeschliffenem Löffel dem schon erkalteten Kameraden die Leber herausgeschnitten und sofort verzehrt. Dies be-wog die Lagerobrigkeit doch zu einer Maßnahme. Die Rationen wurden zwar nicht erhöht, aber man nahm uns die Metallöffel und gab solche aus Holz.
Alltäglich war Lauskontrolle, eine zusätzliche, nutzlose Plackerei, denn tatsächlich wurde nichts unternommen gegen die kleinen, rührigen Insekten, die in ungeahnten Scharen mit uns ihr Unwesen trieben. Die Kontrolleure markierten nur ihre Tätigkeit, ab und zu waren sie sehr empört, die schuldigen Hüllen wurden vom Leibe gerissen, angeblich zwecks Entlausung, doch erhielt der Betroffene keinen Ersatz, und so wurde unser Block immer mehr zu einem Paradies, in dem keine Feigenbäume wuchsen.
Aber die Alliierten kamen näher und näher; wir besprachen, wie wohl die Befreiung aussehen werde. Da behaupteten sehr viele, daß wir sie nicht erleben würden; die Nazi würden uns vorher durch einen Luftangriff vernichten. Auch seien riesige Mengen von Dynamit aufgestapelt, um uns in die Luft ra sprengen. Die greifbarste, reellste Gefahr war die Möglichkeit einer Räumung des Lagers — etwa in die Tiroler Berge. Dies hätte den Tod für die meisten von uns bedeutet.
Eine Gefahr indessen bestand nicht mehr: die Gaskammer hatte seit Monaten keinen Tribut gefordert; dieses Wahrzeichen jedes Hitlerschen Vernichtungslagers gehörte schon der Vergangenheit an.
Am 28. April, einem Samstag, erging der Befehl an unseren Block, dreihundert am meisten erholungsbedürftige Kranke abzuliefern. Sie würden in einem neuen Spital täglich zwei Suppen zu je einem Liter und ein Sechstel Brot erhalten. Ich wurde mitbestimmt. Wir standen vor dem Block in Reihen zu fünf und warteten auf den Marschbefehl, als ein polnischer Häftling zufällig des Weges kam. Da ich alle um “mich an Wuchs überragte, bemerkte er mich; einer plötzlichen Eingebung folgend trat er heran: „Auch Sie schickt man?“ Er dachte kurz nach: „Ich weiß ja nichts, aber dieses neue Spital — es gefällt mir nicht. Wollen Sie dorthin?“ — „Durchaus nicht.“ — „So werde ich den Schreiber bitten, Sie zu streichen.“ Und wenige Augenblicke später winkte er mich von weitem herbei.
Diese Begegnung, die paar gewechselten Worte waren der Faden, an dem im Lager das menschliche Leben hing. Zwei Stunden später wußten wir, daß das neue Spital nichts anderes war als die wieder zu ihren Rechten gekommene Gaskammer.
Aufgeschoben war nicht aufgehoben. An demselben Tag wurden wir noch zweimal einer Selektionierung unterzogen, im vollen Bewußtsein ihres Zweckes. Wir stellten uns vor dem Block auf, und unsere Nummern wurden verlesen. Meine war eine hohe, ich mußte lange warten, aber jeder tat es ruhig, man war mit dem Tode vertraut. Die für diesmal Begnadigten wurden zu ihrer Pritsche zurückgeschickt. Der Schreiber — er war anständig — schwächte die erhaltenen Befehle ab: er gab nie diej verlangte Anzahl und schickte die Todesschar möglichst spät weg. Er wählte solche, die dem Tode schon verschrieben schienen. Die Opfer waren ergeben, der Lebensfunke glimmte ja kaum in ihnen.
Der nächste Tag war ein Sonntag — eine Art Gottesfriede auch im Lager. Am Montag hub es wieder an. Unsere Reihen lichteten sich bedenklich. Aus dem Krankenlager waren in diesen letzten Tagen schon 1600 gemordet. Jemand schickte mir einen Anzug, damit ich entfliehen könne. Doch wie entfliehen durch die stacheldrahtstarrende Umwelt?
Dienstag früh — es war der 1. Mai — warteten wir still auf den gewöhnlich schrillen, drohenden Schrei des Blockältesten, eines Wüterichs: „Alle raus aus den Kojki.“ Ich lag auf der obersten Pritsche, unter mir waren Deutsche. Ein Freund kam zu ihnen und sagte leise: „Eben hat das Radio verkündet, der Widerstand gegen Westen ist aufgegeben. In einigen Tagen sind die Amerikaner hier.“ Um mich lagen Polen, sofort und mit lauter Stimme wiederholte ich das Gehörte. Ich blickte auf sie und erkannte sie kaum. Ihre Züge waren verzerrt, die einen weinten, die anderen kämpften mit den Tränen. Das war der Augenblick der Befreiung. Jetzt war der Felsblock des Lagers, der Sklaverei, der Gaskammer von uns geglitten.
Am 5. Mai erschienen die amerikanischen Tanks. Soldaten kamen in die Blöcke, große, knochige Jungen, sie stellten Desinfektionsapparate auf und blickten gelangweilt auf uns, wie wir, ein Aufzug von Skeletten, die dichten, wohltätigen Wolken des DDT durchschritten. Aber einige Tage später verließen mich meine Kräfte beinahe vollständig; hatte ich ja, obwohl mein Körpergewicht vor der Verhaftung normal war, mehr als 40 Kilogramm eingebüßt. Ich wurde in das amerikanische Zeltspital gebracht, welches wie durch ein Wunder der Schnelligkeit entstanden war. Wie göttlich war es doch, sich auf der blanksauberen und so zweckmäßig gebauten Pritsche auszustrecken! Ein amerikanischer Arzt sagte irgendwem, mein Zustand sei hoffnungslos. Nun, wenn das Hoffnungslosigkeit war, so war sie ein Genuß. Ich hatte Appetit wie ein Wolf, schlief wie ein Kind, atmete frei, hatte keine Schmerzen. Am angenehmsten war das Erwachen frühmorgens: vom nahen Wald drang durch das Zeltgehänge die frische, würzige Luft, mit ihr der unermüdliche Ruf des Kuckucks. Wir tranken Milch, aßen Suppe, beste Fische aus Konserven, Spargel, Ananas- und Pfirsichkompott, alles in kluger, vorsichtiger Dosierung. Wir erhielten aus den Lagerbeständen ganz neue Häftlingsanzüge und Holzschuhe. Amerikanische Kapläne lasen die heilige Messe und teilten Rosenkränze in Menge aus.
Ich hatte gleich an meine Kinder, irgendwo bei der polnischen Armee, geschrieben; auf schnelle Verbindung konnte ich nicht hoffen. Ich erhielt unerwarteten Besuch: Baron Heinrich Siegler und seine Gemahlin, Bekannte aus Budapest, hatten in Linz von mir gehört und kamen sofort. Sie wollten mich in ein Linzer Spital bringen und für mich sorgen. Ich dankte gerührt, doch hatte ich ja alles in Mauthausen umsonst und wollte niemandem zur Last fallen. Sie erneuerten dann Besuch und gütiges Angebot.
Etwas gekräftigt, wurde ich in das Lager entlassen, Ich schritt dort über die so wohlbekannten Plätze wie über ein Schlachtfeld. Die Blöcke wurden immer leerer, immer stiller, sie standen in der Junisonne, stumme Zeugen vergangenen Grauens, aber auch mancher schönen Tat, mancher edlen Begegnung, gottergebenen Duldens. Einer war als Kapelle eingerichtet. Als . der polnische Priester im Weihrauchduft an den Altar trat und ein heimisches Kirchenlied anstimmte, glaubte ich mich wieder in einer unserer trauten Dorfkirchen.
Am 4. Juli kam ein junger, gewesener Häftling aus der Schreibstube zu mir. Noch ganz Kapo, schrie er strenge, ich habe sofort aufzubrechen, ein Auto sei da, mich abzuholen. Unschwer erriet ich, daß Baron Siegler den richtigen Weg gefunden hatte, meinen Widerstand zu meistern. Dem formellen Befehl mußte ich, zum letzten Male, gehorchen. Zunächst ging ich in die Kleiderstube, zwei ältere Polen suchten mir dort das Beste heraus. Aber wie sah es aus! Dann begab ich midi zum Zivilkommandanten. Er war auch ein Pole, und jung, wenn auch langjähriger, gewitzigter Häftling. Nicht ohne Rührung umarmte er mich. In seiner Person nahm ich Abschied auch vom Lager, von der bewegten, eindrucksvollen Vergangenheit, welche so frisch war wie eine Wunde, die noch blutet.
Die Baronin wartete beim Auto. Es entführte mich schnell, und bald befand ich mich in Linz im ausgezeichneten Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Der Arzt begrüßte mich nach bester österreichischer Art — höflich und gemütlich. Die Schwestern — nun ja — sie lächelten sanft. Dann war ich allein.
Nach 18 Monaten — zum ersten Male allein...
Wie still, wie öde ist es ringsumher! Wo ist das Gedränge der Unzähligen um mich? Verstummt das tierische Brüllen der SS, das hysterische Gezeter der Kapos. Ich bin frei! — Doch welche Freiheit? Jetzt erst, wo mit der Pein des Lagers auch der Optimismus, die Hoffnungen, die Illusionen geschwunden waren, erkannte ich, um welches Europa man gerungen hatte. Ich dachte an mein unglückliches Land, welches mehr als fünf Jahre einen beispiellosen Kampf des Widerstandes geführt hatte. Und ich dachte an die schönen Worte der Heiligen Schrift: „Wer in Tränen gesäet...“ Wie bitter war es, einsehen zu müssen, daß es jenen, welche nicht in Tränen, denn diese wurden dem Unterdrücker nicht gezeigt, aber in unermeßlichem Leid gesäet, nicht gegönnt ist, zu sagen: „Wir ernten in Freude.“