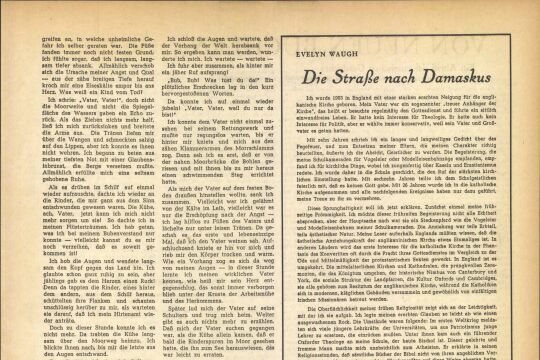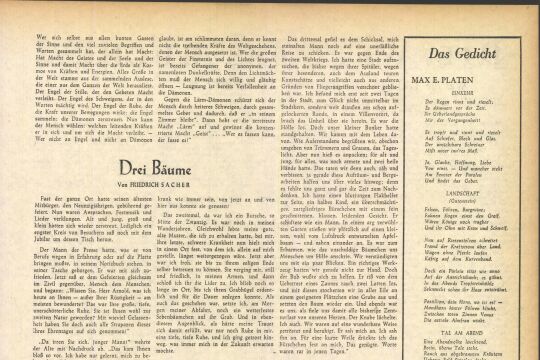Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Erlebnis einer Gefangenschaft
Aus allen Windrichtungen waren Ende April 1945 die 120.000 in dem Gefangenenlager „Winzenheim“ bei Bad Kreuznach zusammengeströmt. Vierzehnjährige waren darunter und auch Greise von 70 Jahren fehlten nicht. Verwundete und selbst Ampu-, tierte fanden sich ein und büßten so unschuldig den wahnwitzigen Aufruf zum „Werwolf“, der selbst Lazarette miteinbezog. Sie waren alle durch tagelange Transporte und den' Aufenthalt in überfüllten Zwischenlagern erschöpft und standen nun dichtgedrängt auf Weizenfeldern, deren junges Grün, schnell von hunderten Stiefeln zerstampft, einem kotigen Brei wich. Hier war nun unser Aufenthalt Tag und Nacht. Ärztliche Betreuung gab es fürs erste so gut wie keine und der Hunger war unser treuester Kamerad. Es mag nicht an mangelndem Willen der Betreuer gelegen haben, denn die Massen der plötzlich zu Verpflegenden bedeuteten allein schon technisch ein Problem. Noch in Sichtweite lag eir. anderes Lager mit 80.000, zehn Kilometer entfernt ein drittes mit 200.000 Mann. Viele starben denn auch in den ersten Wochen, noch mehr drohten angesichts eines solchen Zusammenbruchs in willenlose Hoffnungslosigkeit zu versinken. Sie begannen die Toten zu beneiden.
Eine wahnwitzige Politik und eine verblendete Führung hatte alle diese Menschen sehenden Auges in die größte Katastrophe der deutschen Geschichte geführt und in ihrem Gefolge unübersehbares Leid jedem einzelnen zugefügt. Die einen verhärtete dies Leid, die anderen machte es '.eifer und aufgeschlossen für Tieferes. So fand die Seelsorge einen fruchtbaren Boden.
Den amerikanischen Feldgeistlichen beider Konfessionen gebührt das Verdienst, diese für die deutschen Gefangenen erlaubt und nach ihren Kräften gefördert zu haben.
Am Beginn der dritten Woche, als der Zustrom ins Lager aufgehört hatte und die sanitäre und ärztliche Betreuung ihren organisierten Anfang nahm, wurden auch die katholischen und evangelischen Seelsorger aus den Reihen dei Gefangenen zusammengerufen. Nach ein paar englischen Worten des amerikanischen Feldgeistlichen sprach ein deutscher Oberstabsarzt die denkwürdigen Worte: „Wir stehen hier vor der großen Aufgabe, möglichst viele der Kameraden wieder gesund nach Hause zu bringen. Wenn uns ein gütiges Geschick der drohenden Gefahr von Seuchen entgehen läßt, ist dies bei dem größten Teil möglich, wenn sie selber nur durchhalten wollen. Hier können Sie als Seelsorger uns Ärzten entscheidend helfen. Keine Macht der Welt hat auf die Herzen dei Menschen einen größeren Einfluß als die Religion. Ich habe in meiner langjährigen ärztlichen Praxis festgestellt, daß Menschen mit einem geordneten Seelenleben, die klar um ein „Wozu“ und „Warum“ wissen, viel leichter gesund bleiben und wieder gesund werden als andere. Ich begrüße deshalb die Aufnahme seelsorglicher Betreuung vom Standpunkt des Arztes auf das wärmste!“
Die Seelsorge begann. Für jedes der 24, allerdings nicht immer belegten, Teillager wurde ein „Pfarrer“ und ein Helfer bestimmt. Der einzige „Meßkoffer“ des Militärpfarrers wanderte in einem bestimmten Turnus durch die Lager, so daß jedes alle vier bis fünf Tage zu einer Meßfeier mit Gelegenheit zur hl. Kommunion kam. Alles war ungeheuer vom Wetter abhängig. Starker Wind blies die Partikel von der Patene, richtiger Regen machte alles unmöglich, denn es stand uns nur der weite Dom zur Verfügung, den Gott selber mit seinem Himmel überdacht hat.
Unnötig- ist es wohl, darauf hinzuweisen, welche Schwierigkeiten die Beschaffung von Hostien, Meßwein, Bibeln und Meßtexten machte. Denn auch die Priester durften über den „Stacheldraht“ nicht hinaus, bekamen aber bald die Freizügigkeit zugebilligt, alle Teillager zu betreten. Alles war unendlich primitiv. Der Seelsorger trug ebenso seine zerschlissene Landsertracht wie der Kamerad, der mit ihm bis zur Stunde im gleichen Loch lag. Er war ebenso ausgehungert und den tausend Menschlichkeiten des Lagerlebens unterworfen. In einem höheren Sinn war es gut so. Es bestand keine Gefahr des „Allzu Salbungsvollen“. Es hätte hier auch nicht gewirkt. Der Priester war hier wirklich ein „Mensch unter Menschen“, wie ihn Franz Herwig in seinem „St. Sebastian“ einmal gefordert hatte. Er besaß keine Sonderrechte und wollte keine erwerben. Tatsächlich waren die Seelsorger trotz manchem anderen Wunsch unter den Letzten, die das Lager verließen.
So aber sah es beispielsweise in „Cam-paund 10“ aus: Wir gruben uns etwa 50 Meter vor der Masse der Soldaten ein neues „Loch“, in dem sich auch eine „Bank“ aus Erde befand. Darüber spannten wir unsere einzige Zeltbahn. Das war nun „Pfarrhaus“, Beichtstuhl und Aussprachezimmer.
Rings um dieses „Loch“ versammelten sich die Männer zu den religiösen Veranstaltungen. Es waren immer 200, aber oft auch 300 und mehr. Bei schlechtem Wetter standen, bei gutem Wetter lagerten sie in der Runde. Man konnte an die Bergpredigt denken. Alles war so ärmlich, und doch fühlten wir uns reich. Die Pose galt nichts, die Haltung war alles. An Materiellem fehlte es durchaus. Da gab es weder Kerzen, noch Blumen, weder Weihrauch noch Gewänder, keine Bilder und Symbole. Der Geist war es, der alles lebendig machte.
Die „Propaganda fidei“ ging ihre eigenen Wege. Kleine Zettel hingen an der Anschlagtafel der Lagerleitung und gaben Kunde. Oft ging zehn Minuten vor der Feier der Seelsorger noch durch das Gewimmel des Lagers, legte die Hand als Sprachrohr an den Mund und lud an den verschiedensten. Ecken zum Gottesdienst. Es war wirklich ein „auf die Straßen und an die Zäune Gehen“.
Man fand aber auch keinen Spott. Die einen kamen, die anderen blieben fern, niemand störte. Manch einer, der aus seinem Dämmerzustand aufwachte mit der begreiflichen Frage „Gibts was zu essen?“, begann zu verstehen, daß nach Christi Wort der Mensch vom Brot allein nicht lebt.
Den ganzen Tag über war Gelegenheit zur Beichte und Aussprache. Viele kamen und es war herrlich, die guten Vorsätze für das Nachhausekommen zu hören und zu bestärken. Auch religiöse „Heimkehrer“ gab es und sie fanden die Aufnahme, die ein „verlorener Sohn“ nach der Weisung des Meisters immer finden muß.
Abends vereinte uns täglich eine Maiandacht, ein Ausspracheabend, eine Bibelrunde und immer schlössen wir ab mit einem Abendgebet aus dem Geist der Kirche. Erklang dann unser „Gute-Nacht-Lied“, so funkelten schon die ersten Sterne am Himmel und aus den Nachbarabschnitten kam das Echo eines anderen Liedes zurück. Oft ging es, besonders an schönen Abenden im Mai, wie ein Wettsingen durch das Lager. In zehn und mehr Teillagern hatten sich Soldaten zur Huldigung an die Maienkönigin versammelt.
War an Sonntagen aus Mangel an den kirchlichen Geräten keine eucharistische Feier, so vereinte uns eine liturgische Morgenandacht. Für die Theologiestudenten wurden Vorlesungen improvisiert, die Seelsorger kamen zu wöchentlichen Besprechungen zusammen und es gelang auch Kreise zu bilden, in denen Küstler, Journalisten, Ärzte, Schriftsteller, Wirtschafter, Akademiker zu fruchtbaren Aussprachen über die tieferen Dinge des Seins sich mit den Theologen zusammenfanden.
Schön wäre es, wenn es gelänge, auch jenseits des Stacheldrahtes solche Zusammenkünfte zu ermöglichen. Wieviel an Vorurteilen könnte abgetragen werden. Man würde sich näherkommen und manch fruchtbare Zusammenarbeit wäre möglich. Das, was trennt, sind doch zum größten Teil — Menschlichkeiten.
Aus den ewigen Quellen, die uns Christus eröffnet hat, fließt wirkliches Leben, das froh macht. Die Not des Vaterlandes verweist gebieterisch darauf, stärker und tiefer aus den geistigen Brunnen zu schöpfen. Denn das wahre Glück ist etwas „tief innen“.
Mit den Protestanten vereinte uns in Wahrheit ein brüderliches Band. Unter den evangelischen Seelsorgern waren wunderbare Menschen. Wir durften ihre Christusliebe, ihre strenge Bindung an die Schrift und die Kenntnis darin, ihren reichen Liederschatz oft bewundern. Sie beneideten uns um die Liturgie und die kirchliche Einheit. Ihre Gottesdienste waren sehr gut besucht. Viele Wünsche, besonders junger Menschen, nach der Wiedervereinigung wurden laut. Den Vorsatz, nie mehr gegeneinander, aber so viel nur möglich miteinander zu aibeiten, haben wir alle mit nach Hause genommen.
Die Kranken wurden nicht vergessen. Gottesdienste und Vorträge in den Sanitätszelten fanden stets besonders dankbare Teilnehmer. Hauptrevicr und Lazarett hatten ihre besonderen Seelsorger. Die Sterbenden erhielten die Tröstungen des Glauben. Die Toten kirchlidi zu begraben, war leider nicht möglich. Durch private Aufzeidinung der Adressen und spätere, nach der Entlassung mögliche Verständigung versuchten die Seelsorger die Benadirichtigung der Angehörigen auf alle Fälle sicherzustellen.
• Die Gefangensdnaft war ohne Zweifel für alle hart. Aber sie hatte auch ihre Kehrseite: Ganz am Grund aller Sorge und Not, allen Schlamms und Drecks lag Gold, wertvolles Gold der Seele. Da wir eng in den Erdlöchern zusammen hausten, galt Geld, Ansehen, Stand nidits. Die Seele lag gleichsam nackt da, der Charakter entschied über den Wert des Mannes. Was haben wir uns nidit alles in stillen, langen Nächten unter den ewigen Sternen erzählt! Wahre Freundschaften wurden geschlossen.
Viele haben sich wieder auf Gott und sich selbst besonnen und ihr Leben einer Revision unter dem Gesichtspunkt des Wesentlichen unterzogen. Manche haben aus weiter Ferne zu ihrem Glauben zurückgefunden.
Freunde, vergeßt die Zeit nicht und was sie uns lehrte! Gott hat im Elend an unser Herz geklopft und uns gezeigt, daß über dieser bitteren Vergänglichkeit seine ewige Herrlichkeit steht, zu der jeder berufen ist, der einen guten Willen hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!