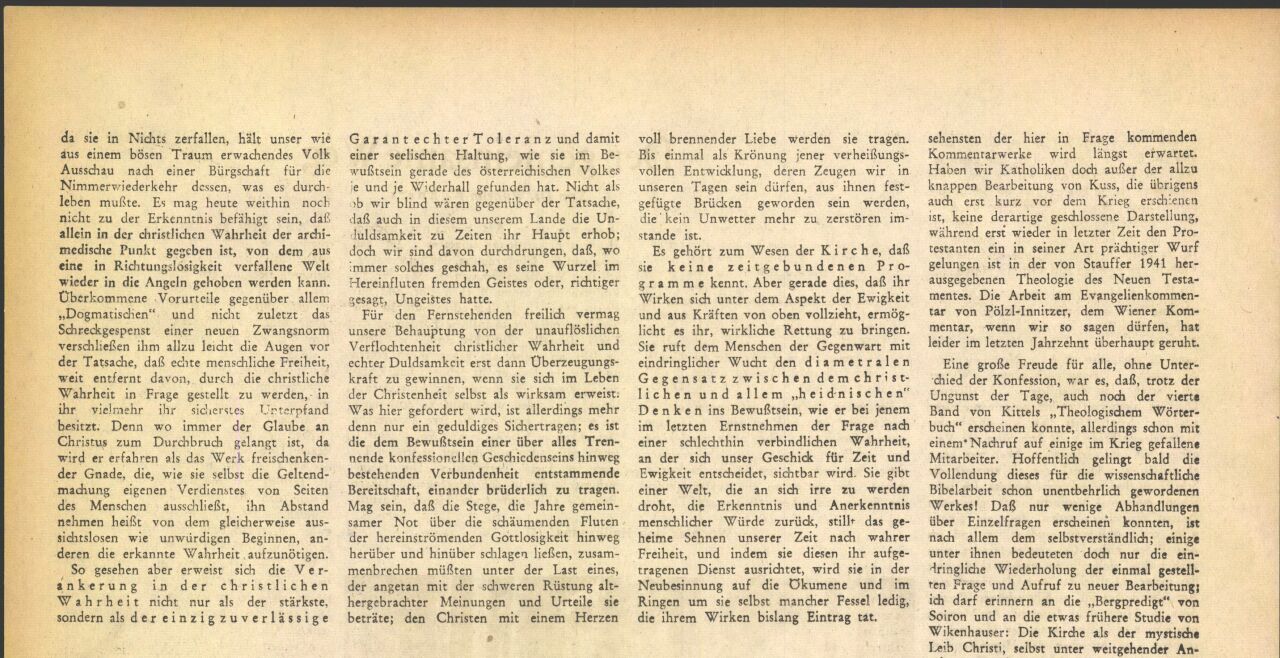
In unseren Tagen hat manche Bücher und Schriften verdientes Schicksal ereilt. Plötzlich suchte man sie wieder loszuwerden, nachdem \nan sich mit ihnen innerlich nie auseinandergesetzt hatte; und so landeten sie über Nacht aus den schönsten Bücherschränken heraus auf dem Kehricht- und Trümmerhaufen unserer Stadt. Das heilige Buch, die Heilige Schrift, von der wir heute reden wollen und auch an solcher Stelle wieder berichten dürfen, hat auch in diesen Tagen, da man sie durch Verleumdung und Verspottung und unter tausend Vorwänden zum Schweigen bringen wollte, nicht aufgehört, das Schicksal der Völker und der einzelnen Herzen richtend und prophezeiend oder tröstend und stärkend zu bestimmen. Nichts hat es von seiner Weisheit, Güte und Schärfe verloren, im Gegenteil! Freilich, nach außen hin ist es diesem Buch fast so wie seinem Meister ergangen, von dem es auf jeder seiner Seiten Zeugnis ablegen will: Er kauerte einst zerschlagenen Leibes, dornen-, gekrönt, die Wunden mit Lumpen bedeckt, inmitten seiner spottenden Henker. Heil dem König der Juden! — gellte es in seinen Ohren und die Schläge prasselten mitleidslos auf ihn nieder. So war auch unser Buch wieder einmal unter die rohen und höhnenden Landsknechte geraten, sein Ehrenname: Heilig wurde zum üblen Spottruf, sein Anspruch, Buch der Bücher zu sein, wurde lächerlich zu machen versucht, aller Glanz und alle Weihe der Jahrhunderte schienen verblichen. — Aber in dieser Entwürdigung und Not war der Weg zur glorreichen Auferstehung schon beschritten.
Bald waren die Vorräte an Texten und Übersetzungen der Bibel vergriffen, an Neuauflagen war natürlich nicht mehr zu denken, und so verschwand sie durch berechnende Böswilligkeit allmählich ganz aus dem Buchhandel. Im Hunger nach der Schrift wurden die ältesten, noch erreichbaren Ausgaben gern gekauft. Wie oft haben Soldaten, Männer und Frauen im Gefängnis, die reifere Jugend in der Fremde und im Lager um eine handliche Bibel gebettelt! Was wurde ihnen dafür alles zugemutet an Literatur und angeblicher Weisheit! Nun kann es wieder anders werden. Fast möchte man meinen, es müßte wieder wie an der Wiege der Buchdruckerkunst sein, daß die Bibel unter den Neuerscheinungen die erste ist. Freilich sind unterdessen die Ansprüche gewachsen. Schon die Sprache der Bibel soll sich von der des Alltags unterscheiden. Rösch, einst mit Recht begeistert begrüßt, weil er in gangbarer Sprache Gottes Wort übersetzte, hat mit der Zeit wieder die Sehnsucht nach der dem Werktag entrückten, feierlich erhabenen Sprache der Schrift geweckt, um die sich noch Gelehrte und Dichter mühen müßten. Schon die Keppler-Bibel in ihrer neuen Bearbeitung durch P. Ketter sucht hier entgegenzukommen. Dillersberger hat unsere Forderung laut erhoben, ohne schon mit seinen eigenen Proben vollauf zu befriedigen. Tillmann hat vordem schon mit seinem Versuch die Berechtigung eines solchen Wunsches erwiesen. Beim Alten Testament steht es mit den Übersetzungen nicht so günstig: Neben der bestens eingeführten Übersetzung von Rießler ist die von Henne kaum vollendet, bald von der Ungunst der Zeit überfallen worden und ' noch viel zuwenig verbreitet. Auch die billige K'osterneuburger Bibel war die letzten Jahre nicht mehr zu haben.
In diesen Jahren ist auch in aller Stille Prof. Dr. Nivard Schlögl von uns gegangen. In seinem Nachlaß befand sich eine vollständige deutsche und eine lateinische Übersetzung der heiligen Schriften. Allerlei Verdächtiges oder Ausschrotbares im Testament witternd, stürzte sich die Gestapo sofort darauf und wir können nur hoffen, daß dieses gelehrte Lebenswerk rieht in den allgemeinen Zusammenbruch mitgerissen wurde. Viel wäre damit bei aller Einseitigkeit Schlögls verlorengegangen, war er doch ein Meister in seiner Wissenschaft, im Empfinden für Sprac'.e und Rhythmus, dazu persönlich fromm und lauter bei allem Temperament: Uns immer wie eine neue Verkörperung des Dürerschen „Hieronymus im Gehäuse“ mit dem Löwen zu Füßen anmutend.
Nur mühsam setzten sich die vor dem Krieg schon begonnenen Kommentare, die laufenden Erklärungen zur Heiligen Schrift, fort. Am rüstigsten noch schritt der vom Verlag Herder herausgegebene weiter, die Bände nach den Bearbeitern verschieden; bedeutsam zum Beispiel der Johanneskommentar von Lauck. Das von Anfang an gut aufgenommene „Regensburger Neue Testament“ kam nur stockend weiter. 1942 hätte es vollständig vorliegen sollen, doch ist bisher nur die Hälfte der acht angekündigten Bände erschienen. Der „Bonner Bibel“ sind im Rahmen ihrer vierten Auflage unter den wenigen, im Krieg herausgekommenen Fortsetzungen erstmalige Dinge geglückt: Wie die „Biblische Altertumskunde“ von Nötscher und die „Theologie des Alten Testamentes“ von Heinisch. Die Theologie des Neuen Testamentes in diesem ältesten und angesehensten der hier in Frage kommenden Kommentarwerke wird längst erwartet. Haben wir Katholiken doch außer der allzu knappen Bearbeitung von Kuss, die übrigens auch erst kurz vor dem Krieg erschienen ist, keine derartige geschlossene Darstellung, während erst wieder in letzter Zeit den Protestanten ein in seiner Art prächtiger Wurf gelungen ist in der von Stauffer 1941 herausgegebenen Theologie des Neuen Testamentes. Die Arbeit am Evangelienkommentar von Pölzl-Innitzer, dem Wiener Kommentar, wenn wir so sagen dürfen, hat leider im letzten Jahrzehnt überhaupt geruht.
Eine große Freude für alle, ohne Unter-chied der Konfession, war es, daß, trotz der Ungunst der Tage, auch noch der vierte Band von Kittels „Theologischem Wörterbuch“ erscheinen konnte, allerdings schon mit einem“ Nachruf auf einige im Krieg gefallene Mitarbeiter. Hoffentlich gelingt bald die Vollendung dieses für die wissenschaftliche Bibelarbeit schon unentbehrlich gewordenen Werkes! Daß nur wenige Abhandlungen über Einzelfragen erscheinen konnten, ist nach allem dem selbstverständlich; einige unter ihnen bedeuteten doch nur die eindringliche Wiederholung der einmal gestellten Frage und Aufruf zu neuer Bearbeitung; ich darf erinnern an die „Bergpredigt“ von Soiron und an die etwas frühere Studie von Wikenhauser: Die Kirche als der mystisch Leib Christi, selbst unter weitgehender Anerkennung der positiven Leistung. Neben dieser systematischen Arbeit wurde auch manch tapfere Lanze von Protestanten und Katholiken geworfen, um die Angriffe des Tages abzuwehren. Nicht immer fanden diese wissenschaftlichen und leidenschaftslosen Feststellungen ebensolche Aufnahme, sondern Gewalt und Verleumdung traf dafür diese angeblichen Dunkelmänner als Antwort. Ahnlich ging es den Männern, die sich nicht damit begnügten, die Wege von der wissensdiaftlich erklärten Schrift zum heiß und blutvoll pulsierenden Leben der Gegenwart nur vorzubereiten und anzudeuten, sondern sie mit Freimut aufzeigten und offen hinwiesen auf den Widerspruch zwischen den Forderungen des Wortes Gottes und der Machthaber dieser Welt: Waren es nun Lehrer oder Prediger. Für viele führe ich Günther Dehn an, der einige Bändchen in der „Urchristlichen Botschaft“ übernahm, einer Kommentarreihe, wie sie handlich, gegenwartsoffen, glutvoll und doch wissenschaftlich uns Katholiken leider noch fehlt. Die notwendige Widerlegung der täglichen Anwürfe und Verdächtigungen gegen dieses heilige Buch kam über die Wissenschaft, da sie selbst sich, freilich reichlich spät, mit allen Mitteln an die Erforschung des zeitgenössischen Judentums und seines Einflusses auf das Neue Testament machte. Wie billig hätten es sich noch einige Jahre früher viele Gelehrte gemacht, da sie so eine Fragestellung überhaupt weitgehend ablehnten und vielmehr der Ansicht waren, nicht das Judentum, sondern die hellenistische oder gar die klassisch antike Welt hätte auf Sprache, Vorstellungswelt und Denken der Schrift den bestimmenden Einfluß genommen, sie seien ihr Mutterboden. Eine Art abschließender Abrechnung, in dieser Partie fast schon epilogartig anmutend, sind die Bücher von Prümm, gekrönt von der positiven Darlegung in seinem Religionsgeschichtlichen Handbuch, das unter vielen Mühen 1943 bei Herder erschien und doch nicht erschien, da es im Inland nicht zu haben war.
Einem Bericht wie diesem hier ist nur die menschliche Arbeit, das wissenschaftliche Mühen um das Wort Gottes zugänglidi, was dieses selbst von Herz zu Herz gewirkt hat, muß sich jeder Berechnung entziehen. Wir sind aber überzeugt, daß die eben vergehenden harten Jahre den Adter der Seelen zu fruchtbarer Aufnahme des Evangeliums viel mehr bereitet haben als andere bequemere und faulere. Das Wort Gottes war auch in diesen Tagen nicht gebunden, der Hunger nach der Schrift ist nur gewachsen. Aber auch für die forschende Arbeit an der Bibel sind wir voll Zuversicht, daß in diesen Jahren der Behinderung und Bedrängung der Weg zu neuer Blüte schon beschritten wurde. Es wächst viel Brot zur Wintersnacht! Was wissen wir auch in dieser Hinsicht von den Begegnungen des Buches der Bücher! Wie viele Herzen hat es entzündet, wie viele Köpfe bewegt! Vielleicht ist der Dichter schon unter uns, dessen Sprache in Leid und Not geformt uns die Bibel neu schenkt in weihevoll frommer Übersetzung. Manche Frucht ernster Forschung wird jetzt an die Öffentlichkeit drängen, gereift in einsamen Jahren aufgezwungener Muße. Sicher hat den einen oder anderen unter uns eigenes oder de Volkes Schicksal tiefer, gläubiger und damit auch hellsichtiger werden lassen für den unergründlichen, für den Heiligen Geist, der hinter dem Buchstaben der Schrift lebt
Tante Frieda hatte schon mehrmals zum Fenster hinausgesehen, als erwarte sie jemanden. Tante Rosa meinte etwas spöttisch, ob sie den Gast, den sie geladen hätte, nicht erwarten könne. Die allgemeine Aufmerksamkeit wurde jedoch bald wieder auf ein anderes gelenkt; die Torte wurde hereingetragen, die bräunliche, zarte Torte .aus Nüssen, die dottergelbe Fülle quoll an den Rändern herab, und als hohe Wölbung gupfte sich flimmernd der zuckerbestreute Obersschaum. Peter brachte einen neuen Krug, er goß in neue Gläser einen Saft, der honigfarben in sie floß, das würzige, das süße Getränk, den heimtückischen Met. Gerade, als es unter dem behaglichen Zuschauen aller zum Anschnitt der Torte kommen sollte, kam der Gast, eigentlich die Gastin. Sie war eine Frau mit weißen Haaren, aber ihr Gesicht war glatt, wie mit Mehl überstäubt. Das machten nicht etwa die Künste, die sie den Frauen der großen Welt nachgeahmt hatte, es war ihr inneres Wesen, ihre quirlende Lebhaftigkeit, die sie falten-los erhielt. Es war das, was sie zwanghaft bestimmt hatte, die Theatermutter der Liebhaberbühne des Ortes zu sein. Es war das, was sie bestimmte, zu den Verwandten zu treten, als bestiege sie eine Bühne, wie jede Lebensphase fü sie nur eine andere Bühne bedeuten mochte. Johann erfuhr, daß sie mit Altertümern aus dem Lande ihren Handel treibe. Daß es deshalb bei ihr zu Hause auch aussehe, als wäre die Wohnung eingerichtet, Theaterstücke mit ländlichem Hausrat zu versehen. Da stünden Kasten und Truhen und Stühle die Reihe, und alle wären bunt und mit starken Farben fast verwirrend und verschnörkelt bemalt, daß man sich wundere, wie sie endlich doch wieder in einen sinnvollen Zusammenklang aufgelöst erschienen. Da stünden Glasschränke mit ahnenalten Figurinen, Rubingläsern, Tauftalern, würdigem und nichtigerem Tand dahinter. Und die Frau selbst eine immer Bestrebte, durch Einkauf, Abtausch und Verkauf neue Lichter und Schatten in der Wohnung zu schaffen, ihr neue Farben aufzusetzen. So schilderte Tante Frieda den außerverwandtschaftlichen Gast: Theatermutter und Altertumshändlerin.
Diese stürzte sich mit ihrer Lebendigkeit in das Gerede und ließ sie auch, der Verwandtschaft nichts nachgebend, an der nun schon aufgeteilten Torte nicht vermissen. Der tückische Met tat das seine. Die Gespräche, die sich mit der Fülle des Mahls verlangsamt hatten, nahmen an Schwung wieder zu. Johann erkundigte sich, welche Spiele denn die Frau geleitet habe. Er mußte zu seinem Erstaunen sich erzählen lassen, daß ihre Vorliebe jenen Spielen gelte, die menschliche Leidenschaften deutlich machen, ohne daß der Sieg des Guten unbedingt gesichert sein müsse, wie denn auch das Leben diesen Sieg nicht immer zeige. Noch mehr erstaunte Johann, als er erfuhr, daß Teile seiner Verwandtschaft hervorragende Mitglieder der von ihr geleiteten Bühne gewesen waren; sein Vetter Peter war erster Liebhaber, und bei der Erinnerung daran lachte er noch breit und nicht ganz ohne Stolz über die gewaltigen Erfolge, die er davongetragen hatte; Maria aber, keine Geringere als seine blonde Kusine, hatte seine holde Liebste gespielt, und es soll nach den Auffuhrungen mannigfach versucht worden sein, ihr Anträge auf Liebe und Ehe nahezubringen. Karl, der Hochzeiter, lächelte nicht wenig geschmeichelt, als so kundgetan wurde, wen er sich heimgeholt hatte. Aber auch Emma hatte Teil am Spiel, und es war ihre verruchte Aufgabe gewesen, den Versuch anzulegen, Peter trotz seiner männlichen und sittlichen Stärke zum Straucheln zu bringen und ihn so ihrer Gegenspielerin, die doch dabei ihre Schwester war, wegzulocken. Alle übrige Verwandtschaft hatte aber nicht etwa am Theater keinen Teil, denn hatte sie ihn auch nur als Zuschauer, so fühlte sie sich doch dergestalt angerührt von den Geschehnissen, denen ihre Lieben auf den alles bedeutenden Brettern ausgesetzt waren, daß es ihnen war, als säßen sie nicht unten, sondern agierten selbst oben mit Fleisch und Blut. Seht an, welche Szene die Theatermutter zu entfalten verstand. Aber sie hatte auch andere Töne.
Ihr waren nämlich Johanns schon früh verstorbene Eltern bekannt gewesen. So hatte sie auch ihn bereits im Alter des Schulknaben Hans kennengelernt. Wie sie nun, die zu spüren gewöhnt war, ob ein Publikum zuhöre, Johann aufhorchen fühlte, begann sie ihm seine Eltern vorzuzeichnen, an deren Leiblichkeit und Wesen er sich nicht mehr erinnerte. Sie erzählte in ihrer Lebhaftigkeit und lebendigmachenden Art so anschaulich, daß Johann seine Eltern förmlich am Tisch sitzen spürte. Nicht als Schemen waren sie plötzlich zur Tafel geladen, er sah sie bei sich sitzen am Tisch, den kräftigen, aber zarten Vater mit dem blonden Schnurrbart und dem immer bereiten Lächeln darunter. Und seine Mutter saß mit am Tisch, die so dunkle Brauen und Wimpern hatte, daß ihre himmelshellen Augen dunkel und schwermütig wirkten. So saßen die beiden im Gemüt Auferweckten, der Vater mit dem unsicheren und die Mutter mit dem wehmütigen Lächeln, saßen bei der Hochzeit und sahen auf ihren Sohn, den sie auch einmal in einer Hochzeit gezeugt hatten. Johann erfaßte eine Art unirdischer Freude, daß seine Eltern so gern gemochte Leute gewesen sein-mußten, daß, sie nach fast einem Menschenalter ihres Wegganges noch so diesseitig von einer Frau, die sie nichts weiter als gut gekannt hatte, empfunden wurden.
So hatte die Theatermutter, zwischen Spiel und Wirklichkeit schwankend, das Spiel mit den Erinnerungen fast zur bluthaften Wirklichkeit gesteigert. Und sie wußte das erweckte Sein wieder in den Schein zuriickzudämmen, indem sie sich an das Kleinste wandte. Sie fragte plötzlich den offenen Munds auf sie starrenden Jörg, ob er das Spiel mit den Fingern noch könne, das sie ihn neulich gelehrt habe. Aber JSrg, der sonst so I aute, machte nur übergroße Augen. Die Schläfrigkeit hatte ihn überkommen und sie so geweitet. Er hatte sich seinen Schlaf durch weidlichen Zuspruch beim Mahl auch verdient. Seine Mutter, die Josefine, nahm ihn bündig an sich, ihm keine Zeit zu Widerspruch und Geraunz lassend, um ihn ins Bett zu schaffen. Diesen Abgang nützte auch die gewandte Frau des Theaters. Leider könne sie nicht länger bleiben, eine Kunde warte, die einen Eichentisch mit klobigen Füßen kaufen wolle und vielleicht einen buntbemalten Kasten, der ihr seit langem gefiele. Das alles wolle jene sich noch heute näher ansehen. So' gerne sie bliebe, das heute noch winkende Geschäft könnte die allerorts Riegelsame nicht fahren lassen. Sie verstand ihren Abgang, sie verstand das rasche Händeschütteln, und die Verwandtschaft war wieder für sich.
Der Nachmittag war nicht lichter, aber immer blauer geworden. Nicht gerade, daß der Himmel sich aufgetan hätte, noch immer bedeckte ihn das gleichmäßige Grau der Wolken. Aber die Schichte lag nur mehr wie ein Schleier vor ihm, ihn in dieser Ahn-barkeit noch himmlischer machend. Der Vetter von der Stadt wollte das bläuliche Licht in der Stube haben. Er ging zum Vorhang und schob ihn zurück. Da fiel der Nachmittag in die Herzen der Hochzeitsgäste recht eigentlich hinein. Und noch eines begann geradezu unmittelbar im Herzen Johanns zu ruhen. Als er den Vorhang auftat, fiel sein erster Blick auf den Berg seiner Heimat. Es war ihm, als ob auch ein letzter Vorhang, den sich sein jahrlanges Heimweh schützend vorgelegt hatte, wie ein Nebel zerfiele. Der Berg der Heimat lag da wie ein seit Jahrhunderten ruhendes mächtiges Tier, von einem Gott hiehergesetzt, um diese sehr schöne Landschaft am Eingang zu ihrer Bergwelt und am Rande ihrer welligen Ebenen als stummer, aber gewaltiger Wächter zu behüten. Und Johanns Herz hatte Raum, den Riesen bei sich zu bewahren, und er verließ ihn lange nicht mehr.
So war es denn etwas still geworden. Da meinten sie, daß man sich eines singen und sich so die Zeit angenehm machen müsse. Sie hatten eine Laute vorbereitet, damit der Vetter von der Stadt ihren Gesang begleiten und das Instrument wieder spielen könne, das er schon als sehr Junger geschlagen hatte. Johann nahm das ihm liebe Instrument zur Hand, er strich die Saiten, er konnte es noch, das Instrument klang voll und schön wie in früheren Tagen. So hub man denn an. Die Verwandtschaft sang die Weisen, die ihr aus dem Lande zugekommen und ihr von Kind her ein sicherer Besitz geblieben waren. Dann aber mußte Johann eines allein spielen. Was er eben wolle. Was er ihnen allen gern vermeine.
So spielte er zag, aber mit fühlsamem Herzen, auf seiner Laute in einer schlichten Weise das Scherzo aus Bruckners Romantischer Symphonie. Lacht nicht über des Vetters armselige Art, die große Weise in ein einsam kleines Instrument zurückzubil-den. Denn vom einfältigen Volkslied dieser Landschaft bis zum tönenden Werk des großen Meisters spann sich für den Spieler dieser Stunde jener selbe unsichtbare, aber ununterbrockene Faden, den ein anderer armer Spielmann vom Wortwechsel weinerhitzter Karrenschieber bis zum Zwist der Göttersöhne sich spinnen sah. Hört ihn an, den in die große Weise versonnenen Vetter, und hört die Herren und Knechte ihren Ländler stampfen und spürt, wie der Wintertag den Zuhörenden entschwebt und sich in einen sommerlichen sonnigen Sonntagnachmittag, der sich breit über das Land lagert, wandelt. Über die hohen Kornfelder scheint sich ein fülliger, aber anmutiger Wind hinzuspielen, aber es ist die innere Weise des Landes, welche die Felder wiegen macht. Es ist die innere Süße des Landes, die sich ausspielt im Wind und in den sattriechenden Lüften, und sie spielt hinauf zu den Himmeln, die mit ihren Gesängen die irdisch-unvergängliche Weise aufgerufen und zu sich hinangezogen haben. Unvergängliche Weise, sie wird immer wieder spielen, wenn auch alle reichen Kornfelder längst schon abgetragen haben! Der Vetter von der Stadt ließ ausklingen, weckte sich aus seinem Traum, sah auf und lächelte. Er war wehmütig und glücklich zugleich, denn er sah sein Lächeln auf den Zügen der Verwandten sich widerspiegeln.




































































































