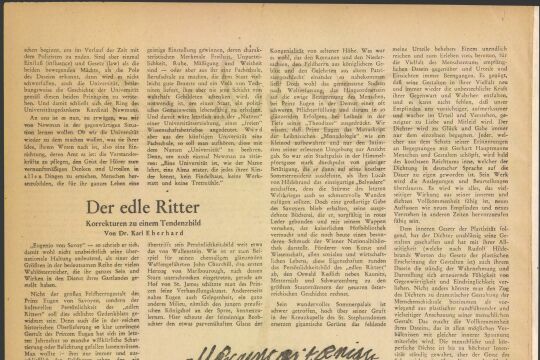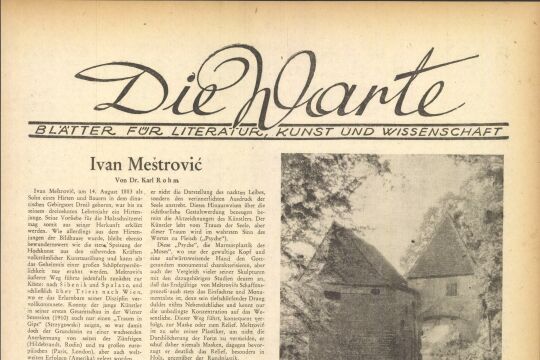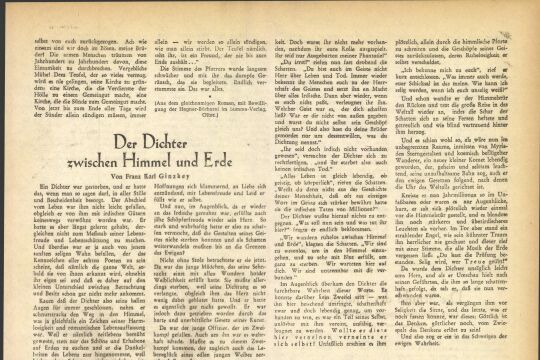FORMEN UND GESTALTEN
Vor zwanzig Jahren, im Herbst 1945, starb der österreichische Dichter Richard Beer-Hofmann. Ihm widmete der langjährige Chefdramaturg des Burgtheaters Erhard Buschbeck diesen Nachruf. Seine Veröffentlichung an dieser Stelle, wo Erhard Buschbeck wiederholt zu Wart gekommen ist, möge unsere Leser daran erinnern, dafj auch der Todestag von Buschbeck sich in diesem Herbst, und zwar zum fünftenmal, jährt.
Vor zwanzig Jahren, im Herbst 1945, starb der österreichische Dichter Richard Beer-Hofmann. Ihm widmete der langjährige Chefdramaturg des Burgtheaters Erhard Buschbeck diesen Nachruf. Seine Veröffentlichung an dieser Stelle, wo Erhard Buschbeck wiederholt zu Wart gekommen ist, möge unsere Leser daran erinnern, dafj auch der Todestag von Buschbeck sich in diesem Herbst, und zwar zum fünftenmal, jährt.
In der beklagenswerten Ferne eines unfreiwilligen Exils wie in der ehrwürdigeren Entfernung seines Patriarchenalters hat der Wiener Dichter Richard Beer-Hofmann von uns Abschied genommen, der der letzte Vertreter jenes „Jung-Wien“ gewesen ist, das mit Hermann Bahr im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts angetreten war und so bekannte Namen wie Hugo von Hofmannsthal und Arthur Schnitzler zu seinen Repräsentanten zählte. Richard Beer-Hofmanns dichterisches Bekenntnis, in wenigen Werken von hohem Rang verdichtet, wie seine Tätigkeit als Regisseur — es sei hier nur an den Abend beider Teile des „Faust“ im Burgtheater und an die „Iphigenie“ des Theaters in der Josefstadt erinnert — haben ihn zu einem Mahner an die hohen Aufgaben eines dichterischen Theaters gemacht und legen uns die Verpflichtung auf, seines hinterlassenen Werkes dankbar zu gedenken.
Es ist gerade um die Jahrhundertwende gewesen, daß das erste Buch erschien, das den Namen Richard Beer-Hofmann bekannt machte. „Der Tod Georgs“ war sein Titel, der Autor hatte seine Gattung nicht näher bezeichnet, doch mochte man es immerhin eine Erzählung nennen. Sie war von so eigener Art, daß sie den Dichter zunächst in den Ruf eines Ästheten brachte, man meinte dies in einem abfälligen Sinn und stellte sich darunter eine gewisse Selbstgefälligkeit eines für sich Geschaffenen vor. Wenn man jetzt aus der Rückschau über das nachgekommene Werk Richard Beer-Hofmanns wieder an dieses alte Buch gerät, darf man wohl sagen, daß es mannigfach verkannt worden ist. Ja, Ästhetizismus, wenn man ihn wörtlich nimmt, mag es nicht einmal ganz unrichtig sein, denn es spricht eine Liebe zur Schönheit aus diesen Blättern, die ungewöhnlich ist, eine Liebe zur Schönheit des Worts, zum Strömen der Rede, aber auch Besessenheit von schönen Träumen und einem Reichtum der Vorstellungen, wie er dem Menschen auch in den wacheren Stunden eignet. Dieses Buch, das nichts anderes wiedergibt als Gedanken und Träume eines jungen Mannes in einer Nacht im Sommer, während sein Freund im Nebenzimmer eines ganz unvorbereiteten Todes stirbt, und wieder Gedanken und Träume, die ihn aus der durch diesen Tod verursachten Verwirrung herausführen. Von der Person, der dieses zugeschrieben wird, sagt der Autor einmal: „Geschehenes war für ihn nicht mehr gewesen als etwas, was ihn träumen ließ oder die Erinnerung an längst Geträumtes in ihm weckte.“ Und von der Abendstunde, die ihm die Befreiung bringt, heißt es: „Ein Wort nur hatte sich herabgesenkt, und aller Glanz ging von dem einen aus: Gerechtigkeit.“ Und weiter noch: „Ein jedes das Gesetz erfüllend, das ihm vorgeschrieben, das in seinem Samen schlief, keimend erwachte, unerkannt sein tiefster Wille war, und erkannt die Vollendung einer Schönheit.“ Was hier beschrieben wird, ist die Erlösung eines Menschen, der sich den Gesetzen beugt, unter denen er angetreten ist, und von dem damit Lust und Hölle seiner Ichwelt abfällt. Also ungefähr das Gegenteil von dem, was man aus dem Buche herauszulesen glaubte. Daß es in der Hochblüte der naturalistischen Erzählung und zwischen den geläufig gewordenen Handfertigkeiten eines psychologischen Materialismus fremd angemutet hat, ist gleichwohl nicht unbegreiflich, machte es doch die lange unterdrückten Kräfte der Phantasie, die in anderen Formen schon manchen Dichter wieder entführt hatten, zum erstenmal auch einer Prosaarbeit dienstbar.
Es gehört zum Merkwürdigsten, daß in diesem ersten Werk Richard Beer-Hofmanns schon alle Gedanken, Schicksalsbindungen und Lösungen in Sätzen enthalten oder doch angedeutet sind, die den späteren Dichtungen die Prägung gegeben haben. Sie hatten sich nur für diese Erzählung in solcher Fülle eingestellt, daß sie künstlerisch lediglich als Fläche erscheinen konnten. Erlebnisse von der Weite der aufgetanen Seele und tiefen Erschütterungen schmückten gleichsam eine Wand, und die Kostbarkeit des verwendeten Materials konnte nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich ein Raum, der Leben bergen sollte, nicht schloß. Das muß der Dichter sehr stark und schmerzlich gespürt haben, denn er wandte sich von da an fast ausschließlich der Form zu, die die Gefahr einer Flächenwirkung am sichersten bannen konnte, dem Drama. Das Gegeneinanderspielen von Gestalten führte den Dichter in die erstrebte Tiefe, die Fülle der Gesichte fand ihre natürliche Grenze in Menschen, die voneinander zu unterscheiden waren, das Wort eroberte den Raum, weil es von Lippen gesprochen werden sollte, denen ein eigenes Maß zugemessen war. Die Einordnung unter ein dramatisches Geschehen mochte der Dichter damals als wohltätigen Zwang empfinden, und der erste Prosaversuch hatte ihn mit innerer Notwendigkeit zum Dramatiker gemacht.
Das Stück, mit dem er erfolgreich das Theater betrat, hieß „Der Graf von Charolais“ und hatte als Unterlage ein altenglisches Trauerspiel der Massinger und Field. Von ihm war nicht viel übrig geblieben, und die Verse, in denen es voll dahinströmte, gaben dem ziemlich dürren Gerippe von einst ein seltsam blühendes Leben, stolze Worte funkelten auf und schmerzlich erregtes Wissen um die Dinge. Tag und Nacht der Seele waren darin fast rembrandtisch verteilt und das Ganze nicht minder stark gesehen als ins Ohr gesprochen. Für die Gestalten war bewußt oder unbewußt noch ein anderer Halt, ein natürlich begrenzendes Maß in Anspruch genommen, die Persönlichkeit der großen Schauspieler, die den Dichter von der geliebten Bühne herab wesenhaft beeindruckt hatten, was das Stück nebenbei auch zu einem schönen dichterischen Denkmal des Burgtheaters der Jahrhundertwende hat werden lassen. Hinter der edlen Gestalt des Präsidenten stand sichtlich Sonnenthal, Kainzens knabenhafte Prinzen sprachen aus dem Charolais, sein Sprachgenie schien das glühende Denken dieser erschütternden Figur zu durchdringen, ja selbst die angegebene Betonung machte die merkwürdigen Sprünge mit, die er über fallengelassene Sätze so gerne zu dem einen Wort nahm, das dann gelten mußte. Die keusche Blüte, hinter der unbegreiflich die Gefahr lauerte, trug das romantische Lächeln der Hohenfels, und da wie dort gespensterte ein Mitterwurzerscher Mensch über die Bühne.
Diese Mitwirkung von schauspielerischem Talent an Stücken ist stets ein ungemeiner Vorteil für die Literatur gewesen und traf hier einen Dichter, der sie voll aufzugreifen und zu ergründen verstand. Es gehörte dann zu den Unbegreiflichkeiten des Theaterschicksals, daß gerade die Bühne, die ein solches Geschenk, Ausprägung der eigenen Art, empfangen hatte, das Burgtheater, daran vorbeiging und das Drama hier unter Direktor Paulsen erst aufgeführt wurde, als die daran beteiligten Künstler längst dahingegangen waren. Daß sie in der inneren Werkstatt des Dichters mit dem, was sie waren, anwesend gewesen sind, ist aber für nichts anderes zu halten als eine Veredlung des Materials, ein geistiger Impfstoff, der die Natürlichkeit des künstlerischen Lebens der erzeugten Gestalten erst ganz frei sich enwickeln ließ. — Im wesentlichen hatte das Stück seinen großen inneren Reiz davon erhalten, daß es sinnfällig die unheimliche Nähe des Chaos zum Ausdruck brachte, dieses ständig nach den Gestalten greifen ließ — und sie ihm in männlich stolzer Haltung begegneten und gegen seine Gefahren wissend bestanden. Das Geschehen war in eine Zeit zerrütteter Moral und wankender Begriffe gestellt, die Einsamkeit, die dadurch nur um so fühlbarer um den einzelnen lag, ließ ihn aber auch stärker als sonst nach Gott fragen. In Ihm bangt er und zu Ihm baute er sich auf, mit den sittlichen Kräf^n, die in ihm zu wirken verlangten, damit er sich gegen die zusammenbrechende Welt behaupten konnte. Diese Kräfte sind es, die das Stück immer wieder erhellen und über seinem tragischen Ablauf den Blick auf die Sterne freigeben. Wohl stehen am Schluß die Fragen da, die keine Antwort finden: „Doch wie es so gekommen, warum's geschah — ja, wer erzählt das mir?“ Charolais bleibt aber trotz dem, was ihm geschehen, mit Gott untrennbar verbunden, das allein gibt ihm die ruhige Demut, die ihn aus dem Stück entläßt und ihm die nur mehr halb gefragten Worte in den Mund legt:
„Es scheint, Er liebt es nicht, wenn man zuviel von Ihm spricht — sei's mit Beten oder Fluchen! Zu Sich'res haßt Er — und ein allzusehr auf Ihn vertrauen — nennt er: Ihn versuchen.“
Nach einem Zeitraum von fast fünfzehn Jahren begegnet uns der Dichter wieder mit dem dramatischen Vorspiel „Jaäkobs Traum“. Was war inzwischen mit ihm geschehen? Die empfindungsgesättigten Strophen von „Mirjams Schlaflied“ tönen selig wie nach einer Heimkehr, die langer Wanderung spät gefolgt ist. Der Europäer war tief hinabgestiegen zu den Quellen seines Blutes, es umrauschten ihn die großen Legenden des Alten Testaments und sein bildsamer Sinn fühlte sich darin wie zu Hause. Was man von Dichtern gerne verlangt hat und unter dem recht weitmaschigen Begriff der Volksverbundenheit verstand, hatte dieser Wiener Dichter, kraft seines Judentums, in aller Stille vollzogen und Jaäkob, der im Traume des zweiten Bildes auf Beth-El mit Gott gerungen hat, nennt sich mit dem letzten Wort des dramatischen Gedichts stolz Iisro-El. Und vor dem Zyklus „Die Historie vom König David“, zu dem dieser Abend nur als Vorspiel gedacht ist, steht die wohl sicher dankerfüllte Widmung „Diis manibus“. Der Gott, an den ein bereites Herz seine Fragen gerichtet hat, gibt nun vielfache Antwort, gibt sie mit Seinen ganzen Heerscharen und auch in dem ewig Verstoßenen, Samäel. Und Er gibt sie dem Juden, enthüllt ihm seine Sendung, in erhabenen wie in harten Worten. In dieser hochgeschwellten Stunde geht es nur um entscheidende Dinge, und der Glanz, der sich niedersenkt, geht auch von der inneren Erleuchtung aus. Es gibt in diesem Vorspiel, das sich in einem kurzen und einem langen Akt scheinbar ungleich aufbaut, keinen Vers, der nicht rein dramatisches Leben hätte. Auch in den idyllischen Szenen — und sie atmen einen geradezu taufrischen biblischen Reiz — wird das Wort nicht lyrisch, es hat immer seinen Anteil an einer menschlichen Auseinandersetzung, die eben nicht nur heroisch, sondern auch von köstlich häuslicher Intimität sein kann. Die Gestalten sind klar geschaut und mit einer Sicherheit hingestellt, die dem Schauspieler dankbare Aufgaben überantwortet. Von der Uraufführung am Burgtheater her erinnern sich vielleicht manche Hörer noch der schönen schauspielerischen Leistungen, voran jene der Bleibtreu als Rebekah. Der beseligte Atem, in dem sie die schließenden Verse des ersten Bildes sprach,
„Vom Rand der Wüste send' ich dich — mein Knabe, nach meiner Jugend seligem Talgrund von Chardn!“ hatte den Lebensatem dieser biblischen Dichtung getroffen, die über die zunächstliegenden Elemente hinaus genug der dichterischen und sittlichen Werte bot, um auf einer Weltbühne ein bedeutendes Dasein zu führen.
Das Schauspiel „Der junge David“, erstes Stück einer Fragment gebliebenen Trilogie, brauchte nach diesem Vorspiel die Frage des Judentums als solche nicht mehr aufzuwerfen. Die große Menschheitsfrage der Berufung, des Erwähltseins eines einzelnen ist unter dem silbern glänzenden Nachthimmel eines heiligen Buches gestellt, Patriarchenluft liegt über Schicksalen, in denen sich Gesetze erfüllen. Das Altersdrama Sauls wird von dem gegen seine Berufung ringenden David gekreuzt und alles Geheimnis der Jugend beschworen. Der Dichter hat den unschuldigen Knabenglanz wie im dreizehnjährigen Abjather oder dem fünfzehnjährigen Zadok so rein und ehrfürchtig gestaltet, wie man Jugend nur vom Alter her zu sehen vermag, und hat über diesen Morgen die abendmüde Gestalt Ruths gestellt, die schon das vierte Geschlecht nach ihr heranwachsen sieht. Zwischen beiden steht David, der die Schwelle überschreitet, wo aus dem ahnungslos dahinstürmenden Jüngling der Mann wird, der seiner Krone sich beugt. Das Wissen, das die Dichtungen Beer-Hofmanns oft mit Schwermut beschattet hat, ist hier wie Ruth ganz zur Erscheinung geworden, es drückt nicht mehr, sondern schwebt wie ein leuchtender Abendsegen über der Welt, in der Kämpfer und Zuschauer in eines verschmolzen sind.
Wenn wir heute des Dichters Beer-Hofmann gedenken, dürfen wir auch das Prosawerk nicht vergessen, das dem Genius unseres Landes gewidmet ist: „Die Gedenkrede auf
Wolfgang Arriade Mozart.“ Wie hier Salzburg, diese österreichischeste Stadt, wie der Zauber seiner Voralpenwelt von Beer-Hofmann in edelster Wortkunst, die Klarheit mit hymnischer Beschwörung wesenhaft verbindet, eingefangen worden ist, das macht diese Rede zu einer der schönsten Prosadichtungen, die der Heimat gewidmet sind.
Es hat in den letzten Jahrzehnten nicht viele Dichter gegeben, die ihrer hohen Aufgabe in solcher Ausschließlichkeit gedient haben, die die sittliche Würde der Dichtung, gar auf dem Theater, mit jedem ihrer Werke befestigt und den Born der Schönheit, der noch immer am längsten fließt, so reich gespeist haben wie Richard Beer-Hofmann. Er hat die Rückkehr in seine Heimat nicht mehr erlebt, in der stets doch zuverlässigeren Heimat unserer Dichtung ist er aber zu Hause geblieben und nimmt in ihr einen Platz ein, der sich auch den härtesten Schicksalsschlägen gewachsen gezeigt hat.