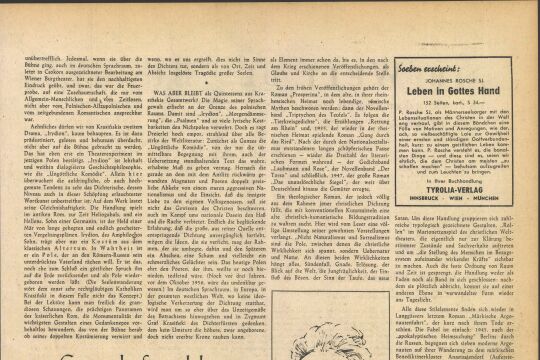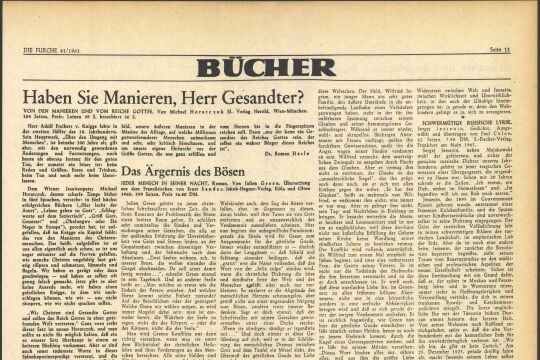Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gestalt aus dem alten Europa
Mein Vater Henry von Heiseier war eine der letzten Gestalten, in denen das alte Europa sich als das darstellt, was es einmal war: eine geistige Wirklichkeit und eine Heimat vieler Völker. Darum, wenn Europa sich wieder auf seine einst so selbstverständlich genossene Gemeinsamkeit besinnt, wird dieser Dichter wieder ins Licht treten. — Er ist als Kind einer deutsch- petersburger Familie in der Stadt, die damals Rußlands Hauptstadt war, am 23. Dezember 1875 geboren. Die Heiselers stammen ursprünglich nicht aus dem Baltikum, sondern wahrscheinlich aus Oldenburg und führen den Stierkopf, das alte Zeichen deutscher Auswanderer, die ins Ostland zogen, im Wappen. Auch von selten der Mutter, einer geborenen Bettzich, ist seine Herkunft deutsch; deutsch war die Sprache des Hauses, wie auch der Schule, die er besuchte, und nie anders als deutsch die Verse, die er schrieb. Der Fluß aber, den sein erstes Gedicht besingt, ist die Newa, die Landschaft Rußlands ist die seiner Kindheit, und wir wissen, wie tief sich das Heimatgefühl mit solchen ersten Erfahrungen von Himmel, Land und Jahreszeiten verbindet.
Daß er so zwischen den beiden Völkern aufwuchs, hat er bis in sein Mannesalter hinein nicht als Not empfinden müssen; vielmehr war es ein Reichtum und ein Glück. Grenzen waren damals noch niqht trennende Mauern, eher so etwas wie schöne Höhenzüge, von denen man weit in die Welt sah, und über der Jugend Heiselers scheint der „Divan”-Spruch zu stehen:
„Gottes ist der Orient! Gottes ist der Okzident! Nord- und südliches Gelände Ruht im Frieden seiner Hände.”
Das Elternhaus, die Petersburger Schule und Universität gaben ihm eine reiche, weltumfassende Bildung mit, in der alten, Rußland mitumfassenden Kultur Europas wohnte er mit freier Sicherheit und durfte an ihren alle Grenzen übergreifenden Zusammenhang glauben. Jung kam er nach Deutschland, in München gründete er sich Haus und Familie und trat in Beziehung zu Stephan George, in dessen „Blättern für die Kunst” seine ersten lyrischen und dramatischen Arbeiten erschienen. Die Verbindung nach Rußland ist damit nicht abgebrochen, Jahr um Jahr ist er in Petersburg bei Eltern und Geschwistern zu Besuch und bleibt mit dem russischen wie dem deutschen geistigen Leben in lebendigstem Kontakt; beiden dient er durch seine meisterhafte Übersetzungskunst, die durch sein ganzes Leben hin zum Wichtigsten seiner Leistung, als eines Mittlers zwischen den Völkern, gehört hat: nicht nur die großen Russen, Puschkin, Turgeniew, Dostojewsky, Ljesskow, Wencelas Iwanow, Ssologub, A. N. Tolstoi — auch die englischen Dichter seiner Epoche, Browning und Swinburne und W. B. Yeats, hat er übersetzt, diese ganze weitgespannte Geisteswelt heimisch machend in dem Land der Mitte, auf dem deutschen Sprachboden. Seit 1905 ist er in Brannenburg im oberbayerischen Inntal angesiedelt, dort erwirbt er das Haus Vorderleiten; es ist die schöne Stelle, wo der Inn aus den Bergen tritt, die Vorberge in die breite, weithin geöffnete Ebene sich verlieren.
„Dann bringt der Wind mit weitgeschweiften Flügeln, Die Klänge aller Fernen an dein Ohr Und trägt zu jenen deutschen Buchenhügeln Den vollen Ton von Moskaus Glockenchor.”
Sehr genau bezeichnet diese Strophe aus einem, etwas späteren Gedicht seine menschlich-geistige Existenz zwischen den Völkern.
Darum traf ihn der Ausbruch des ersten Weltkrieges als etwas Unbegreifliches. An jenem verhängnisvollen 2. August 1914 war er in Petersburg — auf Besuch, um seinen Vater zu begraben. Russischer Untertan war er noch, als solcher zum Dienst im Heer des Zaren verpflichtet, er wujde nicht gefragt, ob er das wollte. Die äußere Entscheidung also war ihm abgenommen, aber einer noch härteren, inneren fand er sich gegenübergestellt. Er sah sich vor der Frage, ob er nach den Jahren, wo er alles Glück, alle reiche Frucht der wechselseitigen Berührung zwischen den Geisteswelten der Völker genossen, jetzt den unseligen Zwiespalt getreulich ausdulden wolle, ohne Fluchtgedanken, ohne Verleugnung seiner schwierigen doppelseitigen Pflicht. Die scheinbare Sinnlosigkeit, daß ihm, dem deutschen Dichter, die soldatische Pflichterfüllung für da Land seiner Geburt zugemutet war, mußte bestanden werden als ein Sinn — aus der vertrauenden Liebe, von der gesagt ist: sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hoffet alles, sie duldet alles. Nachdem dies einmal im Herzen entschieden war, konnte keine Steigerung der Gefahr und des Grauens ihn mehr beirren. Er hat Krieg und Revolution, einen Hungerwinter in Petersburg, den Tod seiner Mutter und seiner Brüder erlebt, ohne darüber bitter und hart zu werden. Seine Pflicht als Offizier war ihm niemals eine bloße Äußerlichkeit und Last, er nahm sie ernst und seine russischen Soldaten liebten ihn. Andererseits durfte und konnte er sich sein Deutschtum nicht verleugnen, vielmehr1 sind es gerade die russischen Dienstjahre, in denen er sich seiner deutschen Abkunft immer tiefer und unbedingter bewußt wird. Seine Haltung scheint darin vorbildlich und heute der Beherzigung besonders wert, nachdem das kranke Geschrei der Übernationalisten (wenigstens in Deutschland) verklungen ist. und nun wieder viele umgekehrt in Gefahr sind, die Bindung an Volk und Vaterland für eine bloße Fiktion anzusehen. Heiselers Europäertum schließt diese Verpflichtung mit ein. In den Jahren der Trennung von Familie, Haus und Heimat war ihm das Bild davon als ein unverlierbares vor der Seele gestanden.
„Vor meinen Blicken tat ein Hang sich auf, Sanft hügelan, und ich vernahm ein Klingen, Vom Brunnen singend eines Wasser Lauf. Da wollt mir das Herz beinah zerspringen.”
Es ist sein Haus Vorderleiten, das er so anruft. Und als er endlich im Herbst 1922 wirklich dorthin zurückkehren durfte, hundertfach gezeichnet und gesegnet von dem Erlebnis schwerer Jahre, als Mensch und als Dichter nun erst ganz zu sich selber befreit und gereift — da war es eine Heimkehr wie jene des Odysseus. Aber seine Gesundheit war durch die Zumutungen der Kriegsjahre erschüttert; sechs Jahre nach dieser Heimkehr ist er in Vorderleiten gestorben.
Das Gewicht seines dichterischen Lebenswerks beruht wesentlich auf dem, was er als Dramatiker geleistet hat. Er hat schöne Gedichte geschrieben, seine Tagebücher und Aufsätze sind eine bedeutsame und beglückend menschliche Geistesbegegnung, seine Übersetzungen sind berühmt, und als Erzähler, in der meisterlichen Einfachheit des Vortrags („Der Begleiter”, „Wawas Ende ’), steht er ebenbürtig neben den Ersten seiner Zeit. Aber als Dramatiker überragt er fast alle seine Mitstrebenden. Er war zu dieser Kunst geboren — mit einem untrüglichen Sinn für den „Rhythmus von Sprache und Pantomime”, mit dem Gefühl für das Szenische, mit dem Sinn für die Wirkung. Etwas Schillerisches ist in seiner Art, auf die großen Kontraste, auf den einfachen Schwung der Linie auszugehen. Er kam mit dieser, man wird sagen dürfen: naiven dramatischen Anlage in eine Zeit, die überall in der Kunst nur die gebrochene Linie, das Problem, die Nervenprobe noch wollte und begriff, und wurde daher nicht verstanden, ja kaum gesehen.
Es ist trotzdem kaum einzusehen, warum auch heute noch die Bühne nicht wenigstens seiner Hauptwerke sich bemächtigt hat: des mozartisch leichten und tiefen Lustspiels von der „Magischen Laterne” und seiner beiden großen Tragödien „Peter und Alexej” und „Die Kinder Godunofs”. Merkwürdig, alle diese Stücke beschwören russische Welt und russische Geschichte herauf, aber sie tun es mit einer Sprachkraft, die im Rhythmus, im Duktus, in der Melodik so deutsch ist, wie sie nur sein kann. So wird in Heiselers Werk aus entgegengesetzten Elementen ein Neues, gewiß nur einmal uO Mögliches. — Wenn sich eine große Bühne einmal an die bisher nur auf einem Provinztheater vor Jahren auf geführten „Kinder Godunofs” wagen wird — Zar Godunof ist der Gegenspieler des falschen Demetrius, den Schiller und Hebbel in ihren Fragmenten behandelten —, dann wird man einen großen, nie wieder auszulöschenden Eindruck erleben und einen Dramatiker wohl für immer entdeckt haben. Diese Tragödie, 1923 geschrieben, ist gerade für uns Heutige von einer erstaunlichen Aktualität. Es handelt sich darum, daß da einer, nach Menschenweise, seine böse Tat durch andere, gute Taten auszugleichen und so das Geri-ht Gottes gleichsam abzukaufen sucht. Aber es erweist sich, daß das Böse sich nicht bergen noch heilen läßt, als bis der Täter hinaustritt vor alles Volk, unter den offenen Himmel, mit seinem Bekenntnis: „Herr, ich erkenne dein gerechtes Licht”. Denn das Schicksal der Seele liegt nicht in ihrem Tun, es liegt in ihrem Wesen.
Was Henry von Heiseier in den zwanzig Jahren seit seinem Tode gewonnen hat, ist eine Gemeinde. Der Karl-Rauch-Verlag, Boppard am Rhein, bereitet zur Zeit eine Ausgabe seiner Ausgewählten Werke in einem Bande vor. Es mag sein, daß die Stunde noch fern ist, in der sein Werk allgemein erkannt wird als das, was es tatsächlich ist: schwebende Brücke, ein Bogen der Versöhnung über der von Grenzen und Feindschaften zerrissenen Landschaft unserer alten Kultur. Möglich, daß eine solche Brücke erst wieder sichtbar und betretbar wird, wenn aus der Tiefe — wer kann wissen, nach welchen Prüfungen? — jenes „Gottes ist der Orient! Gottes ist der Okzident!” wieder tröstlich heraufklingt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!