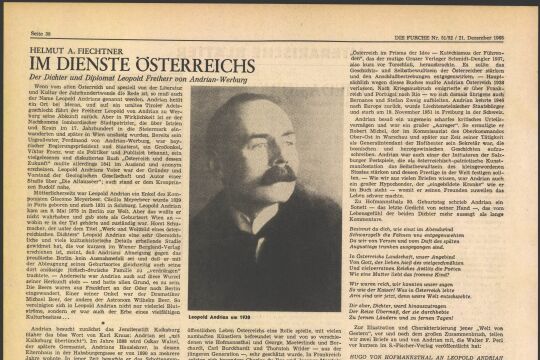Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
GESPRACH MIT DEM DICHTER
C üdlicfa von Bruck, wo die Mur zwischen bewaldeten Hügeln “3 in Richtung Graz fließt, liegt Pernegg. Hier halten nur Personenzüge. Das steirische Dörfchen ist in Österreich bekannt als Sominerwohnsitz von Max Meli. Doch das stimmt nicht ganz. „Villa Meli“ liegt in Kirchdorf, auf der anderen Seite des Flusses. Man muß die Brücke überschreiten und dann noch einigen Windungen des bergauf führenden Weges folgen. An der Gartenpforte wird vor dem bissigen Hund gewarnt. (Er ist wirklich bissig, ergibt eine Rückfrage bei der Nachbarin.) Zugleich ersetzt er die Klingel. Wenn man erreicht, daß er bellt, wird es drinnen lebendig.
Dr. Max Meli, der hier in den Sommermonaten mit seinen drei Schwestern wohnt, lebt sehr zurückgezogen. Weder sieht man ihn im Winter, den er in seiner Wiener Wohnung verbringt, oft bei kulturellen oder geseHschaftrkrien Veranstaltungen, noch gelingt es vielen Besuchern, zu ihm vorzudringen. Auch seine Vortragsabende sind immer seltener geworden. Diese scheinbare Zurückgezogenheit kann sich, wenn man die Barrieren überwunden hat, schnell in heitere Gesprächigkeit und gütige Herzlichkeit verwandeln. Sie hat nichts mit Menschenscheu oder gar Misanthropie zu tun, sondern ist Grundlage und Voraussetzung eines dichterischen Schaffens, das ganz aus dem Inneren kommt. Wenn man die anderen Dichter seiner Generation und seiner näheren Umgebung betrachtet: Hofmannsthal, Wildgans, Weinheber, Csokor, Felix Braun — sie alle waren oder sind auf irgendeine Art gesellig, sie redeten und machten von sich reden. Die Witterung für die aktuellen Strömungen der Literatur, das gegenseitige Beeinflussen und Anregen, der unmittelbare Niederschlag äußerer Erlebnisse auf das dichterische Werk: all das vermißt man bei Meli. Das hat.natürlich nicht gerade dazu beigetragen, eine Werke und seinen Namen populär zu machen.
Seine Biographie ist schnell erzählt. 1882 kam er in Marburg an der Drau zur Welt, das damals noch eine zu fast 90 Prozent deutsche Stadt war und zur Steiermark gehörte. Schon als er vier Jahre alt war, übersiedelte die Familie nach Wien, wo der Vater Direktor des Blindeninstituts wurde. Von 1901 bis 1905 studierte er an der Wiener Universität Germanistik, 1904 schon veröffentlichte er sein erstes Buch, die „Lateinischen Erzählungen“. Meli blieb unverheiratet, wie einige seiner Geschwister. Zwischen Wien und dem alten, schon lange im Familienbesitz befindlichen Haus an der Mur verlief sein Leben äußerlich in ruhigem Gleichmaß. Er hat früher auch viele Reisen gemacht, ohne daß unmittelbare Wirkungen daraus auf sein Werk zu erkennen wären. Die „Abenteuer“, die Kämpfe und Spannungen seines Lebens wurden alle im Innern, im seelischen Bereich ausgetragen. Die Wurzeln seines Werkes sind heute der jüngeren Generation - besonders außerhalb Österreichs — nur noch schwer begreifbar. Meli wuchs noch in der Vielfalt und Weiträumigkeit des alten Österreich auf. Wien war nicht nur Zentrum einer Großmacht, sondern befand sich auch als Kulturstadt auf einem Höhepunkt. Als der Vierjährige nach Wien kam, lebten Brahms und Bruckner noch. In seiner Jugendzeit war Gustav Mahler Direktor der Hofoper, wurde der zwanzig Jahre ältere Schnitzler erbittert bekämpft, erntete der acht Jahre ältere Hofmannsthal seinen ersten Dichterruhm. Auf allen Gebieten der Kunst und der Wissenschaft regte es sich.
Aber die entscheidende Prägung erhielt der Knabe doch im Elternhaus, in der Atmosphäre von Güte und Hilfsbereitschaft für die Blinden. Der achtzigjährige Max Meli lenkt das Gespräch gern auf seinen Vater. Immer plastischer, immer bedeutender scheint diese Gestalt in seiner Erinnerung hervorzutreten. Sie ist das genaue Gegenteil etwa der drohend-übermächtigen Vatergestalt bei dem um ein Jahr jüngeren Franz Kafka. Alexander Meli, der die Leitung des k. u. k. Blindenerziehungsinstituts 1886 übernahm, hat für die Blinden Bahnbrechendes geleistet. Die Fähigkeit, sich selbständig auf der Straße zu bewegen, die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen, den Kontakt mit Tieren und Blumen, die Anlage einer Blindenbibliothek - all das hat Meli in Wien eingeführt. Sein Vorbild hat weit über die Grenzen Österreichs gewirkt. Als die 65jährige Marie von Ebner-Eschen-bach das Institut besucht hatte, schrieb sie dem Knaben ins Stammbuch: „Mein lieber Max! Erinnere Dich beim Anblick dieser schlecht geschriebenen Zeilen einer alten Frau, die tiefbewegten Herzens und voll inniger Bewunderung für Deine verehrten Eltern aus dem Blindenheim scheidet.“
In dem Erinnerungsbuch, an dem Meli zur Zeit arbeitet und in dem der Vater einen hervorragenden Platz einnehmen wird, steht auch die Schilderung, wie der 15jährige Gymnasiast eine eigene Dramatisierung von Wielands „Oberon“ mit den blinden Kindern für eine Vorstellung vor sehenden Erwachsenen einstudiert: Die intensive Berührung mit der Welt der Blinden war nicht nur eine Schule der Güte und Nächstenliebe und der Einfühlung in seelische Schmerzen. Die Bereicherung, die der Dichter hier erfuhr, läßt sich an vielen Gestalten seiner Werke deutlich ablesen.
Neben dieser Sensibilität steht bei Max Meli ein unerhört feines Formgefühl. Das bewies er schon mit großer Sicherheit in den „Lateinischen Erzählungen“, die im alten Italien spielen. Seine Neigung zur lateinischen Welt bestätigte sich, als er die Briefe des am Wiener Hof lebenden Humanisten Enea Silvio Piccolomini (nachmals Papst Pius II.) übersetzte. Später ergriff ihn immer stärker die Klarheit und Formstrenge der griechischen Tragiker, deren dramaturgischen Gesetzen er sich zwanglos unterwarf. Auch der Achtzigjährige bekennt sich mit leuchtenden Augen zu den großen antiken Vorbildern. Seine Tragödie „Die Sieben gegen Theben“ läßt die menschliche Tat der Antigone aus einer Handlung emporwachsen, die ohne tiefgreifende Änderung von Sophokles und Euripides übernommen werden konnte, obwohl sie christlich gesehen ist. Antigone, die aus einem von den Göttern verfluchten Geschlecht stammt, sühnt mit ihrem Tode nicht nur ihren Verstoß gegen das Gebot des Staates, das sie um des göttlichen Gesetzes willen mißachtet hatte. Beim Abschied von dem blinden Ödipus sagt sie:
„Kein Fluch mehr, Vater. Darum geh ich hin. Damit kein Fluch mehr sei. Auf mich nehmend Trag ich ihn fort ins dunkle Haus und tilg ihn. Das hält mich aufrecht, wenn ich aus dem Licht soll...“
Das andere große Vorbild von Mells Schaffen ist Goethe. Meli hat sich intensiv mit vielen Dichtern beschäftigt, nicht zuletzt als Herausgeber ihrer Werke. Goethe ist ihm unerschöpflich geblieben. Als er vor einigen Wochen im Grazer Schloß Eggenberg nach langer Zeit wieder einmal vor seine Leser trat, da war unter den Werken, die er vortrug, auch jener „Prolog zur Feier von Goethes 200. Geburtstag“, den er seinerzeit im Wiener Burgtheater vorgetragen hat: ,, ... Und nimmer / Kann auf der Erde ganz unglücklich werden. / Wer sein gewahrte. / Solche, die's erfuhren, / Sagen es Euch ...“ Meli will diesen „Prolog“ also offenbar nicht als Gelegenheitsgedicht verstanden wissen, sondern als Bekenntnis. Es ist bezeichnend, daß Meli vier Jahre nach Kriegsende auf Goethe verwies, an dem die Menschen sich wiederaufrichten sollten:
„Habt Liebe! Sie allein besiegt den Dämon. Habt Frieden! Solchen Atems war sein Tun. Habt Ehrfurcht! Vor dem Schöpfer stand er so.“ Unser Gespräch im steirischen Haus des Dichters streifte auch kurz die merkwürdige Tatsache, daß nach dem letzten Krieg die Dichter angesichts der unfaßbaren Katastrophe zunächst stumm blieben. Nach 1918, als doch immerhin die übernationale Monarchie, die große Heimat zerbrochen war, hatte Max Meli selbst Worte des Trosts gefunden. Schon 1921 erschien sein „Wiener Kripperl von 1919“, das die Reihe der frommen Legendenspiele eröffnete, mit denen der Dichter am weitesten bekannt wurde: „Das Apostelspiel“ (1923), „Das Schutzengelspiel“ (1923) und „Das Nachfolge-Christi-Spiel“ (1928). Streng und einfach in der Form, szenisch anspruchslos, können sie von Laien ebenso wie von den prominentesten Bühnen zu eindringlicher Wirkung gebracht werden. Aber sie sind weder als Laienspiele noch als Volksstücke gedacht. Meli sieht sie als Festspiele an: „Sie sind es vielleicht auch dadurch geworden, weil sie mir in einer Zeit erwuchsen, da unser Land und Volk in tiefster geistiger Bedrücktheit waren und jeder nach froher Botschaft, Freude und Licht lechzte“, hat er einmal geäußert. „Die künstlerische Form eines Festspiels schwebte mir seit früher Zeit vor, ein einziger Akt, in dem sich ein nicht gewöhnliches, den ganzen Menschen ergreifendes Geschehen abrollt; dieses Geschehen möglichst einfach, aber darin versammelt, was als Bihr der Welt gelten kann...“ Vergleicht man etwa den „Jedermann“ mit einem von Mells „Festspielen“, so steht kunstvolle Nachempfindung neben einer zeitlosen Schlichtheit. Wenn einmal sein Erinnerungsbuch erscheint, wird darin sicher viel von Gesprächen mit Hofmannsthal stehen. „Er hat immer das Bedürfnis gehabt, über seine entstehenden Werke zu sprechen. Er wollte ihre Wirkung kennenlernen. Ich dagegen habe nie über das sprechen können, woran ich gerade arbeitete.“ So hält er es bis heute. Er deutet nur an, daß er außer seinen Erinnerungen „noch etwas für die Bühne“ vorbereitet.
Meli war nie Mode. Seine Nibelungendichtung scheint „für die Zukunft geschrieben“ zu sein (Melchinger). So wie man ihn nicht in literarische Strömungen einordnen kann, sowenig kann man seine Werke als altmodisch, einer bestimmten Zeit verhaftet, empfinden. Die Gelehrten haben über Meli wenig zu sagen. Das ist das Wunderbare: daß dieses mit so strenger Formdisziplin geschaffene Werk viel besser mit dem Herzen, als mit dem Verstand zu erfassen ist.
Wenn auch Mells Werk zum Teil sehr anspruchsvoll ist, so ist doch das Volkstümliche einer seiner wichtigsten Wesenszüge. Der Bewunderer von Roseggers Sprachkunst, der Steirer, der mit der Landschaft und den Menschen seiner Heimat eng vertraut ist, hat den Ton des Volksliedes und der Legende ohne Künstlichkeit getroffen. Aber er hat nie im Dialekt geschrieben. Wie er sich auch nicht als Steirer oder als Wiener, sondern nur als Österreicher bezeichnet. Österreicher im weitesten Sinne, darf man wohl hinzufügen.
Max Meli kann an seinem achtzigsten Geburtstag auf einen geraden, ungewöhnlich selbständigen Weg ohne kurzlebige Sensationen zurückblicken. Sein Werk wird immer wieder neu entdeckt werden und Menschen glücklich machen. Es klingt so wenig zeitgemäß, aber doch so beglückend, wenn er über sein 'Dwhterf sagt:'„Es soll doch etwas Schönes sein!“ * *
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!