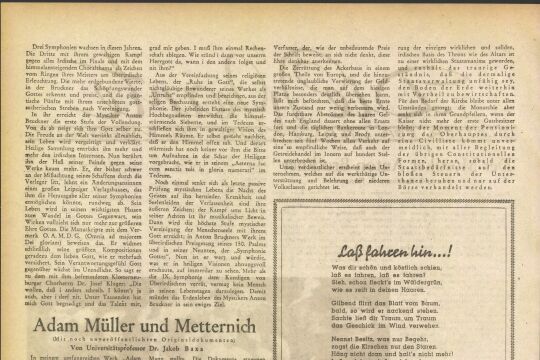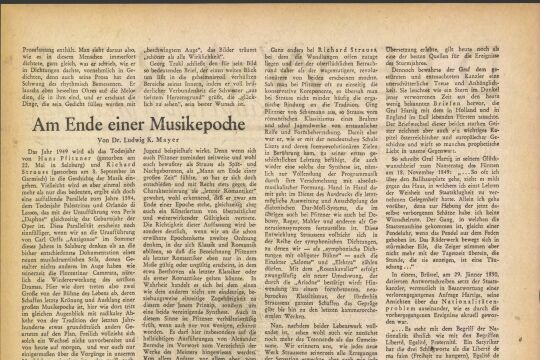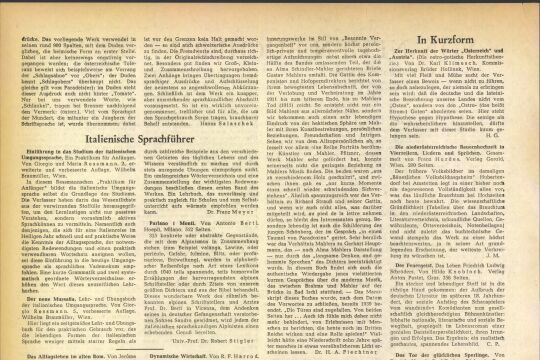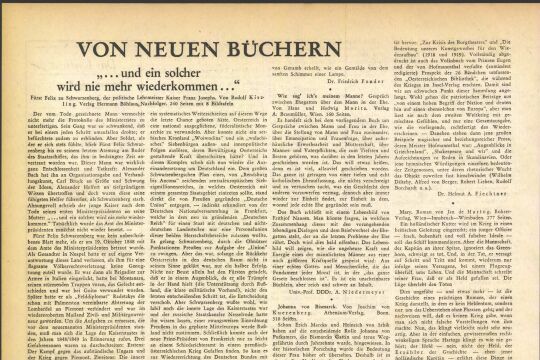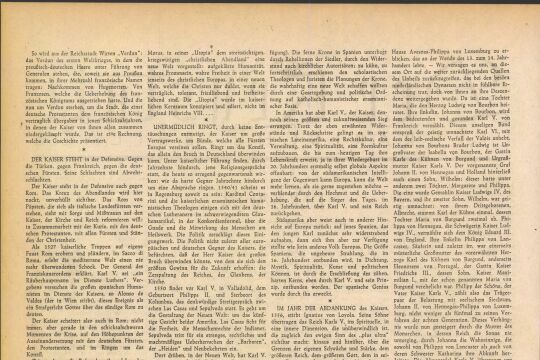Wenn ein Historiker sich in die- benachbarten Gefilde der Literaturwissenschaft begibt, so geziemt es sich wohl, daß er die Umstände darlegt, die ihn zu einer solchen Grenzüber- schreitung veranlassen. Für die Biographie Kaiser Leopolds II., und zwar besonders für die Jugendzeit dieses Sohnes der Maria Theresia, habe ich wie viele andere, die sich mit jener Epoche der österreichischen Geschichte beschäftigten, mit Gewinn die Tagebücher des kaiserlichen Obersthofmeisters Fürst Johann Josef Khevenhülilar-Metsch herangezogen. Ich habe mich dabei an der gewissenhaften, an Farben und Einzelheiten reichen Wiedergabe des täglichen Lebens bei Hofe und an der kräftigen und anschaulichen, wenngleich oft schwerfälligen „barocken” und mit vielen Fremdwörtern und vorwiegend französischen, italienischen und lateinischen Redewendungen durchsetzten Sprache erfreut und reichlich, vielleicht sogar überreichlich, daraus zitiert; so etwa, wenn sich die Gelegenheit ergab, den gleichen Vorgang (die Begegnung des Kaisers Franz I. mit dem greisen Landgrafen Ludwig von Hessen-Darmstadt in einem Wäldchen bei Frankfurt am 29. März 1764) in den vier Schilderungen durch Goethe, Khevenhüller-Metsch sowie in den französisch geschriebenen Briefen Josephs II. und seines Bruders Leopold nebeneinanderzustellen. Dabei fiel mir mehrfach die Verwandtschaft im sprachlichen Ausdruck zwischen den Khevenhüller-Tagebüchern und dem Text des „Rosenkavalier” auf, und es kam mir der Gedanke, daß wohl auch Hofmannsthal jene Bände gelesen oder zumindest in ihnen geblättert haben mag, zumal ihre Veröffentlichung gerade in den Jahren vor der Arbeit am Textbuch der „Komödie für Musik” begonnen hatte. Aber erst nachdem ich diese Vermutung nebenher in einem Vortrag geäußert hatte, fühlte ich mich, ermuntert von germanistischen Kollegen, verpflichtet, diąser Frage weiter nachzugehen. Das Ergebnis meiner Untersuchungen und ihrer Überprüfung an der ja schon recht umfangreichen Literatur über Hofmannsthal, Strauss und ihren „Rosenkavalier” sei hiermit, zugleich dankbar als Gegengabe für freundliche Auskünfte und Hinweise, den kompetenten Fachleuten zur Beurteilung vorgelegt. Es läßt sich in den Satz zusammenfassen, daß Hofmannsthal sich für das Zeit- und Sprachkostüm seiner Dichtung in vielfacher Weise durch die Tagebücher Khevenihül- lers hat inspirieren lassen. Die nachweisbaren Übernahmen häufen sich dabei, wohl nicht zufällig, vor allem im 1. Akt, in dem Hofmannsthal sogleich die Atmosphäre von Zeit und Ort zu beschwören suchte, was ihm in den beiden weiteren Akten, in denen der Ablauf der Handlung Zuschauer und Leser in seinen Bann schlägt, nicht mehr so wichtig erschien. Im Briefwechsel mit Richard Strauss hatte er keine Veranlassung, diese seine Quelle zu erwähnen.
Die Edition der Tagebücher erfolgte im Auftrag der Gesellschaft für Neuere Geschichte Österreichs durch einen Nachkommen des Tagebuchschreibers, Rudolf Graf Khevenhüller-Metsch, und durch den Staatsarchivar Dr. Hanns Schütter unter dem bezeichnenden Titel „Aus der Zeit Maria Theresias”. Denn auch diese Veröffentlichung stand, wie bereits das gegenwartsbezogene Vorwort Rudolf Kheven- hüllers zeigt, in der Tradition der Maria-Theresien-Renais- sance der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, einer idealisierenden Rückbesinnung auf die „große Kaiserin” im Zeichen des Kampfes um den österreichischen Gesamtstaatsgedanken und der Rivalität gegenüber dem preußischen „Fridericus”-Kult. Die bleibenden Monumente dieser politisch-historischen Strömung sind die große zehnbändige Biographie der Kaiserin von Alfred von Ameth und die damit zusammenhängenden umfangreichen Quelleneditionen, anderseits das nach einem von Arneth entworfenen Programm gestaltete große Denkmal Maria Theresias, ihrer militärischen und politischen Paladine, ja ihres ganzen Zeitalters, an der Wiener Ringstraße zwischen den beiden Hofmuseen. Aber auch der „Rosenkavalier” selbst gehört mit in diese Tradition, die auch noch später, so in den Werken von Guglia, Kretschmayr und Friedrich Walter, weiterwirkte; und man mag die silberne Rose des Spiels als das edelste Gewächs ansehen, das aus dem Erdreich dieser Maria Theresien-Renaissance entsprossen ist.
Dem 1907 erschienenen ersten Band der Khevenhüller - Tagebücher, der die Jahre 1742 bis 1744 umfaßt, folgte schon 1908 der zweite Band für die Jahre 1745 bis 1749. Den dritten, 1910 erschienenen Band mit den Tagebüchern der Jahre 1752 bis 1755 dürfte Hofmannsthal kaum mehr benützt haben, da die Arbeit am Textbuch inzwischen schon fast abgeschlossen war; und erst recht nicht natürlich die weiteren Bände. Es kommen daher für unsere Untersuchung nur die beiden ersten Bände in Betracht, die eben gerade jene „ersten Jahre der Regierung Maria Theresias” umfassen, die der Dichter als Zeit der Handlung angibt.
Die breit angelegte Einleitung aus der Feder Schiitters erzählt die Geschichte des aus Kärnten stammenden Geschlechts der Khevenhüller in den verschiedenen Linien, von denen eine 1588 das Erblandstallmeisteramt in Kärnten erhielt (S. 21, vgl. dazu im 1. Akt die Bemerkung des Barons: „… vom Ahnherrn Lerchenau, der ein großer Klosterstifter war und Oberst-Erblandhofmeister in Kärnten und in der windischen Mark”), verweilt dann lange beim Feldmarschall Ludwig Andreas Khevenhüller, dem von Maria Theresia besonders geschätzten, wohl bedeutendsten Feldherrn dieser ihrer ersten Regierungsjahre (vielleicht die Anregung für den Gemahl der „Feldmarschallin”‘?), und schließt mit einer biographischen Skizze und Charakteristik des Tagebuchschreibers. Darauf folgt (nach S. 98) eine Abbildung, „J. J. Khevenhüller im Kreise seiner Familie”, nach dem Werk eines ungenannten Malers. Wir erblicken darauf unter anderem einen turbangeschmückten Mohren, der dem Ehepaar Khevenhüller Schokolade ebenso auf einem Präsentierbrett serviert wie der kleine Neger der Marschallin im 1. Aufzug. Vor Khevenhüller aber steht, offenbar in Erwartung eines Zuckerstückchens, auf den Hinterbeinen aufgerichtet, ein winziges Hündchen. (Der Tierhändler in der Anti- chambre-Szene: „Hunderln, so klein, und schon zimmerrein.”)
Alle diese Übereinstimmungen besagen für sich allein gewiß noch nicht viel, und die eine oder andere mag tatsächlich zufällig sein. In ihrer Häufung und vor allem im Zusammenhang mit den eindeutigen Beweisen sind sie aber doch wohl bedeutsam.
Denn bisher haben wir uns ja noch gar nicht mit dem Text des Tagebuches befaßt. Da stoßen wir aber nun, schon auf den ersten Seiten, bei dem Bericht über das Testament des soeben verstorbenen Vaters Khevenhüllers auf folgenden Passus: „Nebst einigen piis legatis und Betreuung seiner Hausofficiren, Livrėe-Bedienten und Underthanen… werde ich in Conformitet einer bereits bei Errichtung meiner Ehe- pacten auf Instanz meines Herrn Schwehren seelig zu meinem Favor von beiden Eltern errichteten donationis inter vivos zum Universal-Erben benennet…” (S. 110, vgl. den Notar in der Antichambre-Szene: „Als eine Schenkung inter vivos…”) Auf S. 239 aber begegnen wir zum erstenmal dem „Cammerherrn Graffen Frantz Esterhasi, den mann par sobriquet Quinquin zu nennen pfleget.” Dieser Quinquin (Franz) Esterhazy kommt dann im zweiten Band häufiger, bald mit dem Vornamen Franz, bald nur mit dem Spitznamen Quinquin vor. Einmal wird die Entstehung des Namens erklärt: „… (welchen mann nach seinem, in Lothringen — da er auf denen Raisen ware — ihme zugelegten Spitznamen meistentheils nur Quinquin zu nennen pfleget) …” (11/125) und nochmals heißt es später von ihm „ … insgemain nach seinem Spitznamen Quinquin genannt.” (11/201). Mit diesem Grafen Franz Esterhazy von Galantha (1715 bis 1785) hat sich 1932 der verdienstvolle, vor kurzem verstorbene, Mozart-Forscher Otto Erich Deutsch in einer kleinen Schrift „Mozart und die Wiener Logen” beschäftigt und dabei in einer umfangreichen Anmerkung nebenbei erwähnt, daß dieser Graf „auch sonst interessant sei”, eben wegen seines lothringischen Spitznamens „Quinquin”, den Hofmannsthal „wohl nach Khevenhüllers Tagebüchern” für den „Rosenkavalier” verwendet habe. Willi Schuh hat dann 1951 kurz auf diese Entdeckung Deutschs hingewiesen, aber da er dabei die Stelle in dem umfangreichen literarischen Lebenswerk von Deutsch nicht angab, ist dieser Hinweis kaum beachtet und auch nicht weiter verfolgt worden.
Nun ist die Übernahme des Spitznamens Quinquin wohl vielleicht der eindrucksvollste, aber keineswegs der einzige Beweis für die Verwendung der Tagebücher durch den Dichter; sie steht nicht isoliert, sondern muß im Zusammenhang gesehen werden mit allen anderen Namen, die Hofmannsthal aus dem Personenregister der ersten beiden Bände in seine Dichtung übernommen hat. So finden wir bereits im ersten Band auch Octavians Familiennamen Rofrano durch eine Marchesa Maria Theresia Rofrano, verehelichte Kinsky, vertreten, sowie auch alle jene, teilweise recht ungewöhnlichen, Taufnamen des Rosenkavaliers, die Sophie im zweiten Akt so brav herzusagen weiß: Octavian (bei einem Grafen Kinsky, im Personenverzeichnis S. 329 unmittelbar hinter der erwähnten Marchesa Rofrano) Ehrenreich (Khevenhüller- Osterwitz, S. 327), Ferdinand Bonaventūra (zwei Grafen Har- rach, S. 323), Hyazinth (Fürst Lobkowitz, S. 331). Die ersten Familien des österreichischen Hochadels, deren Namen der Dichter aus begreiflichen Gründen nicht verwenden konnte, haben so zumindest ihre Taufnamen für die Dichtung beigesteuert. Aber auch alle anderen im ersten Akt von Octavian, der Marschallin und ihrem Haushofmeister erwähnten Namen kommen mehrfach in den Personenregistern des ersten (Saurau, Lamberg, Hartig und Sylva) oder des zweiten Bandes (Jörger) vor. Im zweiten Band finden wir dann auch noch den der Marschallin, allerdings nur im Personenverzeichnis des Spiels, gegebenen Namen Werdenberg (hier als Verdenberg) sowie den Namen Fanal (Felician Julius Hauspersky von Fanal, Besitzer eines Hauses in Brünn, II//505), der wohl die Anregung für den Namen Fani- nal gegeben hat. Besonders klar ist die Lage bei dem am Ende des 1. Akts vorkommenden Namen Greiffenklau (Marschallin: und später fahr’ ich zum Onkel Greiffenklau, der alt und gelähmt ist, und ess’ mit ihm: das freut den alten Mann”). Diesen Namen einer rheinischen Familie konnte der Dichter weder in Wurzbachs Biographischem Lexikon noch in einem österreichischen Schematismus finden, und daß er ihn aus der Geschichte der Reformationszeit von dem Kurfürsten und Erzbischof von Trier, Richard von Greiffenklau (1467 bis 1531), dem Gegner Franz von Sickin- gens, übernahm, ist sehr unwahrscheinlich. Im Personenregister des zweiten Bandes der Tagebücher aber kommt auch dieser Name als der des Bischofs von Würzburg, Karl Philipp Heinrich von Greiffenklau, vor. Schließlich sei noch erwähnt, daß auch der von Octavian gleich in der ersten Szene genannte „portugieser Envoye”‘ (Don Sebastian Carvalho y Melho, später als Marques de Pombal der berühmte Reformminister) wegen der portugiesischen Vermittlung zwischen Wien und Rom sowie zwischen Wien und den bourbonischen Höfen von Versailles und Madrid im zweiten Band der Tagebücher wiederholt genannt wird.
Auch den Namen Lerchenau finden wir im Register des zweiten Bandes unter Verweis auf den Kanzler des niederösterreichischen Regiments, Johann Josef Mannagetta, Freiherr von Lerchenau (S. 320). Die aus der Gegend von Bologna und Ferrara stammende, seit dem Ende des 15. Jahrhunderts in Niederösterreich ansässige Familie führte drei goldene Lerchen im schwarzen Felde mit silbernem Querbalken in ihrem Stammwappen. Johann Wilhelm I. (1588 bis 1666) war Leibarzt dreier Kaiser und Hofhistoriograph, ein späterer, gleichnamiger Nachfahre, Johann Wilhelm II. von Mannagetta und Lerchenau (1785 bis 1848), Generalsekretär der österreichischen Nationalbank und Hoftheaterdichter (Dramen: „Hiltrude”‘, „Das Haus Mac Alva”, „Ossian”, „Oscar”).
Nun hat vor einigen Jahren gerade hinsichtlich der Herkunft des Namens „Lerchenau” im Text des „Rosenkavalier” Andreas Razumofsky eine interessante Hypothese vorgetragen, die Beachtung verdient. Er hat darauf hingewiesen, daß die bis heute in Kärnten blühende fürstliche und gräfliche Familie Orsini-Rosenberg neben anderen auch den Titel eines Freiherrn von Lerchenau und im Wappen eine Rose (allerdings nicht, wie er schreibt, eine silberne, sondern, um genau zu sein, eine rote Rose auf silbernem Grund) führt; was vielleicht die erste Anregung zur Erfindung der „silbernen Rose” gegeben haben könnte. Diese Hypothese ist von Razumofsky einerseits, wie noch zu zeigen sein wird, etwas über- anstrengt worden, sie läßt sich aber anderseits noch weiterspinnen, wobei sich neue, überraschende Perspektiven eröffnen. Der bedeutendste Angehörige des Geschlechts der Rosenberg-Orsini im 18. Jahrhundert war nämlich Franz Xaver Wolf Graf von Rosenberg-Orsini, der das Vertrauen von Maria Theresia, Joseph II. und Leopold II. genoß, den Heinrich Pestalozzi in der Gestalt des „Nelcron” verewigte und der 1790 in den Reichsfürstenstand erhoben wurde, welche Würde dann, da er unvermählt blieb, auf eine andere Linie seines Hauses überging. Dieser bedeutende Diplomat und Staatsmann, dessen hervorragende Qualitäten uns durch seine Leistungen wie durch die übereinstimmenden sehr positiven Urteile zahlreicher Zeitgenossen wohlvertraut sind, zog sich gegen Ende seines Lebens als der auch für die Leitung der Hoftheater zuständige Oberstkämmerer Josephs II. und Leopolds II. den Haß des Dichters Lorenzo Da Ponte zu, da er dessen Rivalen, den — übrigens auch von Goethe geschätzten — Hofdichter Abbate Giambattista Casti protegierte. Da Ponte behauptet nun in seinen von offenkundigen Unwahrheiten strotzenden Memoiren, der alte Rosenberg habe den galanten Abbate vor allem wegen dessen berüchtigt unanständiger Gedichte bevorzugt, da sie ihn „fühlen ließen, daß er noch lebendig war”, weshalb er sich um keinen Preis von diesem „Aufpeitscher seiner ermattenden Wollust” trennen wollte. Da Pontes Freund und Schicksalsgefährte Giacomo Casanova, auch er gewiß nicht der berufenste Sittenrichter, hat diese Beschuldigungen noch durch die Behauptung erweitert, Casti habe Rosenberg auch als „pourvoyeur de filles” gedient. Hofmannsthal aber hat bekanntlich nicht nur die Memoiren Casanovas aufmerksam gelesen, aus denen er den Stoff für „Cristinas Heimreise” entnahm, sondern er hat sich auch, wie der Briefwechsel mit Richard Strauss zeigt, gerade während der Arbeit am Rosenkavalier-Libretto in gewissem Sinne als ein Nachfahre Da Pontes gefühlt. Die von den beiden italienischen Glücksrittern und Memoirenschreibern Rosenberg vorgeworfenen Neigungen paßten nun durchaus zum Charakterbild des Buffo in der geplanten komischen Oper, und so mag der Dichter vielleicht tatsächlich in Erinnerung an die von Da Ponte und Casanova entworfene Karikatur eines alten Wollüstlings dem „Ochs” den Namen eines Freiherrn von Lerchenau gegeben haben. Vielleicht auch stand die Namenswahl bei ihm erst fest, als er im Personenregister der Tagebücher erneut auf einen Freiherm (Mannagetta) von Lerchenau stieß, so daß man dann eine doppelte Herkunft dieses Namens einer der Hauptfiguren der Dichtung annehmen müßte. Die Lektüre der von Da Ponte breit ausgesponnenen Intrigen zwischen den in Wien tätigen italienischen Dichtem, Komponisten, Schauspielern und Sängerinnen r’ . könnte den Anstoß gegeben haben für die Gestalten der italienischen Intriganten Valzacchi und Anniina.
Bewegen wir uns hier weitgehend auf dem schwankenden Grund gewiß reizvoller Hypothesen und Vermutungen, so ist andererseits eine Folgerung, die Razumofsky aus seiner Entdeckung ableitet, gewiß irrig: die Behauptung nämlich daß „die Lerchenauschen” als Gefolge eines Kärntner Edelmanns angeblich unverkennbar „Kärntnerisch knödeln”, von Haua aus eher „Krovatisch” sprechen und richtige „Tschuschen”‘ (Slowenen) seien. Denn aus mehr als einer Stelle geht doch ganz eindeutig hervor, daß wir uns die Lerchenauschen Besitzungen im nördlichen Niederösterreich, nahe der böh- misch-mährischen Grenze, ,zu denken haben; etwa in der Gegend der vom Vater Khevenhüllers erworbenen Güter im Waldviertel um die Ortschaft Weitersfeld, westlich von Retz, die auch bereits auf den ersten Seiten des Tagebuchs erwähnt werden. Sagt doch der Lerchenauer selbst im X. Akt: „Da ist bei uns da droben so ein Zuzug von jungen Mägden aus dem Böhmischen herüber… Und wie sich das mischt, das junge, runde böhmische Völkel, schwer und süß, mit denen im Wald und denen im Stall, dem deutschen Schlag, scharf und herb wie ein Retzer Wein — wie sich das mischen tut!” Aber auch die übrigen Ortsangaben weisen eindeutig auf Niederösterreich; so „Schloß und Herrschaft Gaunersdorf” im Gespräch des Ochs mit dem Notar im 1. Akt, oder die dann in der Endfassung weggelassenen Worte des Barons zu Sophie in der ursprünglichen Fassung des 2. Akts: „Wird Sie recht umkutschieren auf die Schlösser? Wo mag Sie hin zuerst? Nach Bruck? Nach Stettendorf, nach Petronell?” So kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Lerchenauschen nach Hofmannsthals Vorstellungen von einem niederösterreichischen und nicht von einem kärntnerischen „Rübenacker her in die Livree gesteckt” wurden. Dazu paßt aber dann auch gut, daß Annina, wenn sie im 3. Akt die angebliche verlassene Gemahlin des Ochs mimt, sich, wie Hofmannsthal ausdrücklich vermerkt, „des böhmisch-deutschen Akzents, aber gebildeter Sprechweise” bedient, welches sozusagen diskrete „Böhmakeln” ja auch durch die Satzstellung ausgedrückt wird („Er tut, als ob er mich nicht täte kennen.”) Sie soll eben offenbar eine Dame oder Bürgersfrau von jenseits der nahen Landesgrenze, etwa aus Znaim oder Brünn, darstellen.
Damit sind wir nun bei der Sprache, bei der man allerdings — abgesehen von einigen Ausdrücken wie der erwähnten Schenkung „inter vivos”, dem „Envoyė” usw. — nicht an eine direkte Übernahme wie bei den Namen denken darf. Fehlt doch in der oft schwerfälligen und zeremoniellen, allerdings manchmal auch rührend treuherzigen, ja humorvollen, Sprache des gewissenhaften Chronisten aller Vorgänge bei Hofe und im Hochadel natürlich der Dialog und damit auch ein Vorbild für den in der Dichtung so besonders kunstvoll angewandten und etwa von Razumofsky mit kenntnisreichem Einfühlungsvermögen analysierten Wechsel der Anredeformen. Auch für die feine sprachliche Differenzierung der einzelnen Personen, auf die Hofmannsthal selbst so großen Wert gelegt und auf die er dann noch ausdrücklich in seinem Geleitwort von 1927 hingewiesen hat („Eine Sprache, durch welche jede Person zugleich sich selbst und ihre soziale Stufe malt, welche in dem Mund aller dieser Figuren die gleiche ist — die imaginäre Sprache der Zeit — und doch im Mund jeder Figur eine andere, mit einer ziemlich beträchtlichen Spannweite…”); auch für diese sprachliche Differenzierung konnte das Tagebuch des Obersthofmeisters selbstverständlich nicht als Vorbild dienen. Aber eben für die vom Dichter erwähnte gemeinsame sprachliche Grundlage der Hauptpersonen, für die „imaginäre Sprache der Zeit”, die ein Kritiker „ein Volapük des 18. Jahrhunderts.” nannte, was Hofmannsthal selbst „sehr annehmbar” fand, hat er sich offenbar durch die Lektüre der Khevenhüller-Tagebücher sprachlich eingestimmt. Das wird etwa deutlich bei der Dosierung der eingestreuten Fremdwörter oder der häufigen Verwendung französischer oder lateinischer Verben mit eindeutschender Endung („antichambrieret”, „inkommodiert”, „konzedieren”, „deputieren”, „proponier”, „spendieren”, „degourdiert’;, „exkludiert”, „charmiert”, „empressiert” und so weiter). Gewiß war zu Beginn unseres Jahrhunderts (und ist teilweise auch heute noch) die Verbindung derartiger Gallizismen mit einem diskreten „Wienerisch” ein Charakteristikum der Sprache der Wiener Gesellschaft und dem Dichter daher wohlvertraut. Auch hat er ja selbst die Sprache, wie erwähnt, als eine „imaginäre Sprache” erklärt und im Nachwort nochmals betont: „Die Sprache ist in keinem Buch zu finden, sie liegt aber noch in der Luft, denn es ist mehr von der Vergangenheit in der Gegenwart als man ahnt, und weder die Faninal noch die Rofrano noch die Lerchenau sind ausgestorben, nur ihre drei Livreen gehen heute nicht mehr in so prächtigen Farben. Von den Sitten und Gebräuchen sind diejenigen zumeist echt und überliefert, die man für erfunden halten würde, und diejenigen erfunden, die echt erscheinen.” Ist es nicht eine Art kokettierenden Fächerspiels mit den allzu pedantischen oder neugierigen Forschern und Kritikern, das der Dichter hier nachträglich aufführt, ein spielerisches Verhüllen, Maskieren und Hinweisen, „eine wienerische Maskerad und weiter nichts”? Besonders, wenn man zu den eben zitierten Worten im „Ungeschriebenen Nachwort” die ihnen entsprechenden und zugleich widersprechenden Sätze im Geleitwort hält: „Dahinter war der geheime Wunsch, ein halb imaginäres, halb reales Ganzes entstehen zu lassen, dies Wien von 1740, eine ganze Stadt mit ihren Ständen, die sich gegeneinander abheben und miteinander mischen, mit ihrem Zeremoniell, ihrer sozialen Stufung, ihrer Sprechweise oder vielmehr ihren nach den Ständen verschiedenen Sprechweisen, mit der geahnten Nähe des großen Hofes über dem allen, mit der immer gefühlten Nähe des Volkselementes.”
So seien hier zum Schluß einige Passagen aus Khevenhüllers Tagebüchern willkürlich herausgegriffen. Wer die Sprache der Dichtung im Ohr hat, dem werden in den Aufzeichnungen des Obersthofmeisters dabei Anklänge auffallen an die „fast demütige Einfachheit”, die Hofmannsthal in der „sehr einfachen Sprache der Marschallin” ausdrücken wollte, aber ebenso auch an die „elegante Sprechweise” Octavians, ja sogar an die „eigentümliche Mischung”, wenn vielleicht auch nicht „aus Pompösem und Gemeinem im Mund des Buffo”, so doch aus Pompösem und Trivialem.
„Dermahlen ware mann mit denen Proben des anzustellenden Frauen-Caroussels sehr beschäfftiget und gienge fast kein Tag vorüber, wo I. M. nicht in die gedeckte Reutschull kämmen, um sich mit denen zu disen Fest benannten und erkiesenen Hoff- und Statt-Dames in Reutten, Fahren und Kopffnehmen zu erxerziren; meine Gemahlin ware auch dazu destiniret, hat sich aber wegen darzwischengekommener Schwangerschafft nachhero absentiren und entschuldigen müssen, deren Stelle die Frau von Proskau vertretten.”
„Ansonsten aber ware mir sothanes Ammt unter allen übrigen Hoffämtern, wiewollen es eines deren letzteren im Rang ist, auss der Ursach das liebste, umwillen mann vill weniger an Hoff angebunden und mann folglichen mehrere Ruhe hat.”
„Übrigens kann ich, weillen es mir gar zu consolirlich gefallen, mithin das Hertz davon noch voll ist, mit Stillschweigen unmöglich übergehen, — ob es zwar einen eigenen Lob zu gleichen scheinet — daß unser gnädigster Grossmeister, welcher nach den Ritterschlag den neu Creirten zu embras- sieren pflegt, sich dessen gegen mir auf eine so zart und liebreiche Art aquitiret, daß alle Umstehende dises groseen Fürsten Liebb und Gnad für einen alten Diener stattsahm erkennet und mir für Freuden die Augen übergangen.”
„Abends ware Bai in dem kleinen Opera Saal. Übrigens begegnete mir eine zwar lächerliche Fatalitė bei diser Schlittenfahrt: ich hatte mir eine ganz neue, sehr hertzige Equipage blau mit Silber machen lassen und vorhero noch, ehe mann wissen können, ob mann fahren, weder welche Dame ich führen würde, zum öfteren geschertzet, daß, um meine neue Equipage zu verschändlen, nichts abgienge, als dass ich eine Dame zu führen bekäme, welche einen grünen Peltz hätte; nun fügte sich eben, daß den Rang nach mir die Cammerfreile Kokorsova zu Theil werden muste, welche sich ganz neuerlich und zu diser Schlittenfahrt just einen grünen Peltz, und zwar noch mit goldenen Borten, pour faire un double contraste mit meiner blau und silbernen Equipage, hatte machen lassen.”
„Den 21. continuirte die Kaiserin das durch dise drei Tage interrumpirte Spill, während deme der Kaiser meistentheils in das Opera Hauss sich zu verfügen pflegte.”
Zum Abschluß aber sei eine Stelle aus dem dritten, 1910 erschienenen, Band der Tagebücher zitiert, weil sie in mehr facher Hinsicht an Gestalten und Handlung des „Rosenkavalier” erinnert: „Eodem verstarb im 30. Jahr an lang- wührig-abzährender Kranckheit des Graffen Michael Hanns von Althann Gemahlin Josepha (gebohrne Gräffin Kinsky), welche eine sehr galante Dame gewesen und mit dem sogenannten Quinquin Esterhasy eine wohil in das 12. Jahr fürgedauerte Intrigue gehabt, in ihrer letzten Kranckheit aber alle erwünschliche Marques einer wahren Bereuung und christlichen Poenitenz von sich spühren lassen.”
Mit freundlicher Genehmigung des Erich-Schmidt-Verla- ges, bei dem die von Hugo Moser und Benno von Wiese herausgegebene „Zeitschrift für deutsche Philologie” erscheint, in deren 4. Heft des Jahrganges 1967 (Band 86) die Erstveröffentlichung dieser Studie erfolgte.
An den Autor dieses Artikels schrieb Carl J. Burckhardt, der während der letzten zehn Lebensjahre des Dichters mit diesem eng verbunden war:
„Hofmannsthal hat mir seinerzeit von Khevenhüllers Tagebüchern gesprochen. Ich hatte den Eindruck, daß er sie vor dem ersten Weltkrieg mit ganz besonderem Anteil gelesen hatte. Daß die mit vielen — meiner Ansicht nach mehr aus dem Italienischen als dem Französischen stammenden — Worten durchsetzte Sprache noch 1918 sehr lebendig mar, ist mir in lebhafter Erinnerung… Nach der ersten Aufführung des „Schwierigen” sagte Graf Mensdorff zu dem Verfasser dieses Stückes: ,So viele Fremdworte benützen wir doch nicht, das wäre ja ridikui.’ Von dem jungen Schumpeter sagte mir einmal eine Dame aus der Gesellschaft: ,Er ist deliziös, wenn er erzählt; schade daß er so bürgerlich präpotent ist.’…Was die italienisch-französischen Vokabeln der gesellschaftlichen Umgangssprache anbetrifft, so sind sie mir lieber als die Fremdworte, mit denen unsere Durchschnittsintellektuellen sich heute brüsten. Es handelt sich im ganzen um Vokabeln, die im Deutschen keine ebenso zarte Entsprechung haben: ,delizio’, ,charmant”, ,nuanciert’ usw. Sie sind schwerer zu übersetzen als etwa die gräßlichen ,das Image’ oder ,das Establishment”, von dem schon etwas abgeleierten ,existentiell” ganz zu schweigen…