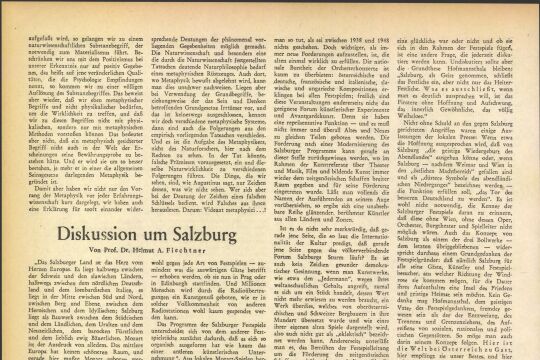Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Goldene Worte - Silberne Rose
Bei den heurigen Salzburger Festspielen gibt es einige Neuinszenierungen älterer Opernwerke, die Premiere des Vorjahres, Cavalieris „Rappresentatione“, hat man aus der Felsenreitschule in die Kollegienkirche transferiert, es gibt einen erneuerten „Jedermann“, Raimunds „Alpenkönig“ sowie eine stattliche Anzahl großer und kleiner Konzerte (als Gastorchester fungiert in diesem Jahr das „Orche-stre de Paris“). In den recht buntscheckigen Programmen der ersteren ist der jüngste Zeitgenosse, der 87jährige Strawinsky. Es gibt keine Ballettaufführungen, kein einziges neues Opernwerk, keine Ur- oder Erstaufführung auf dem Podium. Ist dies die „neue Linie“ oder will man seine Kräfte sowie etwa vorhandene Ideen bis zum nächsten Sommer zurückhalten, da die Salzburger Festspiele ihr 50jähriges Jubiläum hoffentlich mit erdenklichem Glanz begehen werden?
Bei den heurigen Salzburger Festspielen gibt es einige Neuinszenierungen älterer Opernwerke, die Premiere des Vorjahres, Cavalieris „Rappresentatione“, hat man aus der Felsenreitschule in die Kollegienkirche transferiert, es gibt einen erneuerten „Jedermann“, Raimunds „Alpenkönig“ sowie eine stattliche Anzahl großer und kleiner Konzerte (als Gastorchester fungiert in diesem Jahr das „Orche-stre de Paris“). In den recht buntscheckigen Programmen der ersteren ist der jüngste Zeitgenosse, der 87jährige Strawinsky. Es gibt keine Ballettaufführungen, kein einziges neues Opernwerk, keine Ur- oder Erstaufführung auf dem Podium. Ist dies die „neue Linie“ oder will man seine Kräfte sowie etwa vorhandene Ideen bis zum nächsten Sommer zurückhalten, da die Salzburger Festspiele ihr 50jähriges Jubiläum hoffentlich mit erdenklichem Glanz begehen werden?
Mit einem Galaempfang des Bundespräsidenten am 25. Juli in der Residenz und einem Festakt ebenda, im Carabinierisaal, wurden die Salzburger Festspiele am nächsten Vormittag eröffnet. Landesrat Hermann Lechner wies darauf hin, daß bei dieser Zeremonie nicht nur die geistige und künstlerische Repräsentanz anwesend sei, sondern auch die von Stadt, Land und Staat. Damit legitimieren sich die Festspiele als „österreichische Angelegenheit“ (das Wort „res publica“ wurde nicht verwendet). Eine Festspielproblematik, besonders was den Spielplan betrifft, habe es immer gegeben, und was im Lauf der Jahre für und gegen die Festspiele geschrieben wurde, fülle eine stattliche Bibliothek, „die zu lesen kaum neue Eindrücke fördern würde“ (vielleicht hätte man manches genauer lesen und gründlicher bedenken sollen). „Statt von Problematik, Programmatik und Theorie zu sprechen, mag es aufschlußreicher sein, die Biographie dieser Festspiele zu studieren, wozu das 50. Bestandsjahr besonderen Anlaß geben wird“ — an Stelle „problematischer Diskussion“, wie später noch einmal beton! wurde. Hierauf überreichte der Herr Landeshauptmann an Frau Helene Thimig den Ehrenring des Landes Salzburg — als Dank für vieles, unter anderem auch dafür, daß sie an mehr als 200 Aufführungen im Rahmen der Festspiele mitgewirkt hat.
Unterrichtsminister Dr. Mocfc betonte die echte Ihternationalität, die geschichtliche Weltverbundenheit Salzburgs und seiner Festspiele. Ebenso wichtig aber erscheint ihm die Frage, ob wir nur noch reproduzieren, wobei das Schöpferische zu kurz kommt und die Förderung des Neuen, in die Zukunft Drängenden, vernachlässigt wird. Ebenso wie die nationale Isolierung führe auch dies zur Verdorrung. Er hofft daher, daß Jahr um Jahr immer mehr das Schaffen jünger Künstler Aufnahme und Pflege finden möge (im Augenblick scheint ein rückläufiger Prozeß im Gang zu sein).
Noch deutlicher wurde der Bundespräsident in seiner kurzen Eröffnungsansprache: „Der Festspielgedanke, in Salzburg geboren, ist von vielen übernommen worden... Mögen die Erben sich stets bewußt bleiben, daß es hier nicht nur um Repräsentation des Vergangenen, sondern auch um Präsentation des Gegenwärtigen und Zukünftigen der österreichischen Kultur geht. Nichts Totes wird hier geehrt, sondern Lebendiges bezeugt sich als lebendig v- so hat schon Hofmannsthal gesagt... An der Schwelle zu ihren nächsten 50 Jahren werden auch die Salzburger Festspiele und ihre Verantwortlichen zu überlegen haben, wie sie nicht nur der großen Vergangenheit, sondern auch der stürmischen Gegenwart und der hoffnungsträchtigen Zukunft gerecht werden.“ (Wir werden in einer der nächsten Folgen der „Furche“ hierzu ganz konkrete Vorschläge machen.) Der eigentliche Festredner, als Sechster in der Reihe, die 1964 mit dem spanischen Kulturphilosophen Madariapa begann, war der Römer Dr. Pietro Quaroni, Jahrgang 1898, Offizier im ersten Weltkrieg, Botschafter in Moskau, Paris, Bonn und London, von 1964 bis 1969 Präsident des Italienischen Rundfunks und Fernsehens. Er sprach in zwangloser
Folge über vielerlei Themen und stellte unter anderem die These auf: „Festspiele wie die Salzburger müssen für eine Elite gestaltet und ihr vorbehalten werden... Ich glaube daher, daß wohl alle Massenmedien eingesetzt werden müssen, um die Salzburger Festspiele in ihrem Ursprung, ihrer Natur und ihren Zielen zu erklären — die Aufführungen selbst sollen jedoch denen vorbehalten bleiben, die gewillt sind, diese Wallfahrt zu unternehmen.“ Es ist immerhin bemerkenswert, daß ein Mann wie Quaroni dies sagt, der ja schließlich die Möglichkeiten des Rundfunks ebenso kennen muß wie die Unfähigkeit des. Fernsehens, authentische Operneindrücke zu vermitteln...
Die Eröffnungspremiere mit dem „Rosenkavalier“ von Hofmannsthal und Strauss war zugleich die 75. Aufführung dieses Werkes bei den Salzburger Festspielen, wo es 1929 zum erstenmal gegeben wurde, und zwar in der „Traumbesetzung“ Lotte Lehmann, Richard Mayr, Vera Schwarz (Oktavdan), Hermann Wiedemann (Faninal) und Adele Kern (Sophie).- Seither hat- es in Wien und Salzburg viele t glanzvolle Aufführungen gegeben, mit denen man die am vergangenen Samstag — was die Solisten betrifft — lieber nicht vergleichen sollen.
„Nicht das Bild einer vergangenen Zeit, auch nicht Rekonstruktion ihrer Sprache (sie sei in keinem Buch zu finden) habe er geben wollen, sagt Hofmannsthal in einem „ungeschriebenen Nachwort zum Rosenkavalier“. „Von den Sitten und Gebräuchen sind diejenigen zumeist echt und überliefert, die man als erfunden halten würde, und diejenigen erfunden, die echt erscheinen.“ Und was uns &ui so typisch „hofmanns-thalisch“ in Geste und Sprachgestalt erscheint, ist nicht so ganz seine eigene Erfindung. Uber den Anteil von Richard Strauss an der szenischen Form sind wir seit langem durch den Briefwechsel zwischen Dichter und Komponist unterrichtet. In Frankreich kannte man auch zwei wichtige Quellen: eine 1907 in Paris uraufgeführte Operette und einen Roman aus dem 18. Jahrhundert mit dem Titel „Las Avetnitures du Chevalier de Faublas“, — die Harry Graf Kessler Hofmannsthal zugänglich gemacht hatte. Seit aber vor einem Jahr durch Hilde Burger (Paris) im Insel-Verlag der vollständige Briefwechsel zwischen Kessler und Hofmannsthal veröffentlicht wurde, kennen wir auch ziemlich genau den Anteil, den Kessler am Textbuch hat, dessen Buchausgabe ihm gewidmet war. Doch wollte sich Kessler mit diesem an den „Mitarbeiter“ gerichteten Dank nicht begnügen und reklamierte bereits 1909 in einem gereizten Brief „die Konzeption selber und die Ausarbeitung des Pantomimischen, Grundlegenden, also die Substanz des Werkes“ — womit er offensichtlich zu weit gegangen ist. Was das Sprachkostüm betrifft, so hat Professor Adam Wandruszka in den Literarischen Blättern der „Furche“ (1968, Nr. 10) nachgewiesen, daß Hofmannsthal sich vielfach von den Memoiren J. J. Khevenhüllers („Aus der Zeit Maria Theresias“, 1. Band 1907) inspirieren ließ. Auch finden sich im Register dieses Buches fast alle im „Rosenkavalier“ vorkommenden Personen- und Ortsnamen.
Doch zur Aufführung selbst. Das Schönste daran war das Spiel der Philharmoniker unter der dramatisch-impulsiven Leitung von Doktor Karl Böhm, der am 28. August seinen 75. Geburtstag feiert. Von exemplarischer Schönheit waren auch die Bühnenbilder Teo Ottos, die wir vor nunmehr bald zehn Jahren, bei der Eröffnung des großen neuen Hauses, zum erstenmal gesehen haben. Das fast ein wenig zu prunkvolle, wie das Innere einer weißgoldenen Muschel wirkende Boudoir der Fürstin Werdenberg, das in den kühleren Farben Weiß und Grau gehaltene Fandnalscbe Stadtpalais und die (glücklicherweise) nicht allzu zerlumpte Vorstadtschenke geben einen Rahmen, der für alle Aktionen sehr zweckmäßig ist und der Vorstellung der beiden Autoren sicher weitgehend entspricht.
In der Hauptpartie war Christa Ludwig als Sängerin großartig, im 1. Akt als Gestalt nicht ganz glaubwürdig, zumindest nicht sehr eindrucksvoll oder gar ergreifend. Die zwei großen Monologe im 1. Akt, auf die es ankommt, gerieten ein wenig beiläufig;, und wurden vom Regisseur nicht genügend vorbereitet und akzentuiert. Sehr eindrucksvoll hingegen war sie im Finale: nicht nur prächtig singend, sondern auch im Spiel von distanzierender Würde. — Erst allmählich fand sich auch Theo Adam, weder als Erscheinung noch der Stimme nach zum Ochs prädestiniert, in seine Rolle: Im 1. Akt matt, im 2. sich freispielend, im 3. von fast ausgelassener Laune. — Zuwenig Charme in Stemme und Erscheinung hatte Tatiana Troyanos als Oktavian-Mardandl. Aber in dieser Hinsicht sind wir besonders verwöhnt und daher ahpruchsvoll (Jarmila Novotna, Lisa Deila Casa, Sena Jurinac, Christa Ludwig). Leider charakterisierte Otto Wiener den Faninal zuwenig als eitlen Neureichen. — Am meisten entsprach ihrer Rolle die junge und zierliche Edith Mathis (Sophie). Eine sehr junge, ungewohnt anmutige Leit-metzerin — mehr Freundin als Duenna der Fandnal-Tochter — stellte Kari Lövaas dar. Mit Laune und Temperament spielten Gerhard Unger und Cvetka Ahlin das italienische Intrigantenpaar. Als Belcan-tist brillierte Anton de Ridder (Sänger).
Dem Regisseur Rudolf Hartmann geriet im 1. Akt einiges teils zu unruhig, teils zuwenig intensiv. Es herrschte eine beinahe gleichmäßige Turbulenz. Vor allem die drei adeligen Waisen zeigten eine ihrem traurigen Stand völlig unangemessene Ausgelassenheit, und im 2. Akt verstand Hartmann es nicht, den lerchenauiischen Bedienten rustikales Gepräge zu geben. Das spezifisch Wienerische fiel bei diesem aus der halben Welt zusammengesuchten Ensemble (das keines war) fast zur Gänze unter den Tisch, und von den Nuancen, auf die es gerade im „Rosenkavalier“ so sehr ankommt, war kaum etwas zu spüren. Doch wurden vom Wohllaut des Terzetts im 3. Akt viele der hier vorgebrachten Einwände (die das Publikum nicht zu teilen braucht) übertönt: Vor allem dank der fast ekstatischen Interpretation dieser in Wohlklang schwelgenden Nummer durch Doktor Böhm und dank des edel-sonoren Timbres der Stimme von Frau Ludwig.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!