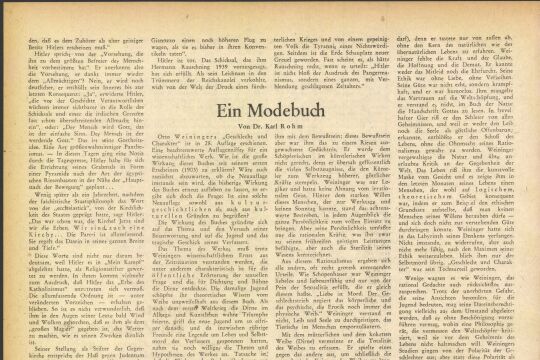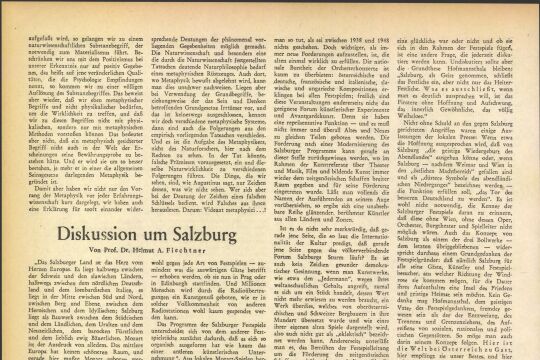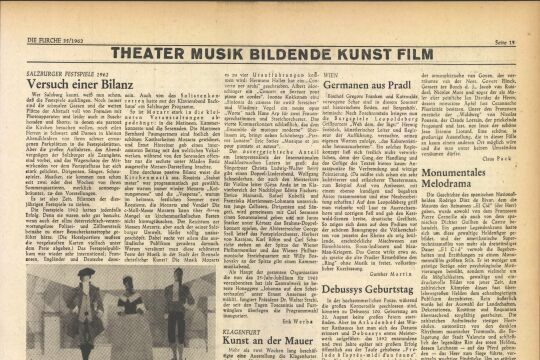Daß die Salzburger Festspiele sich im Kreuzfeuer der Kritik abspielen, sind wir seit vielen Jahren gewohnt. Heuer wurde die kritische Welle noch vor Beginn ausgelöst — noch ehe sich ein Vorhang hob und ein Ton erklang. Und zwar durch die Rundfrage einer in Deutschland erscheinenden Theaterzeitschrift. Unter dem provozierenden Titel „Salzburg — ein Trauerspiel?” exponierte der bekannte Theaterwissenschaftler und -kritiker Siegfried Melchinger seine Thesen und Vorschläge. Könne man achselzuckend zuschauen, so fragte er einleitend, „wie eine der großartigsten Schöpfungen des modernen Welttheaters dem Niedergang, wenn nicht dem Untergang überantwortet wird?” Dieser Niedergang, so meint der Ankläger, würde ernsthaft von niemandem bestritten. Der Grund hierfür: keine neuen Ideen, ein sich ständig verschlechterndes Programm, das ausschließlich nach den Wünschen der Massentouristen ausgerichtet ist, keine ernsthafte Mozart-Pflege usw. Wenn es immer noch „einzelne gelungene Abende” gäbe, so verdankten diese ihr Zustandekommen „irgendwelchen Glücksumständen”. Dann heißt es ein wenig sibyllinisch und im Widerspruch zu den eingangs vorgetragenen Beanstandungen: „Salzburg ist eine Massenattraktion geworden, weil es zuvor ein Kunstereignis war. Salzburg wird keine Massenattraktion mehr sein, wenn es kein Kunstereignis mehr sein wird!” Am Schluß seiner Ausführungen appelliert Melchinger an den österreichischen Bundespräsidenten, den Bundskanzler und den Salzburger Landeshauptmann als die Hauptverantwortlichen, „ihre Autorität vor das Programm zu stellen”. (Brieflich wurden auch noch der österreichische Außen- und der Finanzminister sowie der Vizebürgermeister von Wien und die Direktion der Festspiele von der betreffenden Zeitschriftenredaktion um Äußerungen angegangen.)
Bevor wir auf die einzelnen Argumente der Initiatoren dieser Umfrage und die vielen Rezepte und Vorschläge der aufgerufenen Ratgeber (Kritiker, Publizisten, Literaten usw.) eingehen, muß von uns die Fräge gestellt werden, was man in der Bundesrepublik dazu sagen würde, wenn zum Beispiel von einer in Graz redigierten Zeitschrift an den deutschen Bundespräsidenten, den Bundeskanzler, den Außenminister usw. appelliert würde, um zum Beispiel in Bayreuth oder bei den Münchener Sommerfestspielen nach dem Rechten zu sehen. Das Argument, daß die Salzburger Festspiele eine europäische Sache seien, hörte sich seinerzeit aus dem Mund Hofmannsthals anders an, als wenn es jetzt von Melchinger vorgebracht wird. Erfreulich, daß unsere „Offiziellen” jede Stellungnahme abgelehnt haben und daß wenigstens hier jenes Gefühl für Takt zu finden ist, das man bei dieser ganzen Aktion auf seiten der Initiatoren der Umfrage „Salzburg — ein Trauerspiel?” vermissen mußte.
Was für Ratschläge hat man zu erteilen? Eine dritte Epoche der Salzbürger Festspiele müsse beginnen (die erste endete 1938, die zweite datiert seit 1945). Das Hof- mannsthalsche Welttheaterkonzept sei žu erneuern und der „beste Mozart, den es auf der Welt gibt” zu erarbeiten. Der Kunstrat müsse reaktiviert und ein Programmdirektor eingesetzt werden. „Es muß ein Künstler sein. Es muß ein Mann sein, der das Welttheater ebenso gut kennt wie Salzburg. Es muß ein Mann sein, der Ideen hat und den Mut, sie durchzusetzen.”
Auf den Angriff Melchingers hat Hofrat Paumgartner, der derzeitige Präsident der Festspiele, ebenso klug wie gelassen reagiert. Er erinnert daran, daß die Phrase vom Untergang der Festspiele, „dieser von wohlwollenden Besserwissern aufgepäppelte Bazillus in trauter Symbiose mit der unleugbaren Tatsache der künstlerischen Entwicklung unserer Festspiele sich nahezu fünf Jahrzehnte lang am Leben erhalten hat”. Wie viele gute Ratschläge haben die Verantwortlichen in allen diesen Jahren einstecken, wieviel überhebliche Sachunkenntnis zur Kenntnis nehmen müssen. Meist berief man sich auf eine „goldene Zeit der Salzburger Festspiele”, an der gemessen alles Heutige nur Stückwerk sei. Aber niemand weiß, wann diese mythische Zeit wirklich gewesen ist.
Als einziger Überlebender aus der alten Garde, der bei der Gründung und der weiteren Ausgestaltung der Festspdele aktiv mitgewirkt hat, erinnert sich Hofrat Paumgartner noch genau an die ersten Jahre mit ihren Improvisationen und Provisorien. Als Reinhardt seinen ersten „Jedermann” auf dem Domplatz spielte, gab es noch kein Festspielhaus und keine Mozart-Opern. Die ersten Opernaufführungen im Landestheater stammten aus dem Repertoire der Wiener Staatsoper, die man mit allen Künstlern, Dekorationen und Kostümen nach flüchtiger Probenarbeit auf die Bühne des Landestheaters übertrug. Hofmannsthals Idee von bayrisch-öster- reichischen Barockfestspielen war und blieb ein schöner Traum. Das Programm war zu keiner Zeit so „puristisch” (nämlich um Mozart und den süddeutsch-italienischen Kern zentriert), wie man es heute wünscht, denn in jener „Glanzzeit” wurden sowohl „Tristan”, „Tannhäuser” und „Meistersinger” sowie Weber-Opern aufgeführt. Der vielberufene Kunstrat hat als „initiatives Gremium” nie existiert und ist in der „goldenen Ära” niemals kollektiv zusammengetreten. Die einzelnen Künstler (Reinhardt, Hofmannsthal, Strauss, Schalk und Roller) wurden nur um ihren Rat gebeten. Etwas Neues war, seit 1946, die Uraufführung einer zeitgenössischen Oper. Aber, wie man sich erinnert, stand zwischen 1957 und 1960 dieses Vorhaben unter keinem guten Stern. Neu ist auch die Präsentation weniger bekannter Opernwerke Mozart . Das kritische Schlagwort vom „Reprisenfestival” bedarf einer kritischen Prüfung. Da die einzelnen Stücke meist nur drei, höchstens vier oder fünf Aufführungen innerhalb der Festspielzeit erleben, kann von einem Abspielen wohl nicht gut die Rede sein. Es geht vielmehr — vor allem bei den Mozart-Opern — um eine immer genauere und subtilere Durchpro- bierung der einzelnen Werke, deren Interpretation durch Reprisen nur gewinnen kann. So bleibt dem gegenwärtigen Präsidenten und seinen Mitarbeitern nur zu hoffen, daß der „dritten Epoche”, die nun anbrechen soll, dasselbe widerfahren wird wie den vorausgegangenen: nämlich, auch einmal als „goldenes Zeitalter” gepriesen zu werden, während man sie zu ihren Lebzeiten totsagte.
Paumgartners „Konzept” sieht so aus: Mozart als Zentrum, nicht nur auf der Opernbühne. Als Massenattraktion (und da wir nun einmal das neue große Haus und die Felsenreitschule haben): die große Oper, und sei’s der „Troubadour”; heuer war es „Macbeth”, nächstes Jahr wird es ein in russischer Sprache gesungener „Boris Godu- now” sein, der zwar in den Salzburger Rahmen paßt wie die Faust aufs Auge, den man aber im Sinne erweiterter guter kultureller Ost- West-Beziehungen akzeptieren mag. Daneben das „zweite Geleise”: unbekannte ältere Werke, vor allem Mozarts, mit jungen Künstlern. Und nicht zuletzt: stärkere Berücksichtigung des Schauspiels, im nächsten Jahr exemplifiziert durch Aufführungen des „Oedipus” von Sophokles in der Neuübertragung durch Rudolf Bayr, inszeniert von Rudolf Sėllner, mit Bühnenbildern von Fritz Wotruba.
Aber von diesen Problemen war während der Salzbürger Festspiel zeit in den Foyers, in den Kaffeehäusern und in den Presseberichten wenig die Rede. Da ging es um anderes. „Als sich am Mittwoch vergangener Woche das Publikum aus der Generalprobe von Verdis ,Macbeth” in die Pausenräume des Großen Festspielhauses drängte, lief in Sekundenschnelle die Nachricht von Mund zu Mund, Herbert von Karajan habe soeben den ihfri angebotenen Sitz im Festspieldirektorium angenommen..So der Bericht einer Wiener Wochenzeitung. Den vereinten Anstrengungen von Stadt und Land, des Bürgermeisters und des Landeshauptmanns von Salzburg war es gelungen, Karajan von seiner totalen Absage an Österreich abzubringen und ihn zu bewegen, nicht nur heuer in Salzburg zu dirigieren, sondern auch künftig, zunächst fürs nächste Jahr, seine Mitwirkung zuzusagen. Dieses Resultat wurde natürlich dazu benutzt, den Wienern eins am Zeug zu flicken, „denn Stadt und Land Salzburg haben den Wienern vorexerziert, wie man Probleme, die in Wien im Intrigensumpf steckenblieben, löst”. Ein weiterer Satz aus einer Glosse der gleichen Wiener Wochenzeitung mit dem lapidaren Titel „Zwei Welten” verdient festgehalten zu werden, da er geradezu von Karl Kraus hätte erfunden sein können, der an seiner geliebten „Neuen Freien Presse” immer schon die glückliche Symbiose von Kunst und Geschäft geschätzt hat. Es sei gelungen, den durch den Wiener Intrigenapparat und demagogische Diskussionen zu Fall gebrachten Maestro wiederzugewinnen, „den man in Salzburg vorn gesunden künstlerisch-kommerziellen Standpunkt aus als die größte Attraktion der Festspiele wertet”.
Als erster Gratulant stellte sich dann auch — telegraphisch — unser geschäftiger Burgtheaterdirektor mit einem Angebot ein, dessen Wortlaut ebenfalls festgehalten zu werden verdient:
„Durch den Eintritt Herbert von Karajans in das Direktorium haben Sie, verehrter Herr Präsident, den Salzburger Festspielen für die kommenden Jahre den entscheidenden neuen künstlerischen Akzent gegeben. Mit Freude nehme ich Ihre Einladung an und stehe Ihnen und dem Direktorium in engster Zusammenarbeit mit Herbert von Karajan für die Verwirklichung gemeinsamer künstlerischer Pläne im größtmöglichen Ausmaß zur Verfügung.”
Die bereits zitierte Wiener Zeitung erklärt dazu offenherzig, „Karajan habe seinen Eintritt ins Direktorium von der Zusicherung abhängig gemacht, der nächste Festspielpräsident nach dem Ausscheiden Paumgartners werde Häusser- mann heißen”.
Ob dieser Entschluß, Karajan ins Direktorium zu ernennen, von Vorteil für die Festspiele sein wird, muß bezweifelt werden, denn aus einer ähnlichen Funktion ist er (1959) bereits einmal ausgeschieden. Es würde bedeuten, daß er zwar überall mitzureden, aber für nichts die Verantwortung zu tragen hätte (eine Konstellation, wie Karajan sie nach seiner Demission als Operndirektor auch in Wien angestrebt hat). Im übrigen wurden, so scheint uns, in Salzburg einige Bücklinge zuviel gemacht. Denn nicht nur Salzburg braucht Karajan, sondern auch er benötigt als Hintergrund und Instrument für sehr realistische Vorhaben die Salzburger Festspiele. Als er nämlich im Frühjahr dieses Jahres den vielberedeten Exklusivvertrag mit einer großen bundesdeutschen Plattenfirma schloß, tat er dies nicht nur als Dirigent, sondern auch mit dem Nimbus eines Wiener Opemdirektors und des ersten Mannes in Salzburg. Hierfür — und im Hinblick auf die Möglichkeit, ganze für die Wiener Staatsoper fertig einstudierte Opern billig auf Platten aufzunehmen — soll Karajan zum Einstand, gewissermaßen als „Morgengabe”, eine Million Pfund erhalten haben (das sind 72,5 Millionen Schilling). Diese genannte Summe ist natürlich nicht zu kontrollieren, sie wird aber nicht ganz aus der Luft gegriffen sein.
Es sind um Karajan viele und konkrete Interessen mit im Spiel, die mit Kunst nur noch sehr mittelbar zu tun haben. Deshalb muß man entschieden davor warnen, daß seine Angelegenheiten und Extratouren immer wieder, wie das leider auch in Salzburg geschehen ist, auf Bundes- (Kanzler-) Ebene hinauf- bugsiert werden. Dieses Geschäft wird nicht nur von Leuten besorgt, die uns glauben machen wollen, Karajans zeitweiliger Abgang sei eine nationale Katastrophe, sondern vor allem von jenen, die mit ihm ihre eigenen Felle davonschwimmen sehen.
Kaum aber waren die ersten Freudentränen über die Heimkehr des entlaufenen Sohnes getrocknet, da trat Karajan mit einer neuen Überraschung auf den Plan, mit einem Projekt, das auch die eifrigsten seiner Protektoren verblüfft haben dürfte. Er beabsichtigt nämlich, seine Salzburger „Elektra”, eine der wichtigsten Premieren dieser Spielzeit, mit allen Solisten, den Dekorationen (die der Wiener Staatsoper gehören) sowie mit dem Staatsopernorchester (das er in Wien nicht mehr leitet) an die „Scala” zu transferieren.
Über die Zumutung für alle Beteiligten, die in dieser Forderung steckt, braucht wohl kein Wort verloren zu werden. Es macht aber Sorge in bezug auf Künftiges. Doch das sind — zunächst — Salzburger Sorgen.