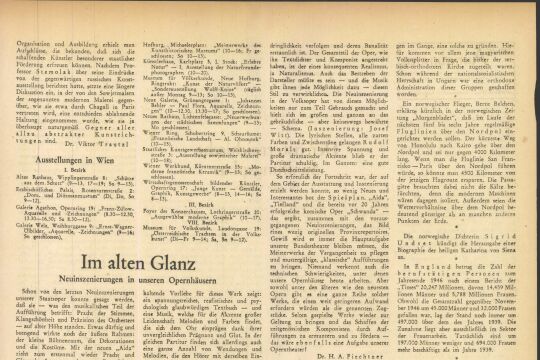Mit Beginn dieser Spielzeit am 1. September 1964, trat die Wiener Staatsoper in eine neue Phase. Jetzt, am Anfang des neuen Jahres und nach Ablauf der ersten Saisonhälfte, kann festgestellt werden, daß die Wiener Staatsoper, dieser ungelenke „Ackergaul“ (wie sie der Exdirektor in einem deutschen Nachrichtenmagazin nannte), in bester Form über die schwierigen Übergangshürden hinweggekommen ist. Auch die Wohlmeinenden und vernünftig Denkenden haben diesem Start nach der jahrelangen improvisatorischen Gebarung und nach der sich über viele Wochen hinziehenden akuten Direk-tionskrise mit Sorge entgegengesehen. Denn die zu überwindenden Schwierigkeiten waren enorm. Daß sie überwunden werden konnten, ist in erster Linie der Energie und Umsicht des „neuen“ Chefs sowie dem Einsatz des gesamten künstlerischen und technischen Personals zu danken, das sich hierdurch zu seinem Direktor und dessen Idee eines modernen Ensembletheaters bekannt hat. In den nächsten Wochen wird Dr. Hilberts Vertrag um weitere drei Jahre verlängert werden, und ab 1. Jänner 1965 wurde ihm als Vizedirektor Doktor Reif-Gintl zur Seite gestellt, der in gleicher Funktion bereits in der „heroischen Zeit“ der Staatsoper, im Theater an der Wien und während der letzten Jahre als Verwaltungsdirektor am Bungtheater tätig war. Im harmonischen Zusammenwirken dieser beiden Männer darf man wohl eine Garantie für ein gutes Funktionieren des „Apparats“ erblicken. Zum erstenmal, seit Jahren, gibt es einen genauen Zeitplan bis Ende Juni für alle Mitglieder des darstellenden Personals, zum erstenmal wurde, entgegen anderslautenden Meldungen, das Budget nicht überschritten, sondern beträchtliche Einsparungen erzielt, und die Einnahmen von September bis Dezember waren, ebenfalls entgegen anderslautenden Meldungen, um rund drei Millionen Schilling höher als im Vorjahr.
Das ist wichtig. Aber noch nicht alles. Die Fragen, welche wir aufwerfen und soweit wie möglich zu beantworten versuchen werden, lauten: Welche Alternativmöglichkeit zum System der rotierenden Star-Stagiones gibt es? Nach welchen allgemeinen Leitlinien soll künftig gearbeitet werden? Welche praktische Maßnahmen sind zu ergreifen? Wie soll der Spielplan gestaltet werden? Kurz: Wie kann aus dem Umschlagplatz für reisende Stars, dem Wagner- und Verdi-Festspielhaus, wieder eine echte österreichische Staatsoper werden.
Die Wiener Staatsoper, als repräsentatives Kulturinstitut Österreichs, liegt nicht nur zwischen Nord und Süd (wir meinen die Achse Bayreuth—Milano), sondern auch zwischen Ost und West. Sie soll daher, was ihr Repertoire und dde in ihr wirkenden Künstler (Sänger, Regisseure, Bühnenbildner und Dirigenten) betrifft, ein offenes Haus sein. Sie bietet zwar der hervorragenden künstlerischen Persönlichkeit exzeptionelle Möglichkeiten, sie ist aber kein Einmanntfaeater. Wir sind auch hier, wie in der hochentwickelten abendländischen Musik, für die Polyphonie, die Vielfalt und die Vielfärbigkeit, was Persönlichkeiten und Stile betrifft.
Es ist falsch, die Oper der Gegenwart als eine rein kulinarische Kunstform zu bewerten, das heißt abzuwerten. Schöne Stimmen und schöne Weisen allein genügen nicht. Sie genügen vor allem jenem geistigen Anspruch nicht, den ein nicht unbeträchtlicher und unbedingt zu berücksichtigender Kreis von Kunstfreunden an ein heutiges Opernhaus und sein Repertoire stellt. Wir meinen dabei nicht ausschließlich die Bereicherung des Spielplans durch zeitgenössische Werke, so wichtig dies auch ist, damit unser Opernhaus kein Museum wird. Die „Modernität“ — das heißt das in gutem Sinne unserer Zeit, ihrem Lebensgefühl und ihrem intellektuellen Anspruch Rechnungtragende — ist nicht allein bedingt durch das Entstehungsjahr des betreffenden Werkes, sondern durch den Geist einer Inszenierung, durch das Bühnenbild und die Interpretation jeder einzelnen Rolle. Hierher gehört auch die Rückkehr zur deutschen Sprache. Wenn es gelingt, den Primat des Schöpferischen gegenüber der Glorifizierung von Dirigenten und Sängerstars allmählich wiederherzustellen, • so wäre eine wichtige volksbildende und künstlerisch-ethische Aufgabe gelöst, die überdies auch jenen Respekt bezeugt, welchen man einem anspruchsvollen Großstadtpublikum (und nicht nur den Opernhabitues und -fans) schuldet. Nur so sind die Jahr für Jahr großzügig gewährten Millionensubventionen gerechtfertigt, die keinesfalls gekürzt werden sollen.
Nun zu einigen konkreten Fragen, zunächst der der Dirigenten. Es stimmt ganz einfach nicht, daß es keine erste Garnitur mehr gibt, die in der Lage wäre, den Verlust des Exdirektors wettzumachen. Während der vergangenen acht Jahre waren gar nicht oder viel zuwenig an der Wiener Oper die folgenden Dirigenten beschäftigt (wir nennen ihre Namen in alphabetischer Reihenfolge): Ansermet, Böhm, Boulez, Cluytens, Bernstein, Giulini, Knap-pertsbusch, Klemperer, Krips, Leitner, Maderna, Molinari-Pradelli, Rossi, Scherchen, Solti, Schmidt-Isserstedt, Sawallisch, Swarowsky, Szell und Wallberg. Keiner aus dieser — unvollständigen — Liste wird auf die Gelegenheit verzichten, in der Staatsoper das Orchester der Wiener Philharmoniker zu dirigieren. — An Reoisseuren, die das Niveau und das Interesse zu heben imstande sind und von denen man sowohl werkgerechte wie zeitgemäße Inszenierungen erwarten kann, nennen wir: Walter Felsenstein, Doktor Günther Rennert, Gustav Rudolf Sellner, O. F. Schuh, Otto Schenk und Wieland Wagner. — Außer den Bühnenbildnern, die sich an der Wiener Staatsoper bereits bewährt haben, wäre der Kontakt etwa zu den folgenden, meist jüngeren heimischen Künstlern herzustellen: Fritz Wotruba, Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter, Hubert Aratym, Josef Mikl. Kurt Moldovan und Fritz Hundertwasser. (Auch diese Reihe ist un^ vollständig.) Es wäre ein ebenso schönes wie lohnendes Beginnen, sie mit den richtigen Aufgaben zu betrauen.
Nun zum neueren Repertoire. Es war sicher unerläßlich, Wagners und Verdis sowie Richard Strauss' anläßlich ihrer Zentenarfeiern in würdiger Form zu gedenken. Und es tat diesen Festzyklen keinen Abbruch, daß auch jedes mittlere deutsche Opernhaus sie, wenn auch keineswegs mit solchem Aufwand und künstlerischem Gelingen, veranstaltet hat. Aber wäre es nicht, gerade in der Wiener Staatsoper, verdienstvoller und im Sinne auch der Information ihrer Besucher wünschenswerter, etwa einmal einen gut vorbereiteten Zyklus der Opern Leos Janäceks zu veranstalten, der nicht nur „Jenufa“ und „Das schlaue Füchslein“ geschrieben hat, sondern auch „Katja Kabanova“, „Die Sache Makropulos“, „Die Abenteuer des Herrn Broucek“ und „Aus einem Totenhaus“? Es muß auch daran erinnert werden, daß es von Pfitzner nicht nur den „Palestrina“ gibt (dessen Neuinszenierung unter der Regie Hans Hotters, mit Bühnenbildern von Schneider-Siemssen und unter der musikalischen Leitung von Robert Heger ein voller Erfolg und eine eindrucksvolle Demonstration des Enaembletheaters war), sondern auch ..er arme Heinrich“, „Die Rose vom Liebesgarten“ und „Das Herz“, die sowohl dem Regisseur wie dem Bühnenbildner interessante und lohnende Aufgaben stellen.
Daß ein Wiener Opernhaus auch die österreichischen Komponisten nicht so völlig unbetreut lassen sollte, wie es bisher geschah, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir meinen — auch wenn nicht jeder Versuch einer Wiederbelebung von vollem Erfolg gekrönt sein sollte — die Werke von Franz Schreker, Franz Schmidt, Alexander von Zemlinsky, Erich Wolfgang Korngold (zumindest „Die tote Stadt“) und die des in Oxford lebenden, vor kurzem mit dem großen österreichischen Staatspreis ausgezeichneten Egon Wellesz („Heroische Trilogie“). Auch an Ernst Krenek ist noch eine Schuld abzutragen: Sein speziell für die Wiener Staatsoper auf Bestellung von Clemens Krauss geschriebener „Karl V.“ ist in der Heimatstadt des Komponisten immer noch nicht aufgeführt worden.
Blicken wir nach dem Osten und dem Südosten, so wird, mit Ausnahme Rußlands und der Tschechoslowakei, die zum Musiktheater des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts wichtigste Beiträge geliefert haben, das Reservoire an Opernwerken vielleicht nicht sehr groß sein. Aber welcher Reichtum, der immer wieder aus der schönen und gesunden Volkskunst gespeist wird, tritt uns hier auf dem Gebiet des Balletts entgegen. Mit den choreographischen Werken neuerer Rumänen, Bulgaren, Ungarn, Polen und Jugoslawen allein ließen sich ganze Ballettwochen bestreiten.
Damit sind wir beim „Mauerblümchen“ der Wiener Staatsoper angelangt, dem Ballett. Dieses große, aus über 70 Tänzerinnen und Tänzern bestehende Ensemble, das seine Leistungsfähigkeit bei der Neuinszenierung von „Schwanensee“ unter Nurejewes Leitung zu Beginn der Spielzeit glänzend dokumentiert hat, wird viel zu wenig eingesetzt. Der neue noch von Professor Schäfer engagierte Ballettdirektor Aurel von Milloss hat jetzt schon ein Repertoire erarbeitet, mit dem sich mühelos fünf bis sechs interessante Ballettabende bestreiten lassen! Das Ziel aber muß sein: ein wöchentlicher „jour fix“ für das Ballett, nach dem Vorbild der Pariser Grand Opera. Dies würde zugleich auch einen Beitrag zur Modernisierung des gesamten Spielplans bedeuten, denn der Anteil an modernen neuen Werken ist beim Ballett größer als bei Opern. Zugleich würde das Gesamtbudget entlastet, denn Ballettabende, soweit sie mit eigenen Kräften bestritten werden können, sind billig: die jederzeit zur Verfügung stehenden Tänzer erhalten keine Abendgage und man benötigt keinen Spitzendirigenten.
Eine der wichtigsten Fragen, die des sängerischen Nachwuchses soll wenigstens noch gestreift werden. Statt Stimmen zu verbrauchen, wie es viele unserer „großen“ Dirigenten praktizieren, geht es darum, solche heranzubilden und zu pflegen, wie es seinerzeit Dr. Böhm und Clemens Krauss getan haben. Der „Schlägerung“ muß eine „Baumschule“ entgegengestellt werden. Diese sollte einem stimmkundigen Pädagogen anvertraut werden, der vor allem an den deutschsprachigen Bühnen, aber auch in Skandinavien, in Amerika und in den Oststaaten, die immer schon ein Reservoir an schönen Stimmen waren, nach jungen Begabungen Ausschau hält. Die zehn bis zwanzig Besten erhalten zu ihrer derzeitigen Gage an der fremden Bühne ein zusätzliches Gehalt, etwa zwei Jahre lang, mit der Verpflichtung, nach Ablauf dieser Frist der Wiener Staatsoper zur Verfügung zu stehen. Einzelne von diesen jungen Künstlern werden sich wahrscheinlich bald in das Ensemble einbauen lassen, mit den anderen mache man Studioaufführungen. Dieser Nachwuchs könnte von den Erfahrungen und dem Künstlertum einiger älterer Ensemblemitglieder unserer Staatsoper Wesentliches profitieren und so in eine lebendige Tradition hineinwachsen. Wir denken dabei etwa (und nennen, da es sich um ältere Sänger handelt, nur die Namen männlicher Künstler) an Hans Hotter, Julius Patzak, Peter Klein und Paul Schöffler.
Alle diese allgemeinen Ideen und Konzepte werden von uns keineswegs überschätzt, denn da das Ganze nicht mehr ist als die Summe seiner Teile, ergibt sich die nüchterne Bilanz eines Opernjahres aus dem Verhältnis zwischen glanzvollen, eben nur geglückten und schwachen Abenden. Aber hier möge uns ein Wort Günther Rennerts zum Trost gereichen: „Von einem Theater, das unter der Fron unseres Abonnementssystems zu arbeiten gezwungen ist, ist es utopisch, jeden Tag ein Festspiel zu erwarten. Die Handschrift eines Hauses wird sich immer in den entscheidenden Neuinszenierungen eines Spiel Jahres prägen. Publikum und Presse müssen wissen, daß auch diese (höchstens 6 bis 8 jährlich) nicht alle gelingen können.“ Die schwachen Abende auf ein Minimum herabzudrücken, muß und wird die erste und ständige Sorge der neuen Direktion sein. Möge es außerdem auch gelingen, unsere Oper im angedeuteten Sinn wieder zu einer echten österreichischen Staatsoper zu machen.