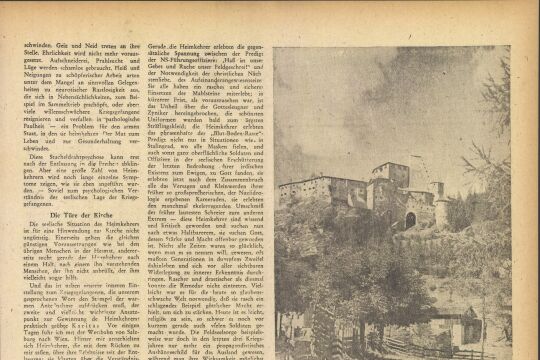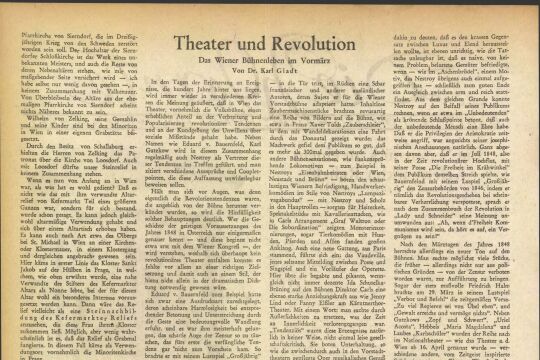Ceit nunmehr rund 20 Jahren weist das in seiner Vielfalt er-staunliche Theaterleben Österreichs eine Sonderform auf, der bisher eine größere Beachtung leider kaum zuteil wurde: das Studententheater. Dieser Begriff hat sich, wenn auch nur in Ausnahmen, als eine in bezug auf Stückzahl und Spielform ganz spezifische, soziologisch gesehen, einzigartige Gattung des Theaters unserer Zeit statuiert. Eine Gattung, deren Einfluß auf das Theater der „Professionals“ — bei entsprechender Anwendung von Mittel und Möglichkeiten — gewiß von Bedeutung wäre.
Im Laufe dieser 20 Jahre hat sich, entgegen düsteren Prophezeiungen und beträchtlichen Schwierigkeiten, so etwas wie eine Tradition entwickelt, die, betrachten wir sie unter dem Aspekt der Theatergeschichte, nicht zuletzt im jesuitischen Barocktheater eines Nicolaus Avancinus, den aktionsschwangeren Lesedramen,, den Schüleraufführungen in Lateinschulen und Abteien ihre Ursprünge findet. Eine Tradition allerdings auch, die uns — gesehen von jenem ersten „Studio der Hochschulen“ (Wien) in den Jahren 1945 bis 1951 — einen einigermaßen traurigen Blick auf die gegenwärtige Situation studentischen Theaters tun läßt. Deutlicher als überall sonst spiegelt sich in ihr der soziologische „Aufstieg“ des österreichischen Studenten.
Im Gegensatz zum romanischen und angloamerikanischen Raum (speziell den USA, die in der Form der „Drama Departments“ seit jeher eine besonders enge Verbindung von Universität und Theater kennt), der diese theatralische Sonderform bereits vor 1945 zu schätzen wußte, blieben in Österreich alle Versuche bis dahin vergeblich. Eine erste Verwirklichung der Idee jenes Theaters, das in Darstellung wie in Inszene nur Studenten anerkennt (die im Falle der Nachkriegsversuche allerdings eine durchaus professionelle Theaterkarriere vor Augen hatten), erfolgte durch das „Studio der Hochschulen“ in Wien. Aus diesem Experiment ist eine Reihe heute bekannter Bühnenkünstler hervorgegangen, so Helmut Qualtinger, Lona Dubois, Michael Kehlmann und Wolfram Skalicki.
Die Inszenierung von Hofmannsthals „Der Tor und der Tod“ vom 7. Juni 1945 leitete eine Serie von Bühnenerfolgen ein, die — von einigen Kabaretts unterbrochen — fast ausnahmslos konventioneller Natur waren. Ob Nestroys „Jux“, Goethes „Ur-faust“, Mells „Apostelspiel“, ob Sternheims „Hose“ oder Shaws „Candida“ — der Erfolg war sozusagen im bislang Unmöglichen gegeben: in der Freiheit von Stückwahl und Interpretation. „Außergewöhnlich“, könnte man einzig die Wiener Erstaufführung von Sartres „Hinter verschlossenen Türen“, einige Anouilh-Stücke, Büchners „Woyzek“ und Horvaths „Unbekannte aus der Seine“ nennen. Das Bemühen galt einem „linienfesten Spielplan“, dem „guten, modernen, internationalen und österreichischen Theater“. „Abseits von den befahrenen und ungefährlichen Straßen der Konvention“ lag — zumindest aus der Sicht von heute — nur Weniges. Aus der Krise unserer Tage bedingt, ist man heute nur zu schnell bereit, künstlerische Leistungen aus der Bedingtheit ihrer Zeit zu lösen und als unwiederbringlich Einmaliges zu glorifizieren.
Eigentliches Movens des studentischen Theaters jener Zeit war, abgesehen von der Natürlichkeit des Spieltriebs junger Menschen, der „Hunger nach jenen geistigen Gütern, die durch ein irrsinniges Regime jahrelang unerreichbar gewesen waren ... der Versuch, endlich nicht nach der Trommel marschieren zu müssen, sondern aus eigener Kraft und Verantwortung schaffen zu können“ (Heinz Gerstinger).
Die Breitenwirkung des „Studios der Hochschulen“ erwies sich jedoch ungleich höher als die des „Wiener Studententheaters“, wie es uns in den letzten Jahren entgegentrat. Auslandstourneen (Schweiz, Holland, Belgien, England, Italien, Deutschland) wurden durch zahlreiche innerösterreichische Gastspiele ergänzt. An insgesamt 800 Abenden gingen 66 Stücke über jene Bühne, die den Beweis erbringen sollte, „daß Österreichs Kultur nicht in dem ewigen Aufzählen alter, erstarrter Großleistungen erschöpft ist, sondern auch Ansätze zeigt, die alte Geltung wieder zu erringen“.
Auf eine ähnliche Entwicklung blickt das „Hochschulstudio Graz“ zurück: Eine Handvoll begeisterter Studenten eröffnete es im August 1946 mit Büchners „Leonce und Lena“. Man war, anders als in Wien, nicht nur bereit, in die Breite, sondern ebensosehr auch in die Tiefe zu gehen. Davon zeugt „Zweierlei Maß“ — Hans Rothes Übersetzung von Shakespeares „Maß für Maß“, vermehrt durch einzelne, in den Pausen gelesene Szenen der Schlegel-Tieckschen Übertragung. Ebenso interessant das übrige Programm: Neben Kaisers „Juana“ und Klabunds „XYZ“ wagten sich die Studenten (wie in Wien) an die erste Grazer Sartre-Aufführung („Hinter verschlossenen Türen“). In der Folge „Das Bergwerk“, ein Drama des frühverstorbenen österreichischen Expressionisten Hans Kaltnecker, Tagores „Chittra“ (unter der Regie von Karlheinz Böhm übrigens I), Borcherts „Draußen vor der Tür“ und Calderöns „Großes Welttheater“. Weitere „Spezialitäten“: „St. Nicolaus“, eine dramatische Arbeit des kürzlich verstorbenen Lyrikers E. E. Cummings, die Uraufführung von Kafkas Fragment, „Die Gruftwächter“, und Kaisers „Floß der Medusa“, das durchweg mit Kindern besetzt wurde. Im Goethe-Jahr 1949 schließlich sahen über 4000 Besucher auf der von Studenten wiedererrichteten Schloßbergbühne den „Urgötz“.
So vielfältig das Programm — so uneinheitlich jedoch seine Konzeption. Der chronische Personalmangel erzwang 1950 die Auflösung des Studios. „Es gab an den Hochschulen nur mehr Studierende, aber keine Spielenden mehr“ (Heinz Gerstinger).
„Der Würfel“, eine Kabarettistengruppe, trat acht Jahre später die Nachfolge des Studios an. Neben gelungenen „Bretteln“ präsentierte er sich mit — Becketts „Endspiel“. Im Herbst 1960 übersiedelte die Gruppe in Gerhard Bronners „Kärntnertortheater“ nach Wien. Aus den Amateuren wurden Professionals. 13 Programme — fünf davon in Wien — wurden von ihnen bisher produziert, obgleich „Wien das denkbar ungünstigste Kabarettpflaster darstellt“ (Peter Orthofer).
In Graz erweckte man inzwischen das „Hochschulstudio“ zu neuem Theaterleben und zeigte unter anderem Tankred Dorsts „Kurve“, Ghelderodes „Escorial“ und zwei Moliere-Szenen, „Sganarelle“ und „Impromptu de Versailles“.
Kurz nach Kriegsende beherbergte auch Innsbruck ein Studententheater („Schauspielkreis“), das sich bislang allerdings nur in kurzlebigen Ansätzen manifestierte. Erwähnenswert noch eine Wiener Besonderheit: der „Rote Hund“. Sozialistische Studenten versuchten 1947/4S hier eine Art dramatisierter Politik vorzustellen; diese Kurzszenen und Chansons leiteten über zu einem Kabarett, das jedoch keinerlei Ambitionen mehr verriet. 1954 erwachte der „Rote Hund“ für kurze Zeit wieder zum Leben.
Das neue „Wiener Studententheater“ der Österreichischen Hochschülerschaft eröffnete am 17. März 1961 mit Nestroys „Freiheit in Krähwinkel“. Es war dies — in der umgestalteten „Courage“ — jene „Smokingpremiere“, die zu mehr oder minder berechtigten Attacken Anlaß gab. Interne Schwierigkeiten des Theaters („personeller Natur“), ein nimmermüdes studentisches Parteiengeplänkel erzwangen Anfang 1961 den Rücktritt - des verantwortlichen Kulturreferenten und Studioleiters. Die trotz staatlicher Subventionierung labile Situation der Bühne verschlechterte sich mehr und mehr ... Mit einem frischen Start unter dem „neuen“ Studioleiter, der seine früheren Ansprüche durchgesetzt sieht, hofft man nun auf größeres künstlerisches Echo nicht allein innerhalb der eigenen vier Wände, sondern auch unter den Studenten.
Diese jenem klassischen Froschmäusekrieg nicht unähnlichen Verhältnisse blieben nicht ohne Einfluß auf die künstlerische Sphäre. Der „Freiheit in Krähwinkel“ folgte eine statisch-belas-sene „Verkündigung“ (Claudel) — erst mit dem Gastspiel der Theatergruppe an der Akademie der bildenden Künste mit Borcherts „Draußen vor der Tür“ ließ sich ein Erfolg verzeichnen. (Diese Gruppe verdankt übrigens einer persischen Studentin [.'] ihr Entstehen.) Anouilhs „Medea“ ging bereits wieder über die bescheidenen Kräfte des Ensembles.
Das zweite Spieljahr brachte an Positivem die Gastspiele der „Frankfurter Studiobühne“ (Ionescos „Opfer der Pflicht“) und des polnischen Ensembles „Kalambur“ sowie als bemerkenswerte Eigenproduktion „Der junge Gelehrte“ (Lessing). „La finta semplice“ ergötzte wie schon ein Jahr zuvor, die Musikfreunde, im Bereich des Dramatischen holte man wieder einmal Wilders „Unsere kleine Stadt“ aus der Versenkung. Daß O'Neills Vierstundendrama, „Trauer muß Elektra tragen“ (Ensemble „Linz 62“), nicht zu bewältigen war, konnte mit Gewißheit vorausgesehen werden. Als einzige Novität: Shelagh De-laneys „Bitterer Honig“ (Ensemble „Dramatische Werkstatt“), und auch dies nur im Zuge der allgemeinen Aktualitätenmanie.
Maßgebliche Kreise der „Österreichischen Hochschülerschaft“ sahen im „Studententheater“ nicht so sehr künstlerische als „rein politische Intentionen“. In der Spielplanredigierung erwirkte sich die Österreichische Hochschülerschaft einen ausdrücklichen Vorbehalt, der zwar „nie zur Anwendung kam“, jedoch Adamovs „Alle gegen alle“ — obwohl bereits in Vorbereitung — aus dem Programm entfernte. Brecht, so versichert man, „wäre unmöglich gewesen“.
In jeder Hinsicht erfreulicher: die „Arche“, die Studentenbühne in der Ebendorferstraße. 1957 gegründet, trägt sie in Wien als einziges studentisches Theater seinen Namen zu Recht. Aus den zahlreichen Inszenierungen seien nur erwähnt: Brecht-Weills Schuloper „Der Ja-Sager', die H.-C.-Artmann-Ur-aufführungen „Kein Pfeffer für Cermak“, „Die mißglückte
Luftreise“, „Lasse und Mustikka“, „Interior fotografico“, weiter die deutsche Erstaufführung von Lope de Vegas „Roselo und Julia“, drei Lorca-Kurzstücke, Adamovs „Professor Taranne“, Barlachs „Armer Vetter“ und Tollers „Hinkemann“. „Der beschäftigte Hausregent“ von Philipp Hafner widmete sich der Tradition des Wiener Volksstücks, „Der Kyklop“ des Euripide» der Diskussion der griechischen Bühnenform.
Was ist nun tatsächlich Aufgabe des studentischen Theaters? In erster Linie wohl den Versuch zu machen, jene Rolle im Umformungsprozeß unserer Gesellschaft zu übernehmen, die die Berufstheater nicht spielen wollen oder können. In nuce ergibt sich hier die Möglichkeit, die geistigen wie soziologischen Veränderungen und Evolutionen der nächsten Zukunft, die sich bereits heute in den dramatischen Vorlagen und ebenso in der Bewußtseinssphäre des jungen Menschen spiegeln, vorauszusehen und — im Idealfall — auch vorauszuentscheiden. Daß diese Forderung gegenwärtig weder die österreichischen Studentenbühnen noch die — wenngleich in weitaus fortgeschritteneren Art — der Bundesrepublik zu realisieren imstande sind, erscheint als das Grundproblem der Krise des Studententheaters deutscher Sprache überhaupt.
Erst in zweiter Linie kommt es dieser Sonderform unseres Theaters zu, jenen übrigen Forderungen zu entsprechen, deren man eine ganze Liste aufstellen könnte. Grundlegend muß sich jede Bühne ihrer Grenzen, ihrer Möglichkeiten bewußt sein. „Nichts ist schlimmer als kunstvoll kaschierter Dilettantismus. Bewußt die schauspielerischen Möglichkeiten eingestehen, dieses Eingeständnis in die Konzeption einer Inszenierung einbauen — darin liegen die Chancen für ein ehrliches, ohne große Illusionen arbeitendes Studententheater“ (Karlheinz Braun).
Die engen physischen und technischen Gegebenheiten lassen also nur Raum für jene Stücke, die die großen Bühnen nicht wahrnehmen wollen oder können, Stücke, die kein Publikum finden. Das Studententheater, weitaus mehr als bloß künstlerische Freizeitbeschäftigung der Studierenden, begibt sich — wie leicht feststellbar ist — in die Gefahr, im „modernisme“, in Avantgarde um jeden Preis aufzugehen, oder aber in reinem Akademismus zu versinken. In der Wiener Biberstraße schließlich war man sogar bereit, sich gleich professionellen Theatern dem Erfolg zu verschreiben.
Viele dieser Theaterdilettanten (die sie im Friedellschen Sinne doch sein wollen) werden in der Gewissenserforschung eines Gesprächs nur zu gerne zugeben, Theater sei für sie nicht zuletzt Protest: Protest gegen die Gesellschaft, Protest gegen Bestehendes. Unbedacht wird dabei Protest gleich Experiment und Avantgarde gesetzt, obwohl vielfach nur „eine Verwechslung zwischen Auflehnung gegen die Gesellschaft und Flucht vor der Wirklichkeit vorliegt“ („konkret“).
Allzu große Hoffnungen in die Zukunft eines österreichischen Studententheaters zu setzen, das seinen eigentlichen Forderungen gerecht wird, scheint mehr als fraglich. Nicht zuletzt daher, weil weder Hochschulen noch Berufstheater an jene nicht bloß naturgegebene, sondern geradezu notwendige Unterstützung dieser Kunstform denken.
Das Programm des „Wiener Studententheaters“ für die laufende Saison: Moliere („Amphitryon“), Sartre („Tote ohne Begräbnis“), Holberg („Odysseus auf Ithaka“), Fabbri („Inquisition“), Toller („Entfesselter Wotan“). Hat man überhaupt die Absicht, sich mit etwas auseinanderzusetzen? Gegenwartsprobleme scheinen allerdings nicht gefragt zu sein. Die „Arche“ will Ghelderodes „Rote Magie“ spielen; Graz wartet neben Dylan Thomas' „Unter dem Milchwald“ immerhin mit einem italienischen Neoverismostück und einem Brecht-Versuch auf. Unabsehbar, zu welchen Ufern das österreichische Studententheater zu steuern gedenkt.