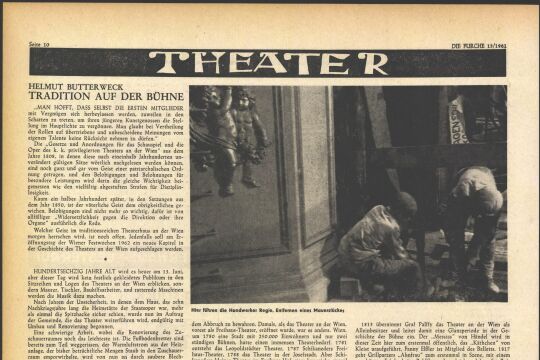Erfahrungen eines Österreichers in der deutschen Theaterwelt.
Sie lesen die Romane von Dostojewski, Philip Roth und Michel Houellebecq, sie hören Musik von Monteverdi bis Tocotronic. Bei der Documenta in Kassel stehen sie Schlange, um wirklich alle Video-Installationen sehen zu können. Sie haben auch keine Mühe, in Den Haag vier Stunden auf den Einlass in eine total überfüllte Vermeer-Ausstellung zu warten, und in Amsterdams Rijks-Museum gehen sie an drei Tagen hintereinander für mehrere Stunden rein. Über die Trends der afrikanischen Fotografie wissen sie dank teurer Zeitschriften Bescheid. Die Filme in ihrem Video-Regal weisen sie als Cineasten aus.
In das Theater aber, ins Schauspiel, gehen sie, meine kunstbegeisterten Freunde, nicht. Nicht mehr. Früher konnte ich mit ihnen über Ariane Mnouchkine und Benno Besson, über Tschechow- und Bernhard-Inszenierungen streiten. Heute gestehen sie, dass sie schon seit vier oder gar sechs Jahren keine Schauspiel-Aufführung mehr gesehen haben. Und in die Oper? Doch, da gehen sie gelegentlich hin. Schwärmerisch nennen sie ein paar illustre Namen von Sängerinnen - sie kennen sich aus!
Ihr "schlechtes Gewissen" ist natürlich reine Heuchelei. Es tut ihnen nämlich überhaupt nicht leid, dass sie vom Theater keine Ahnung haben. Zugegeben, ich tue auch so, als wäre mir ihr Desinteresse für mein Metier supergleichgültig. Alles hat ja seine Gründe: Kristina zum Beispiel hat sich mit Leib und Seele Johannes Brahms und den vielen Konzerten im Wiener Musikverein verschrieben, da bleiben wenig freie Abende übrig. Annette geht nur noch in Berlin ins Theater, aber auch nur dann, wenn ihr Liebling Kent Nagano gerade nicht dirigiert. Matthias leistet sich dreimal im Jahr eine teure Reise in die Oper, z. B. nach London, Paris oder Aix en Provence. Klaus und Martina hatten früher sogar einmal ein Theater-Abonnement, sind aber schon vor Jahren aufs Land gezogen. Wenn sie mal einen freien Abend in der Stadt haben, gehen sie lieber mit Freunden zum Italiener, wo sie bestimmt über Giotto und Brunello di Montalcino reden. Susanne ist durch ihre neue Leitungsposition zum Workaholic mutiert und bleibt meist bis abends im Büro; wenn nicht, geht sie lieber noch joggen. Ulrike und Martin haben mit den zwei kleinen Kindern derartig viel um die Ohren, dass sie am Abend fast gar nicht mehr weggehen können. Und Paul will ganz ehrlich sein, denn, auch wenn mir das jetzt sicher nicht gefallen werde, er habe zuletzt nur noch total langweilige, weil stupid vergagte Aufführungen gesehen und deswegen vom Theater die Schnauze gestrichen voll. Aber sowas von voll!
Jetzt, im Herbst, laufen die Maschinerien der staatlichen, städtischen und privaten Bühnen auf höchsten Touren. Keine Zeit ist am Theater so aufreibend wie die Monate September bis November, und zwar sowohl für Künstler und Management als auch für Technik und Werkstätten. Schließlich müssen die ersten Premieren der Theatersaison kräftig einschlagen, die Stimmung muss auf Touren kommen, draußen in der Öffentlichkeit und drinnen im Haus. Und der zeitgemäße Stratege weiß: Eine Saison kann ein noch so großartiges Konzept haben, tolle Stücke, geniale Schauspieler, verrückte Regisseure und fabelhafte Inszenierungen aufbieten - wenn die ersten Premieren Publikum und Medien nicht aus ihrer Lethargie reißen, erholt man sich den Rest der Saison nicht mehr. Ehrenwort.
Man mag über die vielfältigen Gründe, warum das Theater immer so furchtbar auffallen muss, oder anders gesagt: warum es an eigenständiger Attraktivität so sehr verloren hat, lange spekulieren. Und klar ist auch: der Werbekrampf der Theaterdirektoren, mit ihrem Saison-Angebot wieder einmal besonders unwiderstehlich sein zu müssen, verschlingt viel an künstlerischer Substanz. Aber die Spirale dreht sich weiter und weiter, denn die staatlichen bzw. städtischen Subventionen für die Hochkultur werden in den nächsten Jahren noch weiter gekürzt werden. Die Theater sollen aber trotz wachsender Konkurrenz ihre einmal berechnete Wirtschaftlichkeit beweisen und dadurch, nicht etwa wegen großartiger Kunst, das Schmuckblatt der bürgerlichen Gemeinschaft bleiben. Kultur, die sich rechnet. Dieser Spagat, den der Bürgerstolz des 19. Jahrhunderts vom Theatermanagement des Jahres 2002 verlangt, ist nur noch mit sehr viel Bluff zustande zu bringen. Claus Peymann, ein Beispiel, ist so ein Meister des Adriano-Celentano-Prinzips, das da lautet: "Das Entscheidende an einem Bluff ist es, dass man ihn cool durchzieht".
In der Not fällt allen dasselbe Zauberwort ein: Marketing. Marketing-Abteilungen gibt es inzwischen fast an jedem Theater und - sie sind eine gewaltige Wachstumsbranche! Diese Menschen müssen gemeinsam mit den Werbe- & Presse-Agenten des Hauses dafür sorgen, dass das Image des Theaters hip und in und cool ist, kurz, dass der Pegel des Tratsch-Prestiges nicht fällt. Wichtig ist da vor allem auch die Stimmung bei denen, die nicht ins Theater gehen. An all diesen Image- & PR- & Selbstdarstellungskram, diese sekundäre Existenz des Theaters, muss man immer denken, verlangt der Marketing-Stratege. Aber ist das Theater wirklich nur eine Schuhfabrik, die sich gegen einen Billigmarkt zu behaupten hat? Wollten wir nicht Kunst als "Steigerung unseres Daseins" verstehen, als Gewinn an sinnlicher Lebenserfahrung, als Bereicherung unseres Erlebens und Denkens?
Am Theater arbeitet man, um seine künstlerische Arbeit möglichst genau zu machen. Die besteht zum Beispiel auch darin, dass man jeden Herbst, während eine Inszenierung nach der anderen in die Schlussproben geht, die Pläne für die darauffolgenden Spielzeiten weiterentwickelt. Vertragsgespräche stehen an, Kündigungen werden ausgesprochen, Abschiede bekanntgegeben, man sucht neue Leute, Vorsingen und Vorsprechen werden organisiert, die Verlage bieten neue Stücke an, die man schnellstens lesen soll, um sich Ur- oder Erstaufführungsrechte zu sichern. Ideen, Konzepte für die weitere, längerfristige Arbeit müssen diskutiert werden, gerade jetzt, erholt aus dem Urlaub zurück, sollte man eigentlich den Kopf frei haben für kühne Phantasien und Utopien, Zeit für ungeordnete Gespräche finden, über Zukunft reden, über das, was eigentlich nicht geht am Theater, man sollte mit den Kollegen zusammensitzen und nachdenken, was heute Aufgabe, Funktion und Ziel des Theaters ist.
Vier Jahre, von 1998 bis 2002, habe ich als Schauspieldirektor am Theater Freiburg im Breisgau versucht, auch für solche Gespräche Zeit zu finden. Es waren vier gute Jahre. Das Freiburger Modell hat sich bewährt: Ein festes Team von Regisseuren, Bühnenbildnern, Musikern und Dramaturgen war bei wesentlichen Entscheidungen für Engagements und Spielplan mitverantwortlich. Damit die Atmosphäre nicht zu hermetisch wird, haben wir jedes Jahr mindestens drei Gastregisseure eingeladen, dabei aber auch darauf geachtet, dass unterschiedliche ästhetische Linien eine mehrjährige Kontinuität behalten. Viele junge Regisseure, Bühnenbildner und Kostümbildner haben wir engagiert. Der damals kaum bekannte Regisseur Michael Thalheimer fand mit seinen erfolgreichen Freiburger Inszenierungen von "Hamlet" und "Arturo Ui" seinen Weg an die großen Theater. Auch dass viele unserer Schauspieler inzwischen in Basel, Mannheim, Dresden und Leipzig zu Protagonisten geworden sind, macht mich noch im Nachhinein stolz auf unser Ensemble.
Wir haben sehr eigensinnige Spielpläne entwickelt. Die Kritiker lobten uns zwar dafür, aber geholfen haben sie uns kein einziges Mal, um unbekannte oder schwierige Stücke besser ans Publikum zu bringen. Achtzig Prozent der Texte waren nicht älter als zehn Jahre, wir haben Romanbearbeitungen in Auftrag gegeben und viele Ur- und Erstaufführungen herausgebracht. Bekannte Klassiker haben wir nur dann gespielt, wenn sie in unser Jahresthema gepasst haben. Da waren wir sicher viel zu asketisch. In unserem "Autorenstudio", einer drei Monate dauernden Veranstaltungsreihe, haben wir z. B. das Werk von Elfriede Jelinek, Sarah Kane und Karlheinz Ott präsentiert. Wir haben aufwändige spartenübergreifende Projekte von Musiktheater und Schauspiel entwickelt und mehrere musikalische Revuen, eigens für Freiburg geschrieben, aufgeführt. Ein anregender Partner für gemeinsame Unternehmungen waren die Professoren und Dozenten der Freiburger Universität, vis a vis unseres Theaters.
Hierzulande werde ich oft gefragt, wie ich mich als Österreicher unter deutschen Theaterleuten fühle. Ich bin schon seit neun Jahren aus Österreich weg, aber dazu fällt mir wirklich nichts ein. So viele Musiker, Sänger, Schauspieler, Bühnenbildner und Dirigenten an deutschen Bühnen sind Österreicher. Der Regisseur Martin KuÇsej, der Choreograph Johann Kresnik stammen aus Österreich, Heinz Kreidl ist als Schauspieldirektor mein Kollege in Darmstadt, Wolfang Quetes war Intendant in Kaiserslautern, Paul Esterhazy ist es in Aachen, Monika Pirklbauer in Nordhausen, Elisabeth Schweeger leitet das Schauspielhaus in Frankfurt und in Berlin denken die österreichischen Dramaturgen Hermann Beil und Roland Koberg... Nein, für deutsche Theatermacher ist Österreich kein Thema.
Die Deutschen im österreichischen Theater, das ist sehr wohl ein Reizthema. Dabei waren fast alle Burgtheater-Direktoren Deutsche, und Michael Klügl in Linz, Matthias Fontheim in Graz und Brigitte Faßbaender in Innsbruck machen ihre Sache sehr gut. Doch über die Entscheidung der Salzburger Politiker, einem Herrn, der in Bruchsal und Esslingen Theater-Karriere gemacht haben soll, ab 2004 die Leitung des krankgesparten Landestheaters zu übergeben, kann man nur den Kopf schütteln. Aber der ist ein Schweizer. In Salzburg hat man sich eben nur ums Geld Gedanken gemacht, nicht um die Kunst, da passt, so dachte man, ein Eidgenosse ganz gut hin. In diesem Sinne: "Hents no guet zemme!"
Und in Zürich? Mit einer fürchterlichen Hiobsbotschaft beginnt diese Theatersaison 2002/2003: Man feuert Christoph Marthaler, einen der bedeutendsten Erneuerer des Theaters, den künstlerischen Leiter einer der lebendigsten Bühnen im deutschsprachigen Raum. Es ist nicht zu verstehen, dass die Politiker in Zürich, eine der reichsten Städte der Welt, einen derartig kurzen Atem haben. Soviel Borniertheit als verantwortlichen Bürgersinn zu deklarieren - das ist ein sehr schlechtes Omen für uns.
Nein, ich kann nicht finden, dass das Theater glückliche Zeiten erlebt. Sich ständig rechtfertigen zu müssen, frisst die künstlerische Energie auf. Nein, und man muss auch dem Publikum nicht ständig hinterherrennen, um ihm ins Ohr zu pusten: "Du versäumst etwas, wenn du meine großartige Calderon-Aufführung nicht gesehen hast!"
Meine sonst wirklich kunstbegeisterten Freunde haben überhaupt nicht das Gefühl, etwas zu versäumen, wenn sie das Theater meiden. Ich versuche mich manchmal mit Peter Brooks Satz zu trösten: "Das Wort Theater hat viele unscharfe Bedeutungen. Fast überall in der Welt hat das Theater keinen genauen Platz in der Gesellschaft und kein klares Ziel. Es existiert nur fragmentarisch in einzelnen Bestrebungen". Ich versuche es, aber im Moment will es mir nicht so recht glücken.
Klemens Renoldner, 1953 in Schärding/Inn geboren, Dramaturg, Regisseur, Literaturwissenschafter. Engagements u. a. am Burgtheater und bei den Wiener Festwochen, an den Kammerspielen München und am Schauspielhaus Zürich. 1998-2002 war er Schauspieldirektor in Freiburg/Breisgau.