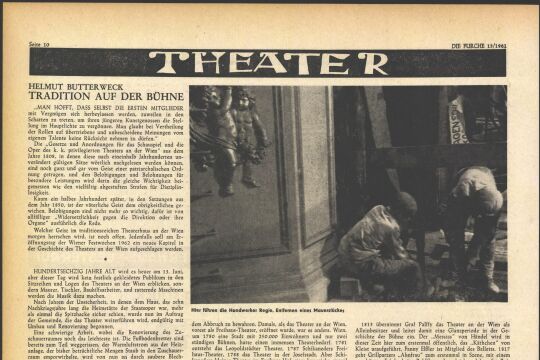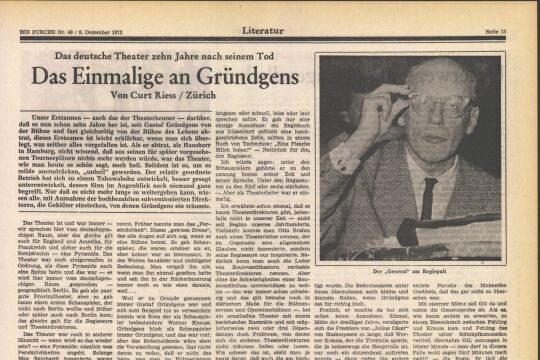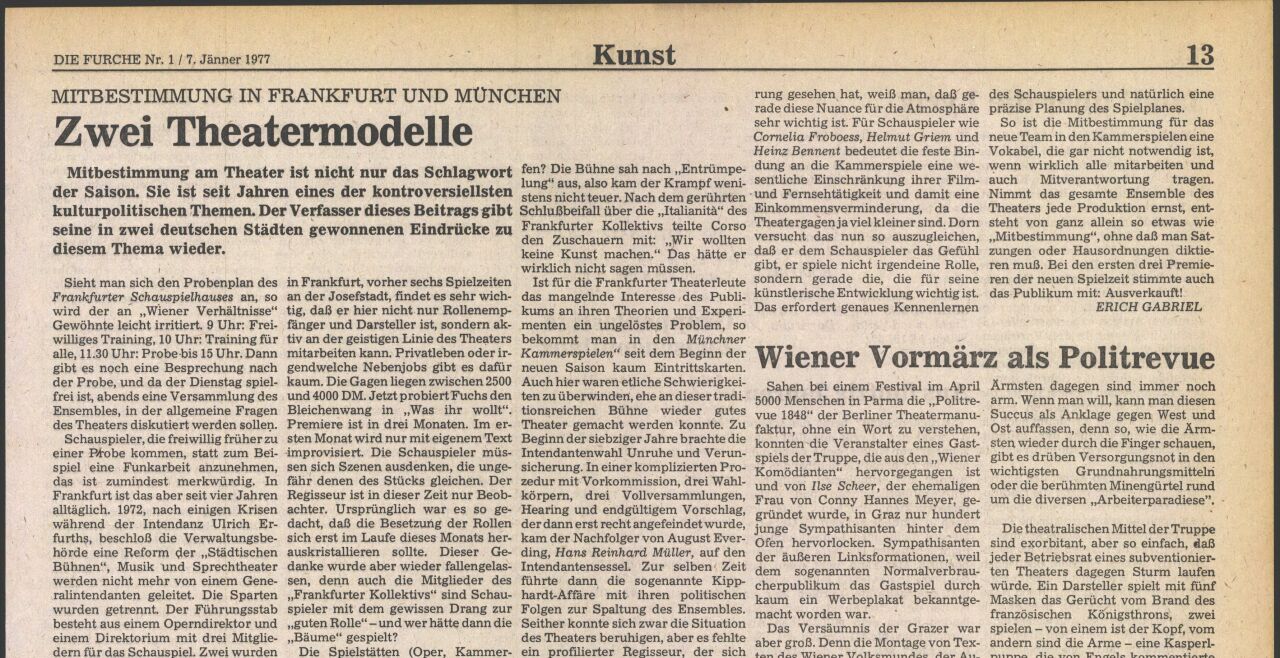
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zwei Theatermodelle
Mitbestimmung am Theater ist nicht nur das Schlagwort der Saison. Sie ist seit Jahren eines der kontroversiellsten kulturpolitischen Themen. Der Verfasser dieses Beitrags gibt seine in zwei deutschen Städten gewonnenen Eindrücke zu diesem Thema wieder.
Mitbestimmung am Theater ist nicht nur das Schlagwort der Saison. Sie ist seit Jahren eines der kontroversiellsten kulturpolitischen Themen. Der Verfasser dieses Beitrags gibt seine in zwei deutschen Städten gewonnenen Eindrücke zu diesem Thema wieder.
Sieht man sich den Probenplan des Frankfurter Schauspielhauses an, so wird der an „Wiener Verhältnisse“ Gewöhnte leicht irritiert. 9 Uhr: Freiwilliges Training, 10 Uhr: Training für alle, 11.30 Uhr: Probe-bis 15 Uhr. Dann gibt es noch eine Besprechung nach der Probe, und da der Dienstag spielfrei ist, abends eine Versammlung des Ensembles, in der allgemeine Fragen des Theaters diskutiert werden sollen.
Schauspieler, die freiwillig früher zu einer P/fobe kommen, statt zum Beispiel eine Funkarbeit anzunehmen, das ist zumindest merkwürdig. In Frankfurt ist das aber seit vier Jahren alltäglich. 1972, nach einigen Krisen während der Intendanz Ulrich Er- furths, beschloß die Verwaltungsbehörde eine Reform der „Städtischen Bühnen“, Musik und Sprechtheater werden nicht mehr von einem Generalintendanten geleitet. Die Sparten wurden getrennt. Der Führungsstab besteht aus einem Operndirektor und einem Direktorium mit drei Mitgliedern für das Schauspiel. Zwei wurden von der städtischen Verwaltung eingesetzt und einer direkt vom Ensemble gewählt. Kulturdezement Hilmar Hoffmann, als verantwortlicher Kulturpolitiker, versprach sich von der Mitbestimmung beim Theater: „Das ist nichts Geringeres als eine seine Existenz sichernde demokratische Forderung. Die Phantasie und die persönliche Engagiertheit könnte in die Qualifiziertheit dessen eingebracht werden, was sich als ein im sehr wörtlichen Sinne lebendiges Theater am wirkungsvollsten zur Sprache bringt und darüber ins Bewußtsein möglichst vieler Bürger.“
Die Bewußtseinserweiterung der Bürger führte zuerst einmal dazu, daß 4000 Abonnements gekündigt und die Opemkarten rarer wurden. Auch in der Saison 1975/76 zählte das Schauspielhaus mit einer Platzausnutzung von nur 68 Prozent zu den sčhlechtest- besuchten Theatern der Bundesrepublik. Und die Schauspieler - sind sie mit dem Mitbestimmungsmodell zufrieden? Die Produktionsverhältnisse sind zwar ähnlich wie an der Berliner Schaubühne, allerdings mit dem Unterschied, daß es bei Peter Stein ungefähr drei Premieren im Jahr gibt, in Frankfurt aber 20. Eine Arbeitsbelastung, wie sie kaum an einem anderen Theater üblich ist. Proben, Vorstellungen, Körper- und Sprechtraining, dreimaturgische Mitarbeit und immer wieder Diskussionen mit dem Ensemble und dem Publikum.
Matthias Fuchs, seit einigen Jahren in Frankfurt, vorher sechs Spielzeiten an der Josefstadt, findet es sehr wichtig, daß er hier nicht nur Rollenempfänger und Darsteller ist, sondern aktiv an der geistigen Linie des Theaters mitarbeiten kann. Privatleben oder irgendwelche Nebenjobs gibt es dafür kaum. Die Gagen liegen zwischen 2500 und 4000 DM. Jetzt probiert Fuchs den Bleichenwang in „Was ihr wollt“. Premiere ist in drei Monaten. Im ersten Monat wird nur mit eigenem Text improvisiert. Die Schauspieler müssen sich Szenen ausdenken, die ungefähr denen des Stücks gleichen. Der Regisseur ist in dieser Zeit nur Beobachter. Ursprünglich war es so gedacht, daß die Besetzung der Rollen sich erst im Laufe dieses Monats her- auskristallieren sollte. Dieser Gedanke wurde aber wieder fallengelassen, denn auch die Mitglieder des „Frankfurter Kollektivs“ sind Schauspieler mit dem gewissen Drang zur „guten Rolle“ - und wer hätte dann die „Bäume“ gespielt?
Die Spielstätten (Oper, Kammerspiele, Schauspielhaus) sind in einem Gebäudekomplex untergebracht. In den Kammerspielen war geradp die deutsche Erstaufführung von Dario Fos Farce „Bezahlt wird nicht“. Im Zuschauerraum überwiegen die 20- bis 30jährigen, die Kleidung signalisiert schicke Bedürfnislosigkeit. Hier sehen sich Intellektuelle ein proletarisches Stück an, und da darf janicht der Gedanke aufkommen, die behandelten Probleme hätten nichts mit den Zuschauern zu tun. In „Bezahlt wird nicht“ beteüigt sich die Frau eines Arbeiters an der Ausräumung eines Supermarktes. Wie die anderen Frauen eines von der Lohnpolitik der Unternehmer besonders betroffenen Stadtviertels, hat sie Waren „mitgehen“ lassen. Im Verlauf des Stückes passiert nun nichts anderes, als daß die Frau die Lebensmittel vor ihrem Mann, einem ordnungsliebenden Arbeiter und Kommunisten, verbergen will. Die simple Story ist für Dario Fo der Anlaß, die Unternehmer genauso anzuschießen wie die italienischen Kommunisten. Inszeniert wurde die „Farce“ von dem italienischen Regisseur Artūro Corso. Aber trotz der Mitbestimmung konnte sich das Ensemble auch hier nicht vor einer Regie schützen, die offensichtlich von deutschsprechenden Schauspielern keine Ahnung hat. Im Stil der italienischen Volkskomödie wird drauflos chargiert und gestikuliert, so daß man sich fragen muß, was haben die bloß gegen die Italiener, daß sie sie so verunglimpfen? Die Bühne sah nach „Entrümpelung“ aus, also kam der Krampf weni- stens nicht teuer. Nach dem gerührten Schlußbeifall über die „Italianitä“ des Frankfurter Kollektivs teilte Corso den Zuschauern mit: „Wir wollten keine Kunst machen.“ Das hätte er wirklich nicht sagen müssen.
Ist für die Frankfurter Theaterleute das mangelnde Interesse des Publikums an ihren Theorien und Experimenten ein ungelöstes Problem, so bekommt man in den Münchner Kammerspielen“ seit dem Beginn der neuen Saison kaum Eintrittskarten. Auch hier waren etliche Schwierigkeiten zu überwinden, ehe an dieser traditionsreichen Bühne wieder gutes Theater gemacht werden konnte. Zu Beginn der siebziger Jahre brachte die Intendantenwahl Unruhe und Verunsicherung. In einer komplizierten Prozedur mit Vorkommission, drei Wahl- körpem, drei Vollversammlungen, Hearing und endgültigem Vorschlag, der dann erst recht angefeindet wurde, kam der Nachfolger von August Everding, Hans Reinhard Müller, auf den Intendantensessel. Zur selben Zeit führte dann die sogenannte Kipp- hardt-Affäre mit ihren politischen Folgen zur Spaltung des Ensembles. Seither konnte sich zwar die Situation des Theaters beruhigen, aber es fehlte ein profilierter Regisseur, der sich ausschließlich an die Kammerspiele gebunden hätte. In Dieter Doms vom Berliner Schillertheater scheint er nun gefunden zu sein. Mit ihm aus Berlin kamen: Hans Günther Martens als persönlicher Referent des Intendanten, die Regisseure und Dramaturgen Emst Wendt und Harald Clemen, Jürgen Rose als Chef der Ausstattung. Ein völlig erneuerter Führungsstab also.
Das ist meist der Zeitpunkt, da die Programmhefte überfließen von neuen Konzepten und Ideen. Ganz im Gegensatz zu solchen, meist in der Theorie steckenbleibenden Bestrebungen, will dieses Team innerhalb des vorhandenen Systems gutes Theater machen. Das klingt sehr schön, aber wie soll es verwirklicht werden? Dorn will zuerst einmal ein wirkliches Ensemble ohne vazierende Gäste bilden. Jeder Schauspieler muß dem Theater mindestens acht Monate zur Verfügung stehen. Er versteht es auch, den Schauspielern Zusammengehörigkeitsgefühl zu vermitteln. Für die erste Premiere im September wurde etwa im vergangenen Juni „Minna von Bamhelm*1 geprobt. Im Juli war Urlaubspause, im August sollten die Proben fortgesetzt werden, Dieter Dom bat nun die Schauspieler, auf den Stolz der Urlauber, die Bräune, zu verzichten, da sie die Optik der Inszenierung gestört hätte. Zur Fortsetzung der Proben erschien das „blässeste Ensemble. Deutschlands“. Eine Laune des Regisseurs auf Kosten der Schauspieler? Nein, wenn man die Auffüh rung gesehen hat, weiß man, daß gerade diese Nuance für die Atmosphäre sehr wichtig ist. Für Schauspieler wie Cornelia Froboess, Helmut Griem und Heinz Bennent bedeutet die feste Bindung an die Kammerspiele eine wesentliche Einschränkung ihrer Film- und Fernsehtätigkeit und damit eine Einkommensverminderung, da die Theatergagen ja viel kleiner sind. Dom versucht das nun so auszugleichen, daß er dem Schauspieler das Gefühl gibt, er spiele nicht irgendeine Rolle, sondern gerade die, die für seine künstlerische Entwicklung wichtig ist. Das erfordert genaues Kennenlernen des Schauspielers und natürlich eine präzise Planung des Spielplanes.
So ist die Mitbestimmung für das neue Team in den Kammerspielen eine Vokabel, die gar nicht notwendig ist, wenn wirklich alle mitarbeiten und auch Mitverantwortung tragen. Nimmt das gesamte Ensemble des Theaters jede Produktion ernst, entsteht von ganz allein so etwas wie „Mitbestimmung“, ohne daß man Satzungen oder Hausordnungen diktieren muß. Bei den ersten drei Premieren der neuen Spielzeit stimmte auch das Publikum mit: Ausverkauft!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!