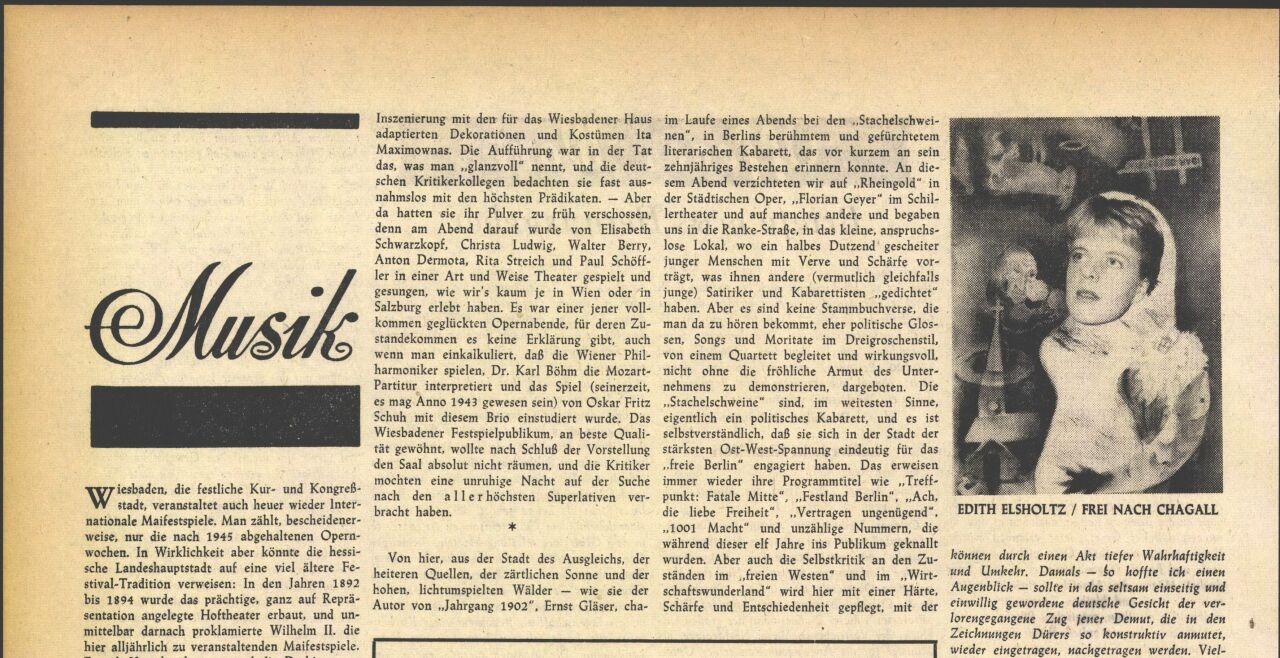
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Figaro und die Stachelschweine
Wiesbaden, die festliche Kur- und Kongreßstadt, veranstaltet auch heuer wieder Internationale Maifestspiele. Man zählt, bescheidenerweise, nur die nach 1945 abgehaltenen Opernwochen. In Wirklichkeit aber könnte die hessische Landeshauptstadt auf eine viel ältere Festival-Tradition verweisen: In den Jahren 1892 bis 1894 wurde das prächtige, ganz auf Repräsentation angelegte Hoftheater erbaut, und unmittelbar darnach proklamierte Wilhelm II. die hier alljährlich zu veranstaltenden Maifestspiele. Es gab Unterbrechungen, und die Darbietungen waren von unterschiedlicher Art. Seit 1954 sind hier, jeweils etwa drei Wochen lang, namhafte internationale Opern- und Ballettensembles zu Gast, die vornehmlich Werke aus dem eigenen Kulturbereich mitbringen. Auf die Präsen-
JO HERBST / FREI NACH BÜFFET tation weniger bekannter und älterer sowie bewährter neuerer Opern wird bei der Programmgestaltung besonderer Wert gelegt. So wurden hier zum Beispiel drei Werke von Leos Janäöek einem internationalen Publikum vorgestellt: 1954 „Aus einem Totenhaus“. 1957 „Das schlaue Füchslein“ und 1958 „Katja Kabanowa“. Überhaupt war während der vergangenen Jahre der Anteil slawischer Meister bemerkenswert: man spielte nicht nur Mussorgsky und Borodin, sondern auch Prokofieff und Gotovac. Von älteren Raritäten seien nur zwei hervorgehoben: „Armida“ von Jean-Baptiste Lully (dargeboten vom Grand Theätre Municipal Bordeaux) und eine „Don-Quichotte“-Oper von Jules Massenet (vorgestellt von der Belgrader Staatsoper). — In diesem Jahr sind vom 1. bis 26. Mai drei ausländische Ensembles zu Gast: die Wiener Staatsoper, das Teatro Massimo Palermo mit Puccinis „Turandot“ und Verdis „Falstaff“ sowie die Staatsoper Belgrad mit Tschaikowskys „Eugen Onegin“, Prokofieffs „Liebe zu den drei Orangen“ und einem modernen Ballettabend. — Die Hessischen Staatstheater steuern folgende Werke bei: Wolfs „Corregidor“, Wagners „Fliegenden Holländer“ und (im Schauspielhaus) ein Stück von Max Frisch.
Die ersten vier Abende gehörten dem Ensemble der Wiener Staatsoper, das je zwei Aufführungen von „Figaros Hochzeit“ unter Kara-jan und von „Cosi fan tutte“ unter Dr. Böhms Leitung gab. Wir sahen die zweite „Figaro“-Aufführung mit Eberhard Wächter, Terese Stich-Randall, Irmgard Seefried, Erich Kunz, Christa Ludwig und Hilde Rössel-Majdan. Es war die uns von Salzburg und Wien bekannte Rennert-
Inszenierung mit den für das Wiesbadener Haus adaptierten Dekorationen und Kostümen lta Maximownas. Die Aufführung war in der Tat das, was man „glanzvoll“ nennt, und die deutschen Kritikerkollegen bedachten sie fast ausnahmslos mit den höchsten Prädikaten. — Aber da hatten sie ihr Pulver zu früh verschossen, denn am Abend darauf wurde von Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Walter Berry, Anton Dermota, Rita Streich und Paul Schöffler in einer Art und Weise Theater gespielt und gesungen, wie wir's kaum je in Wien oder in Salzburg erlebt haben. Es war einer jener vollkommen geglückten Opernabende, für deren Zustandekommen es keine Erklärung gibt, auch wenn man einkalkuliert, daß die Wiener Philharmoniker spielen, Dr. Karl Böhm die Mozart-Partitur interpretiert und das Spiel (seinerzeit, es mag Anno 1943 gewesen sein) von Oskar Fritz Schuh mit diesem Brio einstudiert wurde. Das Wiesbadener Festspielpublikum, an beste Qualität gewöhnt, wollte nach Schluß der Vorstellung den Saal absolut nicht räumen, und die Kritiker mochten eine unruhige Nacht auf der Suche nach den aller höchsten Superlativen verbracht haben.
Von hier, aus der Stadt des Ausgleichs, der heiteren Quellen, der zärtlichen Sonne und der hohen, lichtumspielten Wälder — wie sie der Autor von „Jahrgang 1902“, Ernst Gläser, charakterisierte, der seit Kriegsende hier ansässig ist —, aus der Urbanen Sphäre der ehemaligen kaiserlichen Nebenresidenz, ging's innerhalb weniger Stunden in pausenlosem Flug nach Berlin: Aus der Welt des schönen Scheins (denn der ehemals Sozialrevolutionäre „Figaro“ von Beaumarchais ist nach knapp zwei Jahrhunderten ein rein kulinarisches Werk geworden) in die rauhe WirklieikeitH:deji',.geteihtt Dreimillionenstadt. Hier weht eine andere, trotz der strahlenden Frühjahrssonne kühlere und schärfere Luft. Wir sind — eine kleine Gruppe von Wiener Kulturredakteuren und Kunstkritikern — am Tag der aggressiven dreistündigen Chruschtschow-Rede angekommen. Natürlich bringen sie die Berliner Blätter in Schlagzeilen und man spricht überall darüber. Aber man ist weder aufgeregt noch bedrückt, die Berliner sind dieses Auf und Ab in der Weltpolitik seit vielen Jahren gewohnt, obwohl es dabei ja meist um ihr ganz persönliches Wohl und Wehe geht. „Wenn die meinen, daß sie uns bei kleiner Flamme garkochen können, dann täuschen sie sich: da werden wir bloß abgebrüht!“
Das Wort in prononciertem Berlinerisch fällt im Laufe eines Abends bei den „Stachelschweinen“, in Berlins berühmtem und gefürchtetem literarischen Kabarett, das vor kurzem an sein zehnjähriges Bestehen erinnern konnte. An diesem Abend verzichteten wir auf „Rheingold“ in der Städtischen Oper, „Florian Geyer“ im Schillertheater und auf manches andere und begaben uns in die Ranke-Straße, in das kleine, anspruchslose Lokal, wo ein halbes Dutzend gescheiter junger Menschen mit Verve und Schärfe vorträgt, was ihnen andere (vermutlich gleichfalls junge) Satiriker und Kabarettisten „gedichtet“ haben. Aber es sind keine Stammbuchverse, die man da zu hören bekommt, eher politische Glossen, Songs und Moritate im DreigTOSchenstil, von einem Quartett begleitet und wirkungsvoll, nicht ohne die fröhliche Armut des Unternehmens zu demonstrieren, dargeboten. Die „Stachelschweine“ sind, im weitesten Sinne, eigentlich ein politisches Kabarett, und es ist selbstverständlich, daß sie sich in der Stadt der stärksten Ost-West-Spannung eindeutig für das „freie Berlin“ engagiert haben. Das erweisen immer wieder ihre Programmtitel wie „Treffpunkt: Fatale Mitte“, „Festland Berlin“, „Ach, die liebe Freiheit“, „Vertragen ungenügend“, „1001 Macht“ und unzählige Nummern, die während dieser elf Jahre ins Publikum geknallt wurden. Aber auch die Selbstkritik an den Zuständen im „freien Westen“ und im „Wirtschaftswunderland“ wird hier mit einer Härte, Schärfe und Entschiedenheit gepflegt, mit der verglichen etwa die österreichischen Glossen Helmut Qualtingers und seiner Leute direkt sanft und konziliant anmuten. Hier wird kein Blattl vor den Mund genommen, auch nicht den obersten Autoritäten gegenüber. Gegen den Vorwurf „Kritik ist Beschmutzung des eigenen Nestes“ verteidigen sich die „Stachelschweine“ mit dem Argument, daß sie in ihren 26 Programmen versucht haben, „zu säubern“. Und-daß die „Stachelschweine“ selbst politisch so sauber geblieben sind;' schreiben sie dem Umstand zu, daß sie in der „Badewanne“ geboren wurden — so hieß nämlich ihr erstes Kellerlokal, in dem sie auftraten.....Teil dir den Siegerkranz“ ist der Titel ihres letzten Programms, das wir im Laufe eines ebenso unterhaltenden wie lehrreichen Abends sahen. Aber es ist nicht Aufgabe des Gastes, diese innerdeutsche Kritik zu beurteilen. Worauf es hierbei den „Stachelschweinen“ ankommt, spricht ein Rilke-Brief vom 2. Februar 1923 aus, den sie in ihrem Programmheft (aus dem zwei der hier reproduzierten Bilder stammen) abgedruckt haben:
„Deutschland hätte im Moment des Zusammenbruchs die Welt beschämen und erschüttern können durch einen Akt tiefer Wahrhaftigkeit und Umkehr. Damals — so hoffte ich einen Augenblick — sollte in das seltsam einseitig und einwillig gewordene deutsche Gesicht der verlorengegangene Zug jener Demut, die in den Zeichnungen Dürers so konstruktiv anmutet, wieder eingetragen, nachgetragen werden. Vielleicht waren ein paar Menschen da, die das fühlten, deren Wünsche, deren Zuversicht auf eine solche Korrektur gerichtet waren. Jetzt beginnt es sich zu zeigen und schon zu rächen, daß sie nicht geschehen ist.“
Dies war in seinen letzten Lebensjahren auch eine Hauptsorge des verstorbenen Reinhold Schneider, einer der Gründe seiner Verzweiflung. Aber wir müssen auch sagen, daß immer wieder, in längeren Gesprächen mit verantwortungsvollen Deutschen, diese Sorge anklingt. Darüber darf der hektische Betrieb und das Gebaren gewisser (sehr weiter, sehr einflußreicher) Kreise und Schichten nicht hinwegtäuschen. Berlin, gegenwärtig mehr denn je das Sorgenkind der Bundesrepublik, nimmt auch in dieser Hinsicht eine (positive) Sonderstellung ein. Wir waren im Notaufnahmelager Marienfelde und konnten uns ein Bild machen, was dort Tag für Tag geleistet wird. Hierüber sowie über die kulturelle, wirtschaftliche und politische Situation Berlins hat das Presse- und Informationsamt des Landes Berlin einige Broschüren herausgegeben, die dem Gast in die Hand gegeben werden und denen wir auch in Österreich viele Leser wünschen; denn man braucht nicht an der Spree geboren zu sein, um für die Schwierigkeiten Berlins Verständnis und für seine tapfere Bevölkerung den größten Respekt zu haben ... („Berlin: Tatsachen und Zahlen“, „Berlin: Schicksal und Sendung“, ferner eine Broschüre „Mitten in Deutschland — mitten in Europa“, herausgegeben vom Bundesministerium für Gesamtdeutsche Fragen, Bonn. Postkarte genügt, um in den Besitz dieser wichtigen Dokumentarberichte zu kommen!)
Unsere Reise führt uns zurück nach Westdeutschland, nach Bonn zunächst (wo wir, vielleicht als die allerletzten, das Beethoven-Haus gesehen haben, bevor es, am Tag darauf, einer herostratischen Zerstörung zum Opfer fiel) und von da nach Köln und Düsseldorf. In Köln empfängt uns Professor O. F. Schuh, der uns sein neues Haus zeigen läßt und den Entschluß begründet, während der nächsten zwei Jahre in Wien und Salzburg nicht tätig zu sein. In Düsseldorf lädt Generalintendant Hermann Juch zu einer sehr ambitionierten, wohlgelungenen Aufführung der Oper „Fürst Igor“ im gleichfalls neuaufgebauten Haus. Bohumil Herlischka, der in der Wiener Volksoper den „Teil“ von Rossini inszeniert hat, ist der Spielleiter, Dominik Hartmann hat die Bühnenbilder geschaffen und Reinhard Peters dirigiert ein gutes Orchester und ein recht homogenes Sängerensemble. Wir studieren den Opernspielplan und finden für den nächsten Tag „Dantons Tod“ von Einem angekündigt, für den übernächsten Tag einen modernen Ballettabend. Schade! Da sind wir nämlich schon wieder in Wien... Im Kölner Opernhaus aber wird sich, in der Zeit vom 10. bis 19. Juni, ein Teil des Weltmusikfestes der „Internationalen Gesellschaft für Neue Musik“ abspielen, auf dessen Programm wir die folgenden Bühnenwerke finden: „Der feurige Engel“ von Prokofieff, Alban Bergs „Wozzeck“, ein Ballettabend mit Werken von Bartok und Strawinsky, Nabokows Oper „Der Tod des Grigori Rasputin“, Strawinskys „Nachtigall“ und Ravels „L'Enfant et les sortileges“ sowie Fortners „Bluthochzeit“ nach Lorca. — Wir wurden freundlich dazu eingeladen - aber in diese Zeit fallen die Wiener Festwochen... .
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































