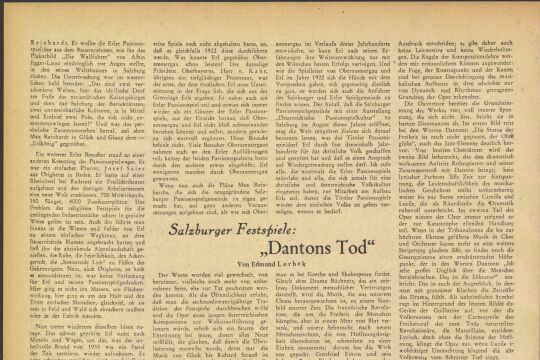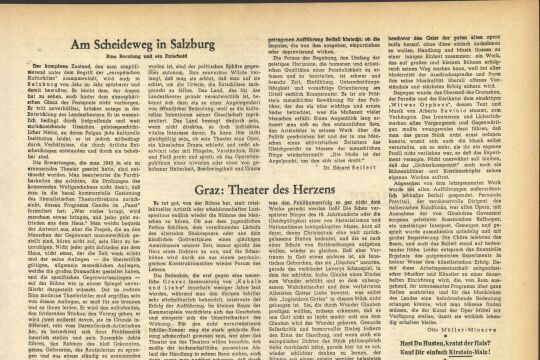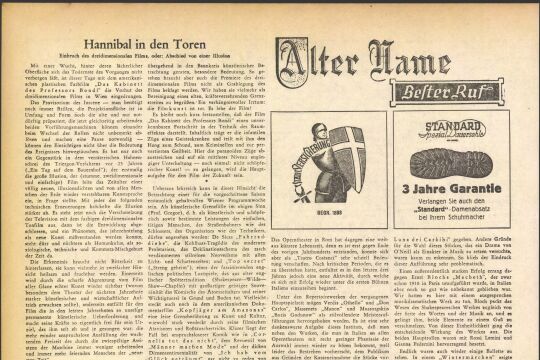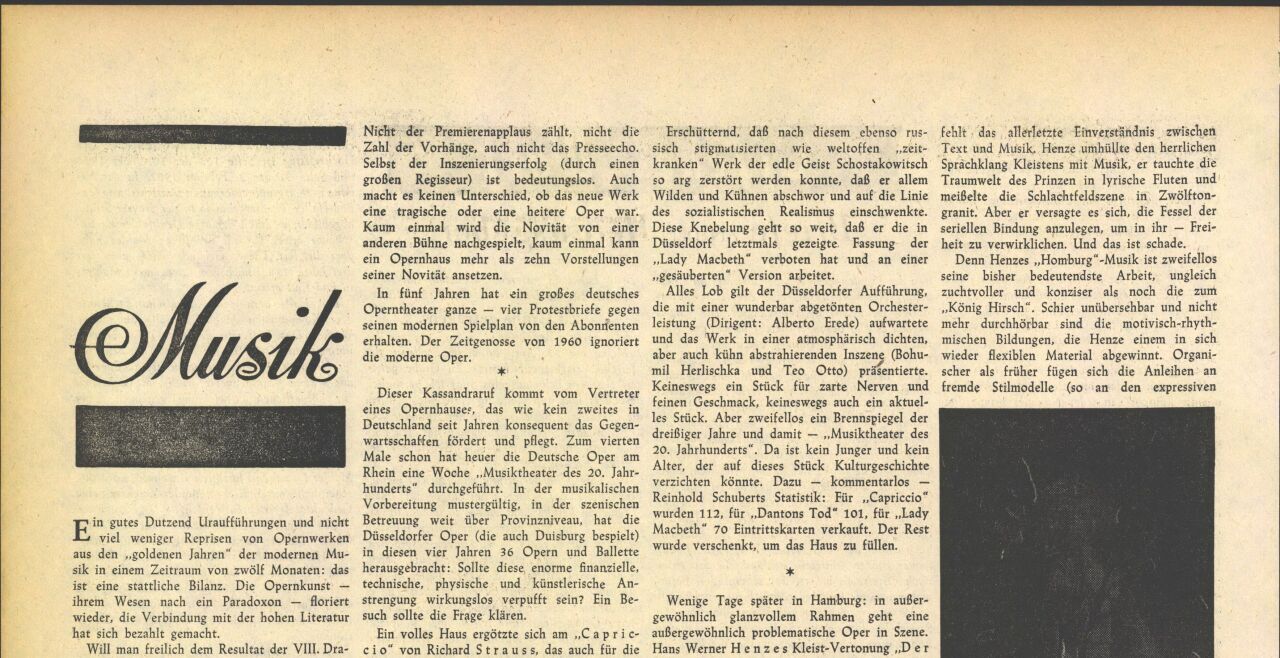
Ein gutes Dutzend Uraufführungen und nicht viel weniger Reprisen von Opernwerken aus den „goldenen Jahren“ der modernen Musik in einem Zeitraum von zwölf Monaten: das ist eine stattliche Bilanz. Die Opernkunst — ihrem Wesen nach ein Paradoxon — floriert wieder, die Verbindung mit der hohen Literatur hat sich bezahlt gemacht.
Will man freilich dem Resultat der VIII. Dramaturgentagung glauben, die vom 14. bis 19. Juni in Wien stattgefunden hat, so trügt (wie viele andere auch) diese Statistik. Ein ganzer Konferenztag war dem Thema „Krise der Oper“ eingeräumt, und wer geglaubt hatte, die Unkenrufe von der Theaterkrise könnten den Abgeordneten des prosperierenden Operngeschäfts kaum mehr als ein Hohngelächter entlocken, sah sich bitter getäuscht. Schwärzer als schwarz malte Reinhold Schubert, als Dramaturg der Deutschen Oper am Rhein selbst einer der aktivsten Förderer des modernen Musiktheaters, die Zukunft seines — und unser aller — Lieblingskindes. Nicht das Interesse der Komponisten fehle und nicht der mutige Einsatz der Opernhäuser; das Publikum versagt. Nie noch seit dem theaterfreudigen Barock sind so viele Novitäten über die Bühne gegangen, nie noch ist die Nachfrage nach neuen Namen und neuen Werken so groß gewesen wie heute — und nie noch hat diese künstlerische Aj^eit^c^we^ni^. Resonanz bei jenen gefunden, für die sie geleistet wird. Nicht ein Mangel an Enthusiasmus, wird hier beklagt; vorbehaltlose Zustimmung aus der Erkenntnis des Kunstwertes eines neuen Werkes ist nicht mehr zu erwarten, seit die Einheit von Kunst und Gesellschaft verlorengegangen ist. Aber auch der Protest, die erbitterte Antwort auf den erlittenen Schock, der Theaterskandal, bleibt heute aus. „Die typische Reaktion besteht gegenwärtig vielmehr darin, daß nicht reagiert wird. Man läßt sich nicht provozieren, man findet die moderne Kunst sowieso scheußlich und hört sie sich von vornherein nicht an, man will nichts “damit zu tun haben, will sie schlechterdings nicht wahrhaben. Auf alles das stimmt Siegmund Freuds Begriff von der .Verdrängung'; nichts macht den Wandel deutlicher, der seit den .heroischen' Jahren der Neuen Musik zwischen 1910 und 1930 geschehen ist.“
Dramaturg Schubert wartete mit nüchternen Zahlen auf. Er hatte im Auftrag der Berliner Dramaturgischen Gesellschaft eine „Erhebung über die Resonanz der modernen Oper beim Publikum deutschsprachiger Opernhäuser“ angestellt und gab eine von keinerlei Affekten verfälschte Rechensehaft. Die Bilanz lautet:Nicht der Premierenapplaus zählt, nicht die Zahl der Vorhänge, auch nicht das Presseecho. Selbst der Inszenierungserfolg (durch einen großen Regisseur) ist bedeutungslos. Auch macht es keinen Unterschied, ob das neue Werk eine tragische oder eine heitere Oper war. Kaum einmal wird die Novität von einer anderen Bühne nachgespielt, kaum einmal kann ein Opernhaus mehr als zehn Vorstellungen seiner Novität ansetzen.
In fünf Jahren hat ein großes deutsches Operntheater ganze — vier Protestbriefe gegen seinen modernen Spielplan von den Abonnenten erhalten. Der Zeitgenosse von 1960 ignoriert die moderne Oper.
Dieser Kassandraruf kommt vom Vertreter eines Opernhause?, das wie kein zweites in Deutschland seit Jahren konsequent das Gegenwartsschaffen fördert und pflegt. Zum vierten Male schon hat heuer die Deutsche Oper am Rhein eine Woche „Musiktheater des 20. Jahrhunderts“ durchgeführt. In der musikalischen Vorbereitung mustergültig, in der szenischen Betreuung weit über Provinzniveau, hat die Düsseldorfer Oper (die auch Duisburg bespielt) in diesen vier Jahren 36 Opern und Ballette herausgebracht: Sollte diese enorme finanzielle, technische, physische und künstlerische Anstrengung wirkungslos verpufft sein? Ein Besuch sollte die Frage klären.
Ein volles Haus ergötzte sich am „C a p r i c-c i o“ von Richard S t r a u s s, das auch für die Teilnehmer am gleichzeitig tagenden 9. Deutschen Mozartfest gespielt wurde. Hier also herrschten Prätention und Genießertum, hier war die Jahreszahl der Entstehung die einzige Legitimation für die Zulassung zum „Musiktheater des 20. Jahrhunderts“. Solche Weitherzigkeif war erlaubt, da das Programm zu/n Ausgleich einen besonders starken Akzent auf dem jüngsten Scharfen versprach. 'Unglück^-' licherweise erkrankte eine Hauptdarstellerin knapp nach der Premiere von Gerhard Wim-bergers „La Battaglia“ in Schwetzingen, so daß die westdeutsche Erstaufführung in Düsseldorf auf den kommenden Herbst verschoben werden mußte. War die Buffa des jungen Salzburgers auch abgesagt, so blieb doch die Seria des Wahlwieners. Die Aufführung von Gottfried E i n e m s Oper „Dantons Tod“ wurde zur Gänze ein „Wiener Abend“, hatte sich doch die Rheinoper auch für die Inszenierung einen prominenten Wahlösterreicher geholt: - Ex-Burgtheaterdirektor Adolf Rott. Sein Ausflug ins Opernfach geriet jedoch nicht völlig glücklich. Wohl hatten die Szenen selbst Brisanz und die Charaktere scharfen Umriß, doch wurde der dramatisch losschnellende Opernerstling Einems durch Rotts Hang zum Symbolisieren eher gebremst. Auch der Sprengstoff der nihilistischen Thesen Büchners wurde nur kernweich serviert. Ob das Werk eine halb abstrakte Inszenierungsform (mit auf offener Bühne heranrollenden Versatzstücken, mit unrealistisch herausgeleuchteten Figuren) verträgt, läßt sich noch diskutieren; eindeutig jedoch war der Verzicht Rotts auf seine vielgerühmte Kunst der Massenführung. Der anonyme Mob der Pariser Revolution agierte so schablonenhaft und einfallslos — wie eben ein durchschnittlicher Opernchor. Dazu kam, daß auch die stark rhythmisierte, in ihren Floskel-Ostinatos faszinierende Musik vom Düsseldorfer Orchester unter Arnold Quennet nicht so gestochen präzise realisiert wurde, daß der anwesende Komponist hätte reine Freude haben können.
Der Höhepunkt dieser (halben) Opernwoche war gleich am Beginn gestanden. Die Aufführung von Dimitri Schostakowitschs Oper „Lady Macbeth auf dem Lande“ zählt zweifellos zu den wichtigsten musikalischen Ereignissen der Saison, die Oper selbst darf als ein Hauptwerk des Expressionismus und als Alban Bergs „Wozzeck“ ebenbürtig gelten. Die geißelnde Härte der musikalischen Sprache, die Vielfalt der aufbereiteten Formen, dazu die Grand-Guignol-Atmosphäre des Stoffes, der trotz aller Schauerromantik weder penetrant noch sentimental wirkt, und die Hektik eines selbstzerstörerischen Lebensgefühls schießen in diesem Werk zusammen zu- einer Schreckenstragödie von beklemmender Dichte.
Erschütternd, daß nach diesem ebenso russisch stigmatisierten wie weltoffen „zeitkranken“ Werk der edle Geist Schostakowitsch so arg zerstört werden konnte, daß er allem Wilden und Kühnen abschwor und auf die Linie des sozialistischen Realismus einschwenkte. Diese Knebelung geht so weit, daß er die in Düsseldorf letztmals gezeigte Fassung der „Lady Macbeth“ verboten hat und an einer „gesäuberten“ Version arbeitet.
Alles Lob gilt der Düsseldorfer Aufführung, die mit einer wunderbar abgetönten Orchesterleistung (Dirigent: Alberto Erede) aufwartete und das Werk in einer atmosphärisch dichten, aber auch kühn abstrahierenden Inszene (Bohu-mil Herlischka und Teo Otto) präsentierte. Keineswegs ein Stück für zarte Nerven und feinen Geschmack, keineswegs auch ein aktuelles Stück. Aber zweifellos ein Brennspiegel der dreißiger Jahre und damit — „Musiktheater des 20. Jahrhunderts“. Da ist kein Junger und kein Alter, der auf dieses Stück Kulturgeschichte verzichten könnte. Dazu — kommentarlos — Reinhold Schuberts Statistik: Für „Capriccio“ wurden 112, für „Dantons Tod“ 101, für „Lady Macbeth“ 70 Eintrittskarten verkauft. Der Rest wurde verschenkt, um das Haus zu füllen.
Wenige Tage später in Hamburg: in außergewöhnlich glanzvollem Rahmen geht eine außergewöhnlich problematische Oper in Szene. Hans Werner H e n z e s Kleist-Vertonung „D e r Prinz von Homburg“ wird vor einem illustren Parkett uraufgeführt. Die künstlerische Auseinandersetzung wird zur gesellschaftlichen Sensation umgebogen, der Affront scheint in der Repräsentation zu ersticken. Wie wird Henze, der Vierunddreißigjährige, auf die Jugend“wiiiken?“-'Hen2e, der beinva-SOi'Jafere älteren-Kleist Zuflucht gesucht hatte?
Dennoch ist Henzes Textwahl durchaus“ verständlich. Das „Moderne“ an Kleist ist endgültig entdeckt, der Zug zum Chaotischen, zum Unbewältigten und Unentschiedenen ist offenbar. Nicht der historische Grundriß des Stücks mußte den Komponisten Henze reizen, sondern der psychologische Aufriß der Figuren, die aus dem Helldunkel zwischen Bewußt und Unbewußt, zwischen Traum und Wachen leben.
Man glaubt es Henze aufs Wort, wenn er ausruft: „Man sage mir: wer hätte mir ein besseres Libretto schreiben können als mein Freund Heinrich von Kleist, wo gibt es Glänzenderes in der deutschen Sprache, wo mehr Freiheit, Wildheit, Pathos, diese hohen Gefühle, die heute niemand mehr aufbringen will, die meine Musik aber suchte!“
Die waffenklirrende Glorie Brandenburgs und die scheue Liebe zwischen Fürstenkindern; das Ineinander von Traumwirklichkeit und Schlachtfeldwirklichkeit; der somnambule Feldherr, der mit Ungehorsam den Sieg erringt, und der antikisch lichte Feldherr, der um der Ordnung willen den geliebten Sieger mit dem Tod bestrafen will; der Jüngling, den die Todesangst bei Weibern um sein Leben flehen heißt, die Offiziere, die ihn mit halber Rebellion befreien wollen, und der streng-milde Herrscher, der dem Geläuterten vergibt — wahrhaftig, das ist ein Vorwand für Musik! Vollends der ethische Kern des Stückes mußte Henze reizen. Erst als er sich dem Urteilsspruch unterwirft, wird Homburg innerlich „frei“ und damit der Begnadigung würdig: welch schönere Symbolfigur kann der Komponist von heute für sein innerstes Problem — die Freiheit in der vorgegebenen Ordnung — denn finden?
Kurz, Henze hätte sich die serielle Technik angeboten, um den geistigen Gehalt des Kleist-Stückes autonom-musikalisch abzuspiegeln, und aus der Distanz zwischen der höchst gegenwärtigen Faktur der Musik und der historischen Form des Dramas hätte sich vielleicht — durch die coincidentia oppositorum — eine ganz neue Operngattung schaffen lassen. Die Voraussetzung dafür wäre aber gewesen, daß die Librettistin Ingeborg Bachmann nicht nur die Aktion „opernfähiger“, sondern auch die Struktur des Dramas für Musik durchlässiger gemacht hätte. Dann wäre Henze zur Entscheidung am Text — der Worte wie der Noten — gezwungen gewesen, während er sie jetzt gerade „außerhalb der aufgestellten Ordnungen“ fällte. Damit fehlt das allerletzte Einverständnis zwischen Text und Musik. Henze umhüllte den herrlichen Sprächklang Kleistens mit Musik, er tauchte die Traumwelt des Prinzen in lyrische Fluten und meißelte die Schlachtfeldszene in Zwölftongranit. Aber er versagte es sich, die Fessel der seriellen Bindung anzulegen, um in ihr — Freiheit zu verwirklichen. Und das ist schade.
Denn Henzes „Homburg“-Musik ist zweifellos seine bisher bedeutendste Arbeit, ungleich zuchtvoller und konziser als noch die zum „König Hirsch“. Schier unübersehbar und nicht mehr durchhörbar sind die motivisch-rhythmischen Bildungen, die Henze einem in sich wieder flexiblen Material abgewinnt. Organischer als früher fügen sich die Anleihen an fremde Stilmodelle (so an den expressiven Schönberg und an den Strawinsky der Psalmensymphonie) und die eigene kühlleuchtende Klangvorstellung ineinander. Das unauflösbar Zwiespältige des Helden Homburg, die Einheit von Heroischem und Lyrischem, von Historischem und Spirituellem, zeigt auch das musikalische Signalement konturenscharf an. Nur den neuen, zukunftsträchtigen Operntyp ist uns Henze schuldig geblieben.
Wohl kaum aber war es die Erkenntnis dieses Mangels, die ein paar Jugendliche laut gegen das Werk protestieren ließ. Dagegen spricht allein schon, daß das Mißfallen nicht nach Schluß der Aufführung bekundet wurde, sondern das letzte Zwischenspiel der Oper durch Radau gestört wurde. Damit war auch klar, daß sich der Protest auch nicht gegen Helmut Käutners verfehlte Inszenierung richtete; denn er traf gerade die „Falschen“: dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg und seinem Dirigenten Leopold Ludwig ist das höchste Lob zu spenden.
Mit Henzes „Prinz von Homburg“ gelingt wenigstens der halbe Gegenbeweis gegen unsere Anfangsthese. Kam die Ablehnung auch nicht spontan, so bot doch ein neues Opernwerk endlich wieder Ärgernis. Vielleicht hat die Ignoranz des Publikums schon ein Ende gefunden. Vielleicht dauert es nicht mehr lange, bis junge Leute pfeifen, weil ein Opernwerk sein Thema nicht mit den Mitteln seiner Zeit gestaltet. Dann wäre die Kluft zwischen Publikum und Neuer Musik wohl wieder geschlossen.