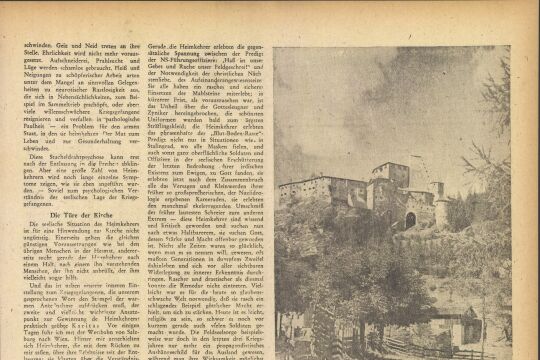Erfüllt das Theater von heute seine Funktion? Zunächst: „Immer scheint dias Theater dm letzten Akt angelangt zu sein“, heißt es im Klageruf eines Theaterleiters. „Es stolpert von einer Not in die andere. Leichen liegen auf seinem Wege, aber die Institution bleibt.“ Denn es geht nicht ohne Theater, Theater auch als Instrument der Deutung, Erklärung oder Veränderung unserer äußeren und inneren Wirklichkeit. Wie dies zu geschehen hat, darauf geben die echten Theaterpraktiker freilich einander widersprechende Antworten. Alle sind sich jedoch einig über das Maß an Unvorhersehbarem, Risikovollem. Einen interessanten Spielplan unter Gegenüberstellung von alten und neuen Werten und Formen zu entwerfen ist nicht schwer. Weit schwerer ist es, das entworfene Programm zu verwirklichen. Weit schwerer ist es, ein Stück, gleichgültig, ob es vor zweitausend Jahren oder heute geschrieben wurde, dem wichtigsten Mitspieler des Theaters, dem Ziuschauer, unter Weckung jener geheimen, musischen, völlig unberechenbaren Kräfte, zu einem Ereignis oder gar zum Erlebnis werden zu lassen.
Man kann Theater als Unterhaltung (die etwas anderes ist als Zerstreuung) begreifen; man kann ihm erzieherische Aufgaben auschreiben. Mian kann — und das wird am häufigsten geübt — Bildungstheater mit Unterhaltungstheater koppeln. „Die Schaubühne ist die Stiftung“, schrieb schon Schiller 1785 (!) im ideaüschen Überschwang und doch nicht unrealistisch, „wo sich Vergnügen mit Unterricht, Ruhe mit Anstrengung, Kurzweil mit Bildung gattet, wo keine Kraft der Seele zum Nachteil der anderen gespannt, kein Vergnügen auf Unkosten des Ganzen genossen wird.“
Die drei Leiter der großen Wiener Sprechfoübnen hängen je nach Persönlichkeit und Programm (mehr oder weniger) der einen oder anderen Theaterform an. Der Spielplan des Burgtheaters umfaßt die klassische und moderne Weltliteratur, während die kleine „Burg“, das Akademietheater, die moderne Bühnendichtung pflegt, wobei jedoch, entgegen dem Vorhaben, so manches Modernistische unterläuft. Das Theater in der J,osefstadt ist im Geiste Max Reinhardts vor allem Schauspielertheater, wählt, wie sein Direktor beim Verkünden der Spielpläne für 1966 67 erklärte, mit Rücksicht auf sein Stammpublikum nur Stücke „mit klarem, nacherzählbarem Inhalt“, unter Vermeidung „unangenehmer Probleme“. („Kein politisches System der Welt wird jemals das Wiener Publikum ändern.“) Während die Kammerspiele als reines Boulevardtheater geführt werden, steht das Kleine Konzerthaustheater weiter gemäßigten Experimenten ohne allzu quälender Note offen. Der Leiter des Volkstheaters hat den eindeutigen Ehrgeiz, lebendiges, zeitgenössisches Theater zu spielen. Obwohl auch er die abnehmende Aufnahmebereitschlaft des Publikums festzustellen glaubt („Je besser es den Menschen gehl, desto weniger wollen sie sich Im Theater mit irgendwelchen Problemen auseinandersetzen.“), das nicht einmal mehr Unterhaltung dm ursprünglichen Sinne, sondern nur ‘noch Zerstreuung sucht, zrwmgf er ihm immer wieder Stücke auf, in denen das Theater als moralische Anstalt Stellung bezieht.
Nicht jeder Theaterleiter glaubt an die Verän’derbarkeit der Welt durch das Drama und das Theater. Auch nicht jeder Autor. Vor zwei Jahren sagte Max Frisch, einer der wenigen bedeutenden deutschsprachigen Dramatiker der Gegenwart, auf einer Dramaturgentagung über ‘die Stücke der Aufklärer: „Ohne ihn, so hoffte Brecht, säßen die Herrschenden sicherer. Eine bescheidene Hoffnung, eine sehr kühne Hoffnung. Millionen von Zuschauern haben Brecht gesehen und werden ihn wieder und wieder sehen; daß einer dadurch seine politische Denkweise geändert hat oder auch nur einer Prüfung unterzieht, wage ich zu bezweifeln.“ Das würde nichts weniger voraussetzen, als daß die Menschen aus Einsicht heraus handeln.
Im Mai 1965 hatte der Direktor des Burgtheaters erklärt, die „Burg“ werde früher oder später Brecht spielen. Denn es sei „heute so weit, daß man Brecht nicht mehr als Politiker ‘empfindet“. Ein Jahr zuvor hatte ‘bereits Max Frisch in seiner Rede vor den Dramaturgen sarkastisch bemerkt: „Ich erinnere mich an nicht allzu ferne Zeiten, ‘als Literaturhistoriker, die jetzt über Brecht schreiben, eine Verblendung darin sahen, wenn man diesen Agitator für einen Dichter hielt; heute ist er das Genie, wir wissen es, und hat die durchschlagende Wirkungslosigkeit eines Klassikers.“ Wohl darum wurde als zweite kommende Herfostpremiere des Burgtheaters Brechts „Das Leben des Galilei“ mit Curd Jürgens (!) in der Titelrolle und mit Kurt Meisel als Regisseur angesetzt. Dem soll später einmal „Puntila und sein Knecht“ folgen. Damit ist ‘die Brecht-Karenz des Burgtheaters gefallen. Nur das Theater in der Josefstadt, das ursprünglich „Der unaufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ bringen wollte, zumal er „kein Körnchen kommunistischen Gedankengutes“ enthalte, distanziert sich weiterhin von Brecht. Vielleicht weil (wie der Direktor seinerzeit schon erklärt hatte) Brechts Stücke auch fernerhin „nicht dem Geist des Hauses entsprechen“.
Zwecks Einstimmung spielte man im Burgtheater vorerst die aus Haßliebe geborene Brecht-Parodie „Die Plebejer proben den Aufstand, Ein deutsches Trauerspiel“ von Günter Grass (Regie Kurt Meisel). Obwohl der „Chef“, die Brecht- Figur des Stückes, oft wörtliche Zitate aus Gedichten, Manifesten und Briefen Brechts spricht, erklärte der Regisseur, er gehe nicht von der Fiktion aus, daß der „Chef“ Brecht sei. Es sollte vielmehr die Charakterlosigkeit eines x-beliebigen Intellektuellen in einer bestimmten Situation gezeigt werden. Die Beurteilung des Stückes war überall zwiespältig und reichte von der „dramatisch uribewältigten, streckenweise peinlich dilettantischen deutschen Geschichtsklitterung“ bis zum „wesentlichen, ungewöhnlich intelligenten, auf höchster Ebene diskussionswürdigen Zeitstück“. Jedenfalls gehörte die Aufführung im Burgtheater trotz manchen Mängeln (zum Beispiel krasser Realismus neben dem ortsüblichen Pathos) vor allem durch Richard Münch als „Chef“ zu den erregendsten Theaterabenden der Spielzeit.
Sie batte ansonst nicht allzuviel Erfreuliches zu bieten.
Eine „Kabale und Liebe“ (Regie Leopold Lindtberg) kam gut an. Aber schon „Peer Gynt“ (Regie Adolf Rott) wies zuviel Dekor und Abschweifungen auf; zudem blieb Josef Meinrad als Peer so ziemlich alles schuldig. Schwerwiegender war schon das Versagen eines jungen Regisseurs in „Traum ein Leben“ (in Grillparzers Jufoiläuimsjähr). Es gelang ihm weder das Wirkliche ins Traumhafte zu steigern, noch die Schauspieler zu führen. Schon die „Sappho“, die zu Saisonbeginn mit dem als Stück mißglückten pseudoreligiösen „Tag des Zorns“ von Brandstaetter von den Bregenzer Festspielen in den Spielplan übernommen wurde, brachte, abgesehen von der überragenden Leistung Judith Holzmeisters in der Titelrolle, völlig konventionelles Theater. Besser geriet „Viel Lärm um nichts“ (Regie Rudolf Steinboeck). Hier verbreitete das im Wortgeplänkel sich findende Liebespaar (Aglaja Sebmid und Sebastian Fischer) heiterste Lustspiellaune. Von der Besetzung der Hauptfigur her war Raimunds „Bauer als Millionär“ (als letzte Premiere des Burgtheaters zwei Tage vor Torschluß) dem Biedermeierklischee entrückt. Der siebzigjährige Attila Hörbiger spielte wirklich das böse Spiel des verblendeten Bauern.
Auch im Akademietheater gab es neben einigem Erfreulichem viel Mißglücktes. Reine Schauspielerstücke muß man schon der ergiebigen Rollen wegen gelten lassen. Zwei Spitzen des Ensembles: Adrienne Gessner und Alma Seidler, können sich nun einmal in „Arsen und alten Spitzen“ komödiantisch ausleben, die Gessner nicht minder in „Madame Princesse“. Mit einigen Einschränkungen waren positiv zu werten: Shaws zornige Komödie „Haus Herzenstod“, ein erschreckend aktueller Spiegel der Welt von heute, brillant gespielt, nur etwas verharmlost. Ergreifend vom Thema her, doch dramaturgisch vom Autor nicht ganz bewältigt, Johann A. Boecks intensiv dargebrachte „Jeanne 44“. Annehmbar und vorn Darstellerischen her fesselnd der Einakterabend von Jean Giraudoux. Aber schon Molieres „Der eingebildete Kranke“ (Regie Lindtberg und Baiser), Gogols „Revisor“ (Regie Boy Gdbert) und etwas gemilderter der Nestroy-Abend „Frühere Verhältnisse“ und „Der Affe und der Bräutigam“ gerieten in hemmungslose Possenhaftigkeit. Die wäre gerade noch für den zweiten Nestroy-Einakter hinzunehmen,, keinesfalls jedoch für die klassischen Komödien.
John Osborns Edelreißer „Richter in eigener Sache“ war ausschließlich für den darin brillierenden Curd Jürgens gewählt.
Der landläufigen Meinung, daß das Theater in der Josef -
stadt in seinem Spielplan nur den Weg des geringsten Widerstandes einscbiage, tritt sein Leiter, ein erfahrener
Theaterpraktiker, immer wieder mit Aufführungen von hohem Niveau entgegen. Molieres „Der Menschenfeind“ und „Endstation Sehnsucht“ von Williams, beide in der Regie von Dietrich Haugk, waren ebenso Beispiele dafür wie Filippos „Die inneren Stimmen“ (Inszenierung Heinrich Schnitzler) und Chayefskys „Der zehnte Mann“ (Regie Michael Kehl- mann), die seltsame Welten erschlossen und vor allem einem der großen Charakterdarsteller Wiens, Leopold Rudolf, Rollen boten. Aber auch in der umstrittenen Urfassung des „Don Carlos“ (Regie Gustav Manker) und in Strindbergs „Vater“ (Regie Heinrich Schnitzler) ließen die Leistungen der Schauspieler Einwände verstummen oder machten ein durchschnittliches Stück wie Rattigams „Winslow-Boy“ erst sehenswert Die drei Einakter „O du mein Wien“ von Rismondo,
Salten, Auernheim waren der liebenswürdige Beitrag des Theaters zu den Wiener Festwochen.
Im Kleinen Konzerthauskeller hielten die Spitze das Zeitstück „Die Flucht“ von Waldbrunn und Winiewicz und der Einakterabend „Probleme auf italienisch“ von Pirandello und Nikolaj, in einigem Abstand gefolgt von Anouilhs „Eurydike“, Horvaths Märchen „Himmelwärts“ und den Einaktern von Mrozek und Saunders. Alles übrige stellte jenen Durchschnitt dar, mit dem sich diie Mehrheit des Publikums zufriedengibt. Dazu gehören nicht zuletzt die großen Lacherfolge in den Kammer spielen, wie „Geschichten mit Papa und Mama“, „Kaktusblüte“, „Fiakermilli“, aber auch immer noch Molnärs vergnüglicher, wenn auch mit zu wenig wienerischer Selbstironie dargebotener „Gardeoffizier“.
Es ist für das Volkstheater charakteristisch, daß es als einziges Theater Wiens seine Spielzeit stets mit einem kräftigen Auftakt beginnt. Im letzten Herbst war es Leopold Wagners „Die Kindsmörderin“, im kommenden wird es Wedekinds „Marquis von Keith“ sein. Ansonst dominierten Zeitstück und Volksstück. Als besonders geglückte Aufführungen seien genannt: die szenische Dokumentation über das aberwitzigste „Tauschgeschäft“ unseres Jahrhunderts, „Die Geschichte von Joel Brand“ von Heinar Kipphard, Rolf Hochhuths „Berliner Antigone“ und H. G. Michelsens „Helm“ in der Sonderreihe „Tribüne der Zeit“, eine modernistische „Maria Stuart“ (Regie Gustav Manker), eine reizende Inszenierung von Kotzebues „Die beiden Klingsberg“ (Regie Leon Epp), Anzengrubers Bauemkomödie „Die Trotzige“ (Regie Oskar Willner). Der alljährliche Brecht war mit der ausgezeichnet besetzten, aber thematisch schon reichlich antiquierten „Heiligen Johanna der Schlachthöfe“ vertreten. Die Aufführung von Ionescos mystischem Schauspiel „Hunger und Durst“ (Regie Gert Omar Leutner) ist als eine für das Volkstheater und für Wien besondere Bühnentat zu werten. Mißglückt war dagegen Arthur Schnitzlers subtiles Alterswerk „Komödie der Verführung“ (Regie Gustav Manker), für deren Darstellung im Volkstheater doch einige Voraussetzungen fehlten. Die hoch einzuschätzeoden Aufführungen in den Außenbezirken mischten Anspruchsloses mit Anspruchsvollem. „Ich habe das Publikum der Außenbezirkstournee heuer unterschätzt. Ich werde das nicht mehr tun“, bekannte der Leiter des Volkstheaters mit für einen Theaterdirektor seltener Offenherzigkeit.
Überblickt man die gesamte Spielzeit der großen Wiener Sprechtheater, dann rangieren an der Spitze einer gedachten Rangliste einige Gastspiele ausländischer Bühnen. Zuvorderst die geradezu unwahrscheinlich vollkommene Aufführung des Piccolo Teatro di Milano von Goldonis „Le Baruffe chiozzotte“ in der Inszenierung des Meisterregisseurs Giorgio Strehler. Die ebenso vollkommene Aufführung des mittelalterlichen Mysterienspiels „Das Leben Josefs“ von Mikolaj Rej des Polnischen Natianaltheaters aus Warschau (beide Gastspiele im Burgtheater). „König Ödipus“ in der beispielhaft archaischen Darbietung des Slowakischen Nationaltheaters aus Bratislava (Gastspiel im Volkstheater). Das Prager Theater am Geländer mit Jan Grossmanns entfesselter Inszenierung von Alfred Jarrys „König Uhu“ (Gastspiel im Theater an der Wien). „Der Snob“ von Carl Stemheim in der Inszenierung von Rudolf Noelte am Berliner Remaissance- theater mit Boy Gobert in der Titelrolle (Gastspiel im Akademietheater). Und schließlich als Bühnenkunst älteren Stils das Pariser Théâtre du Vieux Colombier mit seinen Aufführungen von „Lucrèce Borgia“ von Hugo und „L’otage“ von Claudel auf den beiden Bühnen des Burgtheaters. Zumindest die ersten vier dieser szenischen Darbietungen sind nur mit höchsten Maßstäben zu messen, da sie, genauer gesagt, selbst Maßstäbe sind.