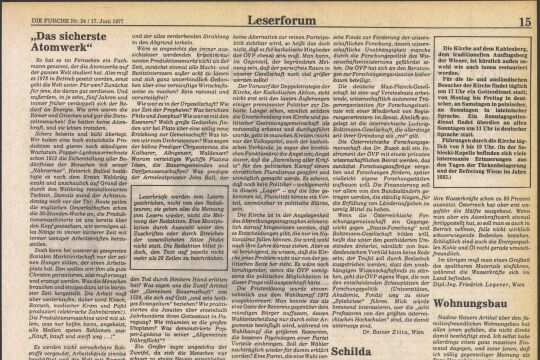Aufsässige Ohnmacht
Mit einer harmlosen „Freiheit in Krähwinkel“ im Volkstheater hatten die Wiener Festwochen, Unterabteilung Schauspiel, begonnen. Mit dem Gastspiel einer gallbitteren, dem Geist rebellischer Ohnmacht exemplarisch auf die Bühne verhelfenden Grazer „Lady und Schneiden-Inszenierung gingen sie konsequent zu Ende.
Mit einer harmlosen „Freiheit in Krähwinkel“ im Volkstheater hatten die Wiener Festwochen, Unterabteilung Schauspiel, begonnen. Mit dem Gastspiel einer gallbitteren, dem Geist rebellischer Ohnmacht exemplarisch auf die Bühne verhelfenden Grazer „Lady und Schneiden-Inszenierung gingen sie konsequent zu Ende.
Konsequent, weil Nestroy „Lady und Schneider“ unmittelbar nach der „Freiheit in Krähwinkel“ schrieb -1848, als die Revolution vorbei und der Nachmärz dä war. Konsequent aber auch, weil der Bogen zwischen diesen Stücken den Weg von der Rebellion in die Resignation und weiter in die Wärme unter den Fittichen der Autorität beschreibt.
Nestroy zeigt in „Lady und Schneider“, wie der Hyginus Heugeign auszieht, Politiker zu werden, und am Ende zu seinem kleinbürgerlichen Glück gelangt. Nestroy zeigt Schneiderleins Weg als den eines politischen Bewußtseins, das blind drauflosmarschiert, ohne sich drum zu scheren, wie die Welt funktioniert, die es erobern will und am Ende noch Glück gehabt hat. In diesem Stück ist, politisch so geschickt verklausuliert wie dramaturgisch wirkungsvoll, das traurige „Ich habs euch ja gesagt“ dessen niedergelegt, der im von der Zensur befreiten Wien 1848 die Traumbilder mit der Warnung vor der Reaktion unter dem Druck des Publikums hatte streichen müssen.
Fritz Holzer in der Hauptrolle kommt unter der wirkungsvoll, aber nie penetrant aktualisierenden Regie von Fritz Zecha Nestroy, wie man ihn aus den Schilderungen der Zeitgenossen kennt, näher als alles, was sich neuerdings in Wien Nestroy-Schauspieler nennt. Vor allem aber wird deutlich, worum es geht, und das heißt hier vor allem: wohin. Nämlich mit zusammengebissenen Zähnen zurück ins Gehabte. Wie sich die Bilder gleichen. Auch wir finden vor lauter Verbund Nachmärz keine Ernäh'zipätjoh.
Nur-geht es' heute nicht um» diepöli-tische, sondern um die des Bewußt' seins, die Voraussetzung dafür wäre, daß von der ersteren vernünftiger Gebrauch gemacht werden kann. Zwei während der Festwochen uraufge-führte Stücke gestatten Schlüsse, wie es damit steht: „Joseph IL“, eine im Auftrag von Hans Gratzer für Wiens Schauspielhaus geschriebene Komödie des Berliners Knut Boeser und „7 auf einen Streich“ von Arik Brauer. Uber letzteres wäre kein Wort zu verlieren, wäre es nicht mit solchem Aufwand produziert worden, wäre es nicht vorher so hochgejubelt worden, wäre es nicht sogar vom Fernsehen übernommen worden und nicht das Stück eines sehr reichen Mannes, der sich für sehr links hält und im Programm der „Frau Vizebgmst“, dem „Hr. Intendant“ und weiteren „Hr.“-schaften für die Förderung eines Unterfangens dankt, das darauf hinausläuft, daß ein unsagbar dümmliches Gereime, Geraunze und Genitalgeblödel als eman-zipative, aufklärerische Kunstübung verkauft wird. Einziger aufklärender Effekt: Man erfährt, für wie blöd ein Publikumsliebling sein Publikum hält, denn daß dieses „Singspiel“ Brauers eigenes Intelligenzniveau spiegelt, möchte ich denn doch nicht annehmen.
Das einzige ernstzunehmende Stück für die unter dem Vormärz-Motto stehenden Festwochen schrieb ein Preuße, der sich mit sehr viel Respekt, ja Liebe, erst widerstrebend, dann aber fasziniert, Joseph XI. vorknöpfte und an Hand der historischen Figur untersuchte, wie Aufklärung in Gang beziehungsweise nicht in Gang zu bringen sei: Von oben geht es demnach nicht. Joseph wird mit dem ganzen Apparat eines um die verinnerlichten Begriffe des historischen Materialismus erweiterten, solcherart überlegenen Bewußtseins vorgerechnet, daß Vernunft von oben nicht zu installieren sei, solches Wollen an seinem eigenen Widerspruch scheitern muß. Die interessante, durchaus spielens- und auch einer noch besseren Aufführung werte „Komödie“ hat eine karge Handlung: Der bereits vom Tod gezeichnete Kaiser steigt auf Reisen bei einem kleineren Adeligen ab, wo es drall und prall zugeht, wird bei einem Riepelspiel seinem besseren, weil konsequenteren Ich konfrontiert, sieht sich aber leider genötigt, selbiges aus Gründen der Staatsräson aufzuknüpfen: Kaunitz und der Polizeiminister Pergen haben gesiegt, die Zukunft begräbt den armen Kaiser, dem nur der Vorwurf zu machen ist, daß er einer war, in Gestalt einer Parade gekrönter Häupter, einer reaktionären Hydra mit vielen Kronen, unter sich. Ein starkes Bild, das aber die Schwächen des Stückes nicht verdecken kann.
Wie Aufklärung, wenn nicht von oben, dann von unten in Gang gebracht werden könnte, bleibt unerör-tert; daß die Menschen von selber auf die richtigen Gedanken kommen, wenn man sie nur läßt, daran muß man ohne langes Fragen glauben. Davon abgesehen, hat Boeser Joseph II. so gründlich analysiert, daß keine Frage offenbleibt, seinen Text so säuberlich der Analyse entlang geschrieben, daß nichts ungeklärt und widerspruchsvoll bleibt, die Wirklichkeit ist radikal auf die Formel gebracht und wird damit spannungslos, streckenweise langweilig, papieren.
Papier bleibt vor allem die große Diskussion zwischen Joseph, Kaunitz, Pergen, dem Leibarzt Brambilla: Da kommt nichts aus den Menschen, alles aus den Begriffen. Dadurch wirkt das Dralle und Pralle zuvor und darnach, womit Boeser nicht spart, aufgesetzt. Aber er glaubt nun einmal an die emanzipative Kraft der Zote, obwohl sie ihre befreiende Wirkung noch nirgends unter Beweis gestellt und eher Ventil- als Antriebsfunktion hat.
Hans Gratzer haut als Regisseur noch einmal feste druff und gibt damit uriruchen Subtilitäten den Rest. Boeser kennt den Markt und baut, theaterwissenschaftlich wohlfundiert und mit Riepelspiel-Literatur belegbar, die obligaten Deftigkeiten ein - Gratzer packt noch ein paar Aggressionsspiele treibende Narren dazu und läßt sie ihre nackten Hinterteile herzeigen. Sie machen den Abend länger, aber seine ausgedehnten Längen nicht kurzweiliger. Doch bleiben intensive Momente im Gedächtnis haften: Toni Böhm als von Hofschranzen wie von Illusionen Verlassener, vis a vis das Nichts; Nicola Filipelli als Arzt Brambilla, der lindert, wo er nicht helfen kann; Michael A. Schottenberg als stelzende Wachsfigur von einem Kaunitz, hinfällig, aber lebensfähig, ein Symbol der Kräfte, mit denen Joseph nicht fertig wird; Justus Neumann als Riepel und als bessere Verkörperung von Josephs Ideen, wie Boeser sie sieht; Maria Bill, Gertrud Roll, Erhard Koren. Boeser teilt auch die in einem Stück über Joseph II. präfixierten antiklerikalen Hiebe aus, macht aber in erster Linie im historischen Gewand den „modernen Gewaltstaat“ dingfest, setzt ihn in Gegensatz zu des Kaisers „besserem Ich“, seinem „Traum vom Glück, von großer, freier Zeit“.
Ein seiner eigenen Fortschrittlichkeit nicht mehr so ganz sieheres politisches Lebensgefühl erkennt sich in der tiefen Tristesse des sterbenden Joseph ebenso wie in der aufsässigen Ohnmacht des Schneiders Heugeign, in Libussas Widerstand gegen die mit Industrie und Kapital gleichgesetzte Männerwelt wie in Horväths schneidender Kritik einer Sozialdemokratie, der in ihrer „Italienischen Nacht“ die Augen zufallen oder bei Weiss in einem „Hölderlin“, der sich verstummend dem eloquenten Opportunismus verweigert. Mit Brecht hingegen tut es sich schwer.
Das Ost-„Berliner Ensemble“, das sein im Vorjahr plötzlich abgesagtes Gastspiel nun nachholte, erntete nicht nur Jubel, sondern auch enttäuschte Reaktionen und den einen oder anderen extremen, in seiner Apodiktik ungerechten Verriß.
Zu sehen waren „Galileo Galilei“, „Puntila“ und Brechts Bearbeitung des Shakespeareschen „Coriolan“. Das Deutsche Schauspielhaus (Hamburg) zeigte vor Jahren, wie frisch und aggressiv ein gestraffter, durch Verzicht auf einen großen Teil der Songs entrümpelter „Puntila“ sein kann. Damit verglichen war der Ostberliner „Puntila“ antiquiert, zerfahren, zu lang. Und erst das Geblödel, das Schlagobers im Gesicht - was soll's? Aber auch in der großartigen „Galileo Galilei“-Neuinszenierung marschieren die singenden Kommentatoren auf die Bühne und erinnern, wenn es spannend wird, das Publikum daran, daß es im Theater sitzt - Brecht hielt das für nötig, heute könnte man auf derartige retardierende Elemente verzichten, ein weniger musealer Betrieb hätte es in seiner dritten „Galilei-Inszenierung doch endlich versucht, aber Ostberlin ist nun einmal Bertolt Brechts Bayreuth.
Was den Ostberlfner Inszenierungen ihre Kraft gibt, ihre Wirkung, ihre Qualität, ist vor allem Ekkehard Schall, Hauptdarsteller aller in Wien gezeigten Aufführungen. Ein Schauspieler von außerordentlicher Wandlungsfähigkeit, Intelligenz, Beweglichkeit und Sprechkultur. Sein alter, nuräußerüch gebrochener Galilei, dessen mit äußerster Sparsamkeit der Mittel mehr illustrierte als gespielte Hinfälligkeit, sollte jedem unvergeßlich bleiben, der das gesehen hat. Hier funktioniert Brechts „V-Effekt“.
Die Meinungen polarisierte der „Coriolan“. Shakespeare interessiert sich für die Hybris des Helden, der sich nur sich selbst verpflichtet und darum berechtigt fühlt, zum Feind überzugehen. Und der seinen Verrat mit dem Tod sühnt. Brecht holt zusätzlich historische Realität herein, stellt Coriolan die sich ihrer Macht bewußt werdenden Plebejer gegenüber, schwächt vielleicht zu Gunsten der sozialen Be-
„Jenufa“ in der Staatsoper züge die dramatische Substanz, zeigt am Ende die Plebejer in der Stunde ihres Sieges - aber seltsam unbeteiligt, beiläufig, ahnen lassend, daß solche Siege selten von Dauer sind.
Damit hat Brecht die Interpretation des Textes vorweggenommen, läßt der Regie nicht mehr viel Raum für eigenen diesbezüglichen Ehrgeiz. Eine abgeräumte Drehbühne, als Dekoration ein mächtiges, drehbares Tor, auf der einen Seite Athen, auf der anderen Co-rioli. Auf dieser Spielfläche eine Aufführung, die das schon gewendete Wort nicht noch weiter wendet, die sich auf ihren Klassiker verläßt, wie er nun ist, den Text realisiert, Pathos nicht entlarvt, sondern Pathos sein läßt, und die damit wie ein erratischer Block in unserer Regietheaterlandschaft liegt. Dazu kommen Schlachtenszenen, choreographisch durchgearbeitet, mit Anleihen vom Sport, aber ebenfalls todernst behandelt. Ein Findling, mit dem nichts anzufangen weiß, wer auf die gängigen, komödiantischeren Inszenierungsweisen eingeschworen ist.
Wie man diese Inszenierung beurteilt, hängt davon ab, ob man bei der Ablöse eines Regiestils durch einen anderen irgendeinen wie auch immer gearteten .'Fortschritt“ walten sieht oder eher zu der Ansicht neigt, daß das Theater Abwechslung braucht und immer wieder einmal bei dem landet, was es schon einmal gemacht hat. Ich neige zur letzteren Ansicht und würde mich daher nicht wundern, wenn die im Ostberliner Theatermuseum namens „Berliner Ensemble“ tradierte Coriolan-Aufführung eines Tages, nachdem man sie lange genug als antiquiert abgetan hat, plötzlich als Vorboten des Kommenden wiederentdeckt.
Denn das Regietheater ist dabei, beim konsequenten Durchprobieren alles dessen, was man mit einem Text anstellen kann, an die Grenzen des dabei Möglichen zu stoßen. Auf Plüsch und Rüschen folgen klare Linien. Und umgekehrt.