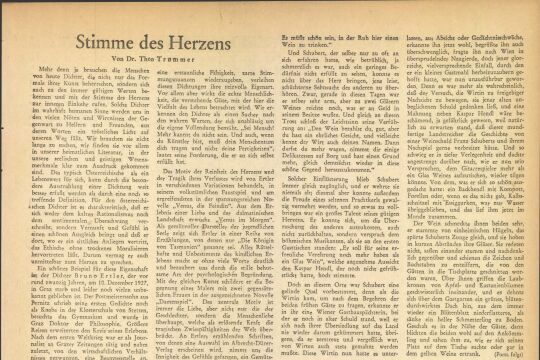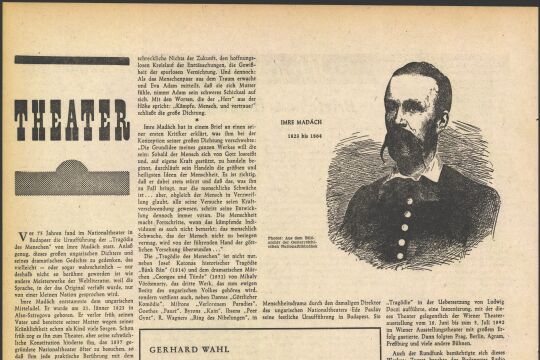Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Humanität des gesprochenen Wortes
Verschiedene Zeitläufte und Epochen kennen nicht nur verschiedene Versuche des kulturellen Lebens und die dazugehörenden Versuchungen, auch die Berufe und Berufungen wechseln im “Wandel der Zeit. Zu letzteren gehört im Raum der europäischen Gesellschaftskultur ein merkwürdiges Phänomen, das in seinen weitverzweigten inneren Bezügen noch zu wenig beachtet worden ist: derAufstiegundUnter- gang der V o rt r ag s kn n s t. — Das Zeitalter Goethes und Byrons liebte die Kunst der Rezitation, des gepflegten Vortrags in seinen großen und kleinen „Gesellschaften" bekanntlich über alle Maßen. Einsam aber bereits ragten in die “Wirrnisse der Gegenwart noch Künstler wie ein Ludwig Wüllner, der Dozent der germanischen Philologie, Schauspieler, Konzertsänger und Rezitator, alles in einer Person, war — und Persönlichkeiten wie ein Karl Kraus, der als Kritiker, Dichter, Journalist und Vortragskünstler immer und allezeit — Karl Kraus blieb. Der Lebensweg dieser beiden großen “Wandelsterne, der in immer sichtbarer werdende Vereinzelung und Vereinsamung, endlich (zumindest bei Kraus) ins bewußte Schweigen führt, zeigt die Abenddämmerung einer Kunst an. Die zunehmende Mißachtung und Entwertung des gesprochenen Wortes, des von einem hohen Verantwortungsbewußtsein getragenen Dienstes am „reinen Wort“ der Dichter und Denker im letzten halben Jahrhundert, geht der zunehmenden Mißachtung und Entwertung der Persönlichkeit, des personalen Menschen, voraus. Wenn die Menschen das Gehör für den stillen Zuspruch des Wortes in innerster Ich-Du-Beziehung verlieren, dann schlägt allzumal die Stunde der Laut- Sprecher und Lautschreier, der Propagandisten der „Masse“ und ihrer destruktiven „Bewegungen“.
Wenn das Schlagwort die Herrschaft über die Sinne und Seelen übernimmt, dann muß jenes Wort weichen, dessen Einklang nur im stillen, demütigen Dienst vernehmbar wird. Die „neuzeitliche" Rhetorik der „Volks"- und Massenredner hat die Wort- kunst der Vortragskünstler erschlagen. Diese Entwicklung vollzog sich jedoch nicht ohne eine besondere Mitschuld einerseits des Publikums, andererseits der Rezitatoren selbst. Das Publikum der letzten Jahrzehnte besaß nicht mehr jene Vertrautheit mit den Werken der Weltliteratur, welche eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der großen Vortragskunst bildet: nicht „Neuigkeiten“ für sensationslüsterne Augenblickshascher, für die Gaffer des literarischen Jahrmarktes der Eitelkeiten, werden von dieser großen Kunst (wir wiederholen es nochmals) geboten — Altvertrautes, Wohlbekanntes soll vielmehr in neuer Tonfarbe, in meisterlicher Vertiefung heranklingen, versunkene, im Schatzkästlein der Seele jedoch wohlverwahrte Glocken, die darauf warten, neu klingen zu dürfen Dann aber kam es, und kommt immer noch, zu einem sehr zeittypischen Versagen der „Vortragskünstler" selbst. Leichtfertig gebundene Blütenlesen, Aller- weltsblumensträuße aus „Klassikern“ und Gassenjungen des Literaturbetriebs vermögen kein Gesicht einer Vorlesung zu formen, bilden keinen Kosmos, keine geschlossene Heilswelt: eine solche fordert, sucht aber mit Recht gerade der arg geplagte, vielfältig geschundene Zeitgenosse, der einen Abend seiner Sorgen unter den lichten, bergendeij Bogen des Trostwortes hoher Geister stellen will.
Diese Erwägungen stellen sich uns nicht zufälligerweise ein. Der Klassikerzyklus der österreichischen Kulturvereinigung hat mit seiner dritten Hörfolge einen Höhepunkt erreicht, der so leicht nicht zu übertreffen sein wird, der uns zumal die Hoffnung gibt, daß die arg daniederliegende Vortragskunst noch nicht gänzlich in den Dämmernissen unserer Zeit untergegangen ist. Raoul Aslan liest Homer und Dante. Die Lesung könnte heißen: antike und christliche Humanität. — Grausame Größe Homers! Die Götter lügen — und trügen den Menschen bis in den Tod hinein —, hart schlägt das Gesetz des Krieges und der Sippenordnung die Helden, taucht sie in die Nacht des Ruhmes und des Übermuts, des Wahnsinns und des Untergangs: Paris und Ajax, Hek- tor und Achill... Und doch gibt es Inseln. Dies ist die frohe Botschaft Homers, das Evangelium der antiken, der heidnischen
Humanität — es gibt Inseln des Friedem, der Menschlichkeit in der wüsten Welt des Hasses, der Fehde, der Raubgier, der Herrschsucht und des Totschlags. Wenn die Götter von ihrem Zwist ruhen, wenn die Massen der Krieger und der Weiber, der Völkerheere und -horden schlafen: dann darf Priamas, der Vater der „Kriegsgefallenen“, aller jener, welche für „Ehre, Freiheit und Vaterland“ auf der Walstatt dieser Welt sterben, zu Achill fahren — und schutzflehend die Knie des Mörders seines Hauses umklammern. In der Begegnung des Greises und des Jünglings leuchtet ein Funke auf, den alle Gräber und Grabschichten Trojas, die Ruinen aller „Alten Welten“ nicht zum Erlöschen bringen konnten. Der zündende Lichtfunke einer neuen, inner- menschlichen Begegnung: in jenem Augenblick, in dem Achill sich, von Mitleid ergriffen, zu Priamos beugt, leuchtet in seinem Auge etwas auf, das keines der tausend Chryselephantinen, der tausend Götter- und Heldenaugen der Antike, die in Gold und Elfenbein, Metallglanz und Edelstein glühen und funkeln, zu künden vermochte: Seele.
Bekenntnis dieser Seele — und des durch ihr Walten und Wirken in unermeßliche Räume und Dimensionen erweiterten menschlichen Innenraums — ist die im Anschluß an Homer von Aslan gelesene Auswahl aus dem dritten und fünften Gesang des Inferno, gipfelnd in der Francesca-da- Rimini-Szene. Der große Florentiner, der es, im Kampf mit allen Großmächten seiner Zeit wagte, parte per se stesso, Partei für sich allein zu sein, sagt hier, im Gleichnis seiner Höllenfahrt, die Erfahrung des ihm nachfolgenden halben Jahrtausends aus: erst im äußersten Abstand von der Zentralsonne des Menschen und der Menschlichkeit wird, in der Spannung letzter Entfernung, die unerhörte Möglichkeit und Strahlweite reinen, geläuterten Menschentums einbekannt: Francesca singt ihr Lied in der Hölle!
Dies die Chance einer neuen Vortragskunst: den Weg der großen Dichter und Deuter aller Zeiten — durch die Hölle ihrer Epoche hindurch — aufzuzeigen — und dergestalt unsere Existenz hier und heute zu entlarven als das, was sie wirklich ist: Vorhölle, die sich für das Sprungbrett in einen neuen Himmel hält.
Leichte Muse
Zwei Wiener Uraufführungen, der leichten Muse gewidmet. Das Burg theater bringt im Rcdoutensaal das Lustspiel von Martin Costa mit Musik von Hans Lang „Der rosarote Fürst de L i g n e“. Vom Rokoko zum Biedermeier: vom reichsunmittelbaren Damenstift Edelstetten, als dessen regierender Fürst sich soeben Karl Joseph de Eigne dem daselbst verwelkenden und neu aufblühenden Damenflor vorstellen darf, führt der Weg des großen Charmeurs und Herzenbrechers über das Paris der letzten Ballfeste und Skandale um Marie Antoinette in das Wien der Kongreßzeit. Ein Stück also für den Redoutensaal geschrieben. Kein Beaumarchais und auch kein Mozart, wohl aber ein redliches Mühen der Autoren von 1948, etwas vom Zauber, von der Beschwingtheit der Welt vor 1848 zart andeutend, wieder aufleben zu lassen. Sie hätten für jene sterbende Welt, die in den Orangerien und Pavillons von Versailles junge frisdi- gewasebene Lämmchen mit bunten Bändern schmückte, während das „Volk von Paris“ nach Brot schrie, kaum ein beredteres Symbol finden können als eben den „rosaroten Fürsten“. Einer Welt der Kavaliere entstammend, in der hohe Politik noch am preziösen Spieltisch, im Kabinett von Lebemännern und im Boudoir liebeslustiger Damen gemacht wurde, tritt de Ligne an die Schwelle einer neuen Zeit, in der Völker als -Heere sich begegnen, die Massen des Ostens zum ersten Male den Boden des „Heiligen Reiches“, des Südens und Westens betreten. Er aber, Joseph de Ligne, lebt seinem Traum — das heißt seinen Träumen, seinen Frauen. Während Europa, das überreife Abendland, in grauen Sorgen zu einer gespenstischen Erscheinung zu werden beginnt, bezaubert der Greis in seinem rosaroten Haus auf der Mölkerbastei noch einmal das Herz seiner ersten und seiner letzten großen Liebe, der kleinen Schwäbin Barbara von Späterle und der kleinen Wienerin Annerl Binder. Hier, wo der Fürst, der Mensch, der Mann sein Versagen vor dem Angesicht, vor der Wirklichkeit der Liebe als Verzicht, als Bescheidung zu deuten weiß, gewinnt er sichtlich das Herz des Publikums. Wie sagte man doch einst?: eine schöne Ausrede ist einen Thaler wert! in unserem Falle, das heißt Stück: drei Akte zu fünf Bildern, deren zwei letzte sich so sehr dehnen wie der ausgezogene Apfelstrudel, den die Zofe Pipinette dem alten Fürsten bereitet. Siebenundzwanzig Schauspieler erkämpfen mit Lied und Wort, Tanz und Maskenspiel einen Achtungserfolg.
Im Wiener Künstlertheater hat sich Fritz Eckhardt als Autor, Hauptdarsteller und Regisseur, unter klangkräftiger Mithilfe von J a r a Beneš, ein Singspiel gebaut, welches ihm nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Schausteller, sprich: Direktor, singende und klingende Freude einbringen dürfte. „Der gestohlene W a 1 z e r“ ist der geglückte Versuch einer Voiksoperetce neueren Stils. Freud und Leid der .kleinen Leute“, einer Schauspielertruppe, welche in der Zone von Neuleng bach und Umgebung um die Gunst der harten Herzen des Dorfbürgermeisters und der Bodenkultur betreibenden Volksgenossen werben muß, dann im Strudel des Wiener Stadtlebens nahe am Scheitern ist und mit Humor und viel Lust und Liebe zum guten und bösen Spiel schließlich doch noch zu Erfolg, zu Glück und Geld kommt — das ist der äußere Inhalt des mit mancherlei getanztem und gesungenem Schabernack reich garnierten Stücks. Begrüßenswert der gesunde Humor und die innere Wärme — sie werden ausreichen, dieses Volksstück mit Gesang in den Frühling und vielleicht auch noch den Sommer hineinzuführen. In der Praterstraße blühen also bereits im März dis Bäume...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!