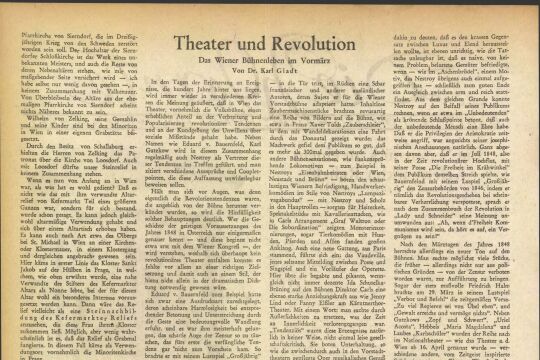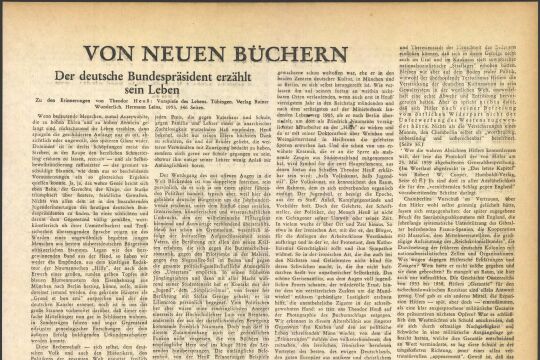Ein echter Österreicher, das war Johann Nestroy schon kraft seiner Herkunft. Die Familie seines Vaters stammt aus dem Dorfe Pogrzebin; sie war als kräftiges Bauerngeschlecht in der dortigen sprachpolnischen, politisch bis Mitte des 18. Jahrhunderts zu Österreich, dann zu Preußen und heute wieder zu Polen gehörenden Gegend sehr verbreitet. Noch zur habsburgischen Zeit wanderte ein Zweig der Nestroy, Nestruy, Niestroj, Nietsruj, Nestrog — alle dieses Schreibweisen finden sich in den Kirchenbüchern — hinüber in den nahen tschechischen Raum, in die Gegend von Troppau-Opava. Dort treffen wir einen nicht unbemittelten Hofbesitzer FrantiSek (Franz), der um 1740 geboren war und der eine wohlhabende Bauerntochter, Esther Riba, heiratete. Dieser Ehe entsproß 1763 ein Sohn, Johann, der am Gymnasium in Troppau, dann an der Wiener Universität studierte, sich in der Hauptstadt als Advokat niederließ und 1799, bereits ein angesehener, vielbeschäftigter und vielverdienender Rechtsanwalt, die anmutige, schöne Tochter der Wiener Patrizierfamilie Konstantin, Magdalene, zum Traualtar führte. Die glückliche Ehe war mit acht Kinder gesegnet. Die zarte Frau, durch die häufigen Schwangerschaften arg mitgenommen, zudem mit der damaligen Wiener Erbkrankheit, der Lungentuberkulose, behaftet, ist früh, allzu früh, 1815, gestorben. Das hat den verzweifelten Gatten aus der Bahn geworfen und die bis dahin sorglos harmonische Kindheit auch des heranwachsenden „Mucki“ (Johann von Nepomuk) beendet. Vater Nestroy wurde lässig in seinem Beruf, verarmte und gab sich wunderlichen Grübeleien hin. Er erlebte noch den Beginn des meteorhaften Aufstiegs seines begabtesten Sohnes und starb 1834.
Der Sohn, am 7. Dezember 1801 im Sternhof zu Wien geboren und am folgenden Tag auf die Namen Johann Nepomuk Eduard Ambrosius getauft, besuchte die vortreffliche Annaschule und hierauf auch das beste, neben dem Theresianum das berühmteste Gymnasium Wiens und Österreichs, das der Benediktiner zu den Schotten. Hervorragende Lehrer weckten seine Fähigkeiten; sie bescherten ihm gleichermaßen eine gründliche humanistische Kultur und Vertrautheit mit der deutschen Muttersprache (von der Vatersprache, dem Tschechischen, hat Nestroy erst später einige Brocken erlernt). Während seiner Schulzeit, die bei ihm unauslöschliche Spuren hinterließ, kam er mit Knaben aus allen Ständen zusammen, mit Söhnen von Fürsten und von Lakaien. Nach dem Gymnasium ging es an die Universität, um sich auf den Juristenberuf des Vaters vorzubereiten. In all dieser Zeit, bei den Schotten und an der Hochschule, war Nestroy mit einem launischen Barometer zu vergleichen. Hatte er dazu Lust, dann gab es bei ihm Schönwetter, glänzende Noten; obsiegte der Hang zur Trägheit, sträubte sich der Ungebärdige gegen den Zwang etwas ihm nicht Behagendes zu lernen, dann regnete es schlechte Zensuren. Obzwar er sich an der Rechtsfakultät nicht an Studentenkrawallen beteiligte, wie sogar manche Träger erlauchter Namen, genoß Nestroy bei den Professoren keinen guten Ruf. Zu oft verzeichneten ihn die Kataloge als abwesend. Schließlich ist er im März 1822 sang- und klanglos von der Alma mater verschwunden, knapp vor Abschluß seiner Studien. Statt in den Hörsälen war er öfter in Ballsälen und bei Tanzveranstaltungen in Häusern der sogenannten zweiten Gesellschaft zu finden, umschwärmt von jungen Damen und sie umschwärmend. Solange er noch Aussicht auf eine Karriere als Beamter oder Advokat zu bieten schien, waren auch die Eltern dem „epouseur“ gnädig gesinnt. So geriet er, unter emsiger Mitwirkung der Mutter seiner Flamme, in die Netze einer ungeachtet des usurpierten „von“ und der bürgerlichen Wohlehrbarkeit des stiefväterlichen Heims, zweifelhaften Sirene. Wilhelmine (von) Nespesny, außereheliche Tochter eines Grafen Zichy und durch ihre Mutter Enkelin eines Majors, wußte dem Leichtentzündbaren den Kopf zu verdrehen. In Eile, die vermutlich nottat, wurde Nestroy mit seiner Erkorenen getraut (7. September 1823).
Er hatte schon seit Jahresfrist die Juristerei an den Nagel gehängt und sich dem Theater gewidmet. Bereits als Schüler und als Student war er mehrmals, auch öffentlich aufgetreten. Seine angenehme Erscheinung, seine schöne Baßstimme schienen ihn zur Bühne zu bestimmen. Am 22. August 1822 hatte er als Sarastro in der „Zauberflöte“ ein Engagement an der Wiener Oper (k. k. Hoftheater nächst dem Kärntnertor) angetreten. Durch höhere Gagen gelockt, ging er aber sofort nach seiner Vermählung ans Deutsche Theater in Amsterdam. Er hielt es
dort nicht lange aus. Nach Österreich zurückgekehrt, mußte et von neuem anfangen, weit tiefer als Anno 1822. Brünn (1824), und ab 1826 die von einem Direktor geleiteten Bühnen in Graz und Preßburg waren die nächsten Stationen eines künstlerischen Weges, der gemäß Nestroys Wunsch zurück nach Wien lenken sollte. Mit Graz verknüpfte sich die bitterste Erinnerung aus dem Privatleben. Nestroys leichtfertige Gattin brannte mit einem Grafen Batthyäny durch, ohne sich weiter um das ihrer Ehe entsprossene Kleinkind oder gar um den Gatten zu kümmern. Der fand allerdings bald Ersatz in der blutjungen Schauspielerin Marie Weiler, die ihm eine treue untadelige Lebensgefährtin wurde, doch mit der vor Kirche und Staat legal verbunden zu sein, ihm die Unauflöslichkeit der katholischen Ehe verbot. Sie schuf Nestroy, dem dies Bedürfnis war, eine bürgerliche Häuslichkeit; sie wachte über die Finanzen des von Natur aus Verschwenderischen; sie sah ihm seine ungezählten Seitensprünge nach und sie erzog sowohl den von der Mutter verlassenen Sohn aus erster Ehe. als auch ihre eigenen beiden Kinder aufs beste Nestroy bewahrte ihr stets Hochachtung, Zuneigung und Dankbarkeit, obzwar er sich nicht selten wider ihre sanfte Tyrannei aufbäumte.
In Graz versuchte Nestroy zum erstenmal auf der Bühne nicht nur als Darsteller, sondern auch als Schöpfer zu wirken. Dergleichen war im Bereich des österreichischen Theaters von jeher, und mehr als andernorts, üblich. Ferdinand Raimund durfte dabei als unmittelbar voranleuchtendes Vorbild dienen. Nestroys eigene Anfänge als Dramatiker waren bescheiden. Etwa zwanzigjährig hat er eine ernstvermeinte Tragödie verfaßt, „Friedrich (Rudolf) Prinz von Korsika“, die zwei Dezennien später, als ihr Autor längst berühmt geworden war, aufgeführt wurde und nach zwei Vorstellungen auf immer von der Szene verbannt blieb. Wir wissen nicht, ob es außer diesem einzigen erhaltenen und kläglichen Beispiel des „höheren“ Schauspiels noch andere ihm ähnliche Produkte aus Ne/troys Feder gegeben hat. Das nächste noch vorhandene Stück war eine „komische Kleinigkeit“ aus dem Jahre 1827, „Zettelträger Papp“, auch sie ohne Wert. Doch schon „Die Verbannung aus dem Zauberreich“, die nach ihrer Premiere in Graz, später in Wien, viel Erfolg hatte, zeigte die Klaue des Löwen, und „Der Tod am Hochzeitstag“ wies bereits alle für Nestroy charakteristischen Eigenschaften auf: sprühenden Witz, hinter vorgeschützter Einfalt sich bergende profunde Gedanken und eine außerordentliche Sprachkunst. Zwei Jahre darauf, im August 1831, war Nestroy an dem für ihn prädestinierten Ort. Direktor Carl, der rücksichtslose, vielgewandte Gebieter über die zugkräftigsten Wiener volkstümlichen Theater, selbst ein hervorragender Schauspieler, Entdecker, Kenner und Ausbeuter vorzüglicher Bühnentalente, seien sie Mimen oder Dichter, erspürte in Nestroy einen Hahn, der goldene Eier legen würde, engagierte dieses Naturwun<'er behandelte den
sogleich Unentbehrlichen mit einer Großzügigkeit, die er sonst vermissen ließ.
Nestroy fühlte sich bei diesem Unternehmer, im Wiedener, dann im Leopoldstädter Theater — das ab 1847 den Namen Carls trug — äußerst wohl und dachte nie daran, es zu verlassen, weder als Schauspieler noch als Autor. Die Reihe der Triumphe des Bühnendichters eröffneten 1832 drei glänzende Parodien: „Der gefühlvolle Kerkermeister“ (auf ein heute längst vergessenes Ballett), „Nagerl und Handschuh“ (auf eine ebenso in den Orkus versunkene Bearbeitung des Aschenbrödelmotivs) und „Zampa“ (auf die bekannte Oper Herolds). Ihnen gesellten sich noch in demselben Jahre zwei sehr geistreiche Satiren in der Form der damals beliebten Zauberspiele hinzu, „Der konfuse Zauberer“ und „Die Zauberreise in die Ritterzeit“. An allen diesen Werken war Nestroys Magie des Wortes in ihrer vollen Kraft zu bewundern; die „Zauberreise“ verhöhnte treffend die romantische Schwärmerei für ein mißverstandenes und unbedacht angehimmeltes Mittelalter, und sie war zugleich eine Art Bekenntnis zur bürgerlichen, ruhigen Behäbigkeit des Biedermeier. Das Publikum war davon begeistert. Als sich aber die Kritik des unerbittlichen Satirikers auch gegen die Schwächen derer kehrte,
die Nestroys Witz bejubelten, wenn er sich an ihnen erprobte, da wurde das naturgetreue Porträt des Wiener Spießers in „Eine Wohnung ist zu vermieten...“ (1837) mit einem tobenden Mißfallen aufgenommen, während ein ähnlicher, zahmerer Angriff gegen das Banausentum, der in eine blendende Parodie eines Holteischen Rührstücks und also einer zweiten Spielart der romantische Gefühlsduselei eingefügt war, nur durch einen halben Durchfall bestraft wurde. Dieses Stück, „Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab“ (1835), setzte die stolze Reihe der in dieser ihrer Eigenschaft erst spät gewürdigten Kleinode aus der Sprache den Tiefsinn holenden Gedankenreichtums fort.
Der erste überragende Bühnensieg war indessen einem Werk zugefallen, das sich auch in der Zeit von Nestroys Halbverges-senheif im Repertoire behauptet hat, dem „Lumpazivagabundus“ (1833). Der Autor hatte es dreimal umgearbeitet, ehe er es unter dem endgültigen Titel auf die weltbedeutenden Bretter brachte. Es wurde in Nestroys Erdentagen über ein viertel-tausendmal aufgeführt. Die seitherigen Vorstellungen sind nicht zu zählen. Es ist unter anderem auch in slawischen Ländern über die Bühnen gegangen. Den Zuschauern gefielen die lustige Handlung, die Situationskomik, die drei Hauptrollen des liederlichen Handwerkerkleeblattes, die großen Schauspielern Gelegenheit zu vollendetem Spiel boten. Scherz und Satire wurden verstanden, nicht aber die tiefere Bedeutung: der im Kometenlied des versoffenen, astronomiebegeisterten Schusters gipfelnde Spott über die vulgärmaterialistische, sich volkstümlich gebenden Pseudo-wissenschaft. Eine Fortsetzung hatte zwar einiges Glück beim Publikum, erreichte jedoch nicht das Niveau des ersten Teils. Als nächster Erfolg, der sich auch durch den inneren Wert des Stücks rechtfertigte, kam „Zu ebener Erde und erster Stock“ (1835). Es mutet uns wie ein früher Auftakt zu den Komödien an, in denen Nestroy während der vierziger Jahre soziale Probleme gestaltet. Ein im Grund tragischer Stoff, die Schicksale des Neureichen, den die „Launen des Glücks“ aus dem ersten Stock vertreiben, worauf ein zweiter, da es die Theaterkonvention so verlangt, edlerer Neureicher dessen Wohnungsnachfolge antritt, wird hier unter heiterem Aspekt betrachtet. Der kleine Mann als Spielball der Fortuna, und zugleich die Frage, wann, wo und wie das Notwendige vom Überflüssigen zu trennen ist, das wird in der weit weniger günstig durch die Zeitgenossen beurteilten, doch ungemein profunden und funkelnden Posse „Die beiden Nachtwandler“ erörtert (1836). Nochmals beleuchtet Nestroy das gleiche Thema, wiederum unter einem anderen Gesichtspunkt in „Glück, Mißbrauch und Rückkehr“ (1838).
Gleich den drei eben genannten, inhaltlich und formal bedeutenden Stücken fanden in jenem Lustrum fruchtbarer Schaffenshöhe Nestroys einige Possen großen Beifall, die ihn weniger verdienten, so „Eulenspiegel“ (1835), „Der Affe und der Bräutigam“ (1836), „Das Haus der Temperamente“ (1837), „Der Färber und sein Zwillingsbruder“ (1840). Doch nun hebt die glänzendste Periode eines Bühnendichters an, der zum in die verborgensten Winkel seiner Zeit schauenden Beobachter und, in jedem Wortsinn, Darsteller seiner Epoche geworden ist und dessen sprachliche Meisterschaft im Aphorismus wie im Dialog sich aufs ergötzlichste und dennoch erschütternd bekundet. Es grollt in den Tiefen der vormärzlichen Gesellschaft. Die soziale Frage kann in einer sich nicht nochmals erschütterbar glaubenden Welt nur noch schwer überhört werden. Noch vor dem Kommunismus geht ein Gespenst um durch Europa, und das lustige Völkchen an der schönen blauen Donau merkte diesen Teufel nicht, bevor er es nicht beinahe am Kragen hatte. Nestroy merkt ihn, und er malt ihn zunächst in kaum sichtbaren Umrissen an die Wand.
So harmlos dreinblickende Unterhaltung, wie sie eine zweite Holteiparodie, „Die verhängnisvolle Faschingsnacht“ (1839), und sogar „Einen Jux will er sich machen“ (1842) zu gewähren scheinen, enthüllt hier dich Macht des Geldes, die „eine reiche Frau“ über den ihr auch sonst hörigen Mann ausübt und das Los des den Launen dieser kapriziösen Dame ausgelieferten braven Dienstboten, dort die zur Sklaverei ausartende Bindung des Kleinkapitalisten und schon gar seiner Angestellten an das „G'wölb“. den Laden, dem als „verflucher Kerl“, sei es auf Tage, Stunden zu entrinnen, Traum dieser freiwillig-unfreiwillig Gefangenen ist. Ohne Umschweife zur Gesellschaftskritik stößt vor „Der Talisman“ (1840) mit seinem Helden, einem öster-
reichischen Figaro und Gil Blas — zugleich ein bestaunenswür-diges Sprachwunder, schon um des einen Satzes willen, in dem ein Toter, nach dessen Beruf gefragt wird, folgende Beschreibung erfährt: „Er betreibt ein stilles, abgeschiedenes Geschäft, bei dem die Ruhe das einzige Geschäft ist; er liegt von höherer Macht gefesselt, und doch ist er frei und unabhängig, denn er ist Verweser seiner selbst.“ Sodann „Das Mädl aus der Vorstadt“ (1841). „Der Zerrissene“ (1843), um einen an Weltschmerz krankenden, durchs Geld Versehrten, im Grunde kerngesunden Sohn eines Parvenüs kreisend, welcher Springinsfeld, nach betrüblicher Erfahrung an falschen Freunden und Ausnutzern, durch die Liebe eines einfachen Landmädchens seine bessere Hälfte und seine eigene Ganzheit findet. Hierauf, in steigender Linie, „Der Unbedeutende“ (1846) - lehrend, daß auch am „unbedeutenden“ Arbeiter die Ehre etwas Bedeutendes ist — und „Der Schützling“ (1847), eindrucksam als Bild aus der ersten Werdezeit der österreichischen Großindustrie, beide Stücke berückend in ihrer sprachlichen Kunst, voller sprühender Einfälle und vernichtender Ausfälle. Zuletzt „Die schlimmen Buben in der Schule“ (1847), von überwältigender, schwereloser Heiterkeit, die zunächst den traurigen Kern — das Los des Dorflehrers und der
Volksschule im Vormärz — vergessen macht und auch die gleichnishafte Bedeutung erst dem Nachdenklichen offenbart.
Wenn der vorlaute Knabe Willibald durch seine Suada und seine Unverfrorenheit die Fhrenmedaille gewinnt und sie dann bei einem Kameraden gegen ein Stück Backwerk umtauscht, dann verspürt man eine Vorahnung der kommenden Epoche, wo dem Kühnen die Welt gehört und die sehr realen den imaginären WeTten, das Fressen der Ehre der Moral vorgezogen wird. Wenn der gütige und halbverblödete Herrschaftsbesitzer den Schall der Posaunen nicht hört, den ihm Trompeter in die Ohren blasen, dann denken wir an einen weit höheren Herrschaftfbesitzer, Ferdinand den Gütigen, der gleicherweise die Posaunenklänge eines nahenden Vorspiels zum jüngsten Gericht nicht vernahm.
Und jetzt ist es schon da, dieses tolle Jahr des Gerichts über die Tradition, die Umwertung aller bisherigen Werte.
Um nicht den Kopf zu verlieren, verliert alles den Kopf. Sogar der kluge und besonnene Nestroy ist mit dabei. Als seine ersten schüchternen Schmeicheleien an die neue Zeit, in den „Anverwandten“ (Ende Mai 1848), vom feinfühlig gewordenen Publikum als ungenügend und dazu im Hinblick auf verstecktes Nörgeln an der Revolution ausgezischt werden, vollzieht er einen radikalen Linksruck und schreibt die eingemein vergnügliche Revolutionsposse „Freiheit in Krähwinkel“ (Anfang Juli 1848). Zwar fehlt darin keineswegs die Satire auf den maulfertigen Journalisten Ultra, doch die meiste Lauge eines ätzenden Spottes ergießt sich über die Reaktion, über den geflüchteten Metternich und über die „Ligourianer“. Diese beiden mochte Nestroy, sonst alles eher denn ein kämpferischer Antiklerikaler, aufrichtig nicht leiden. Der Zorn gegen den von ihm vorher und nachher bewunderten gestürzten Staatskanzler war konjunkturbedingt. Am echtesten war der Witz, der in seiner Ausdruckskraft nun auf dem Apogäum angelangt war. Er strahlte mit unverminderter Treffsicherheit und Wortkunst auch aus den Stücken, die nach dem Zusammenbruch der Revolution unter veränderten Vorzeichen, doch mit derselben Urteilsschärfe und jetzt ohne Konzessionen an eine wiederum stärker denn zuvor, gegängelte „öffentliche Meinung“ verfaßt wurden. „Lady und Schneider“, „Höllenangst“, „Der alte Mann mit der jungen Frau“ — dieses wurde nicht aufgeführt — ziehen die Bilanz der Revolution, eine gewaltige Pleite; doch sie versagen die Hochachtung nicht denen, die an die — wie es damals schien — besiegten Ideale und Schlagworte aufrichtig geglaubt und für sie gekämpft hatten. In demselben Jahr, 1849, da die drei hochpolitischen und außerdem mit weltanschaulichen, ethischen Bekenntnissen durchsetzten Nachworte im Zeichen des in eisigem Winter erstarrten Völkerfrühlings entstanden sind, hat Nestroy auch das Meisterwerk unter seinen Meisterwerken, die großartigste Parodie, nicht nur der deutschen Literatur, geschaffen: „Judith und Holofer-nes“, die grausam in dessen Nichts auflösende Erledigung des „Judith“-Dramas von Hebbel. In diesem Sprühfeuer verbrennt die papierene Untermenschlichkeit des sich aufblähenden Übermenschen aus der grauen Vorzeit, doch es leuchtet aus ihr auch unheimlich die späterer Führer und Verführer aus der greulicheren Jetztzeit.
Hoch hatte die Flamme emporgelodert. Jetzt sank sie in sich zusammen. Nestroys schöpferische Verve erlahmte nun, da er das erste Halbjahrhundert seines Lebens vollendete. Kurz vorher, im April 1851, und ein letztes Mal, im März 1852, gerieten ihm noch zwei vollgültige Komödien, beide sehr mit sozialem Öl gesalbt: „Mein Freund“, das einen mittelmäßigen, wie man das so nennt, Achtungserfolg errang und, mit Fug enthusiasitisch begrüßt, „Kampl“, in dessen abgeklärt weiser, rauher und doch liebenswerter Titelfigur Nestroy eines seiner Spiegel-Ich kreierte (das andere, der milde, tapfere, würdige Hahnrei Kern aus „Der alte Mann mit der jungen Frau“ kam ja nicht auf die Bühne). Die übrigen Stücke aus der Spätzeit des früh Verbrauchten bezeigten das Unvermögen, es sich selbst gleichzutun, ob auch mitunter prächtige Aphorismen in Monolog und Dialog eingestreut waren. Das wüste Geblödel der „Tannhäuser“-Parodie war, mancher lustigen Einfälle ungeachtet, ebenso tief unter Nestroys früherem Niveau wie die Verulkung eines zweiten Wagnerschen Musikdramas, des „Lohengrin“. Nur die beiden allerletzten Possen — „Frühere Verhältnisse“, eine köstliche, auf ihr Ideengerippe beschränkte, den gewandelten Umständen angepaßte Wiederaufnahme des Grundthemas von „Zu ebener Erde“, und „Häuptling Abendwind“, eine charmante Satire auf hohe Weltpolitik, samt Konferenzen und Gipfeltreffen, die uns von seherischer Aktualität dünkt —, beide aus dem Todesjahr 1862, bestätigen Nestroy als den Unvergleichlichen, Unersetzlichen, der er war.
Seine persönlichen Schicksale hatten sich immer günstiger gestaltet. Nach 1848 vergaßen ihm die siegreichen Hof- und Militärkreise schnell seine Freiheitsdelirien und die freiheitlichen Intellektuellen seine Umkehr oder Rückkehr zur Reaktion. Die breiten Massen hatten nie aufgehört, ihn zu lieben und ihn zu bewundern. Als Direktor Carl 1854 starb, wurde Nestroy dessen Nachfolger in der Leitung des Leopoldstädter Theaters. Er wurde dadurch aus einem wohlhabenden zu einem reichen Mann. Doch, wie in allem, war er auch in seiner Erwerbfreude nicht unersättlich. Als er das Schwinden seiner Kräfte deutlich merkte, zog er sich nach Ablauf einer sechsjährigen Direktionsperiode zurück. Nach Graz, ins österreichische Pensionopolis und die Wiege seines künstlerischen, literarischen Aufstiegs. Dort erstand er eine schönes Haus, dazu in Bad Ischl, der kaiserlichen Sommerresidenz, eine elegante Villa. Seine Kinder aus dem Bund
mit Marie Weiler wurden dank kaiserlicher Gnade legitimiert. Der Sohn, dessen vielversprechende Offizierslaufbahn durch Krankheit jäh abgeschnitten wurde, heiratete ein adeliges Fräulein aus ungarischem Geschlecht, die Tochter einen Generalstabsoffizier. Nachkommen sind beiden Ehen, wie auch dem ältesten, legitimen Sohn, versagt geblieben. Das Geschlecht der Nestroy dauert aber in der Deszendenz von Johanns Bruder fort. Es hat unmittelbar vor dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie in der Person eines Großneffen des Dichters, des Generalmajors Nestroy, den Adel erhalten.
Der Schauspieler, der Satiriker, der Zeitkritiker nahm die Einfügung seiner Familie in die „zweite Gesellschaft“, die Festigung seiner sozialen Geltung und der wirtschaftlichen Grundlagen, mit mindestens ebenso großer Freude zur Kenntnis wie seine Bühnenerfolge als Dichter und als Mime. Er war ja und blieb, woran weder seine nach Abwechslung begehrende Neigung zum schönen Geschlecht noch seine voltairianischen Anwandlungen das leiseste.ändern, kein Revolutionär, kein Verächter Und Zerstörer der hßrgeb^cltfen %$en, kein.GlaijJwns^ feind, und .jsr w>r ycu^aTleniiftiJi leidenschaftlicher schwarzgelber Patriot oder, wie ,er. sica selbst bezeichnet; ,s-ein Gutgesinnter/, ein „Legitimist“. Und er hat schließlich im Hinscheiden bezeugt, daß er, wie seinem Monarchen und seinem Vaterland, so auch der angestammten Religion treu geblieben ist. Als er nach kurzer Krankheit in Graz auf dem Totenbett lag, hat er die Sterbesakramente empfangen; er ist nach dem Ritus der katholischen Kirche eingesegnet und begraben worden. Sein Tod, am 25. Mai 1862, wurde als allgemeiner Verlust beklagt. Seine Beerdigung, die in Wien am 2. Juni stattfand, gestaltete sich zu einer gewaltigen Trauerkundgebung. Außer bei Radetzkys Leichenfeier waren noch nie so große Menschenmassen zusammengeströmt, die in mehrfachem Spalier den kilometerlangen Zug von der Kirche zum Friedhof säumten.
Dann kam das Vergessen. Doch nun ist er wieder erstanden, lebendiger denn je zuvor: Johann Nepomuk Nestroy, gleich groß als Österreicher, Menschenkenner, Schauspieler, Komödiendichter, Satiriker und Wortkünstler; der durchschauende, begnadete Schilderer einer seine Epoche und seine Umwelt, doch in seiner allgültigen, heiteren Seelenerforschung und in seiner beispielhaften Meisterschaft entlarvende Analyse, weit hinausragend über seine Zeit und über seinen Raum: ein Großer der deutschsprachigen Bühnendichtung, der Weltliteratur.